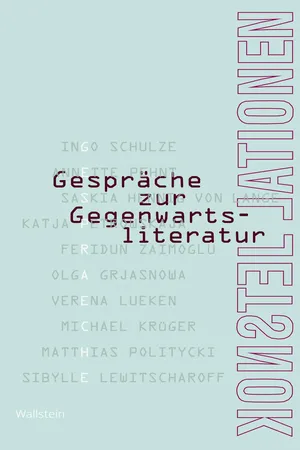![]()
Ich habe den Roman auf einer Glanzfolie geschrieben, die mich radikal begeistert
Sibylle Lewitscharoff im Gespräch
mit Sabine Doering und Matthias Bormuth
Sibylle Lewitscharoff stellte ihren Roman Das Pfingstwunder (Suhrkamp 2016) am 28. Februar 2017 vor. Ihr Buch führt eine Gruppe renommierter Dante-Forscher zu einem internationalen Kongress in Rom zusammen. Die Tagung kreist um die Göttliche Komödie, Dantes epischen Einblick in die Welt nach dem Tod. Einer der Debattierenden ist der Frankfurter Romanist Gottlieb Elsheimer. Bei aller Leidenschaft für den Forschungsgegenstand erscheint dem erklärten Rationalisten das zunehmend ausgelassene Verhalten seiner Kollegen seltsamer und seltsamer. Als die Kirchenglocken schließlich das Pfingstfest einläuten, entschweben sie direkt aus dem Tagungsraum gen Himmel. Nur Elsheimer bleibt zurück, um zu berichten und zu verstehen, was sich zugetragen hat. Denn auch wenn er damit hadert, dass er den anderen nicht folgen durfte, bleibt er so sehr um Bodenhaftung bemüht, dass ihm ein Wort wie »Wunder« nicht leicht über die Lippen kommt.
Mit der Literaturwissenschaftlerin Sabine Doering, die Germanistik und evangelische Theologie studierte und an der Oldenburger Carl von Ossietzky Universität Professorin für Neuere deutsche Literatur ist, unterhielt sich die Schriftstellerin über Sprachverwirrungen und die theologische Dimension von Wundern. Moderiert wurde ihr Austausch von Matthias Bormuth.
MATTHIAS BORMUTH Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Musik- und Literaturhaus. Ich freue mich sehr auf den Abend, zunächst einmal, weil Sibylle Lewitscharoff es überhaupt nach Oldenburg geschafft hat, nach einigen nicht ganz einfachen Hürden bei der Anreise. Ich freue mich aber vor allem, weil Das Pfingstwunder wirklich ein sehr besonderes Buch ist. Es ist ein Buch des Geistes, ein Buch des Enthusiasmus.
Frau Lewitscharoff ist von Hause aus Religionswissenschaftlerin. Sie hat in Berlin bei Jacob Taubes studiert, der durchaus ein messianischer Geist war, ein Religionswissenschaftler, der wusste, dass der Geist bewegen will. Und diese Perspektive des bewegenden Geistes spielt in dem Buch, in dem es auch um die Göttliche Komödie von Dante Alighieri geht, eine entscheidende Rolle. Sibylle Lewitscharoff ist vielen Leserinnen und Lesern bekannt, seit sie 1996 den Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt. Sie kann seitdem auf eine ganze Reihe von Auszeichnungen zurückblicken, die ich nicht alle aufzählen möchte. Der vermutlich bedeutendste, der dennoch genannt werden soll, ist der Georg-Büchner-Preis, den sie 2013 erhielt, jener Preis, der auf den Olymp der deutschsprachigen Schriftsteller verweist, in dem sie heimisch ist. Sibylle Lewitscharoff ist eine gelehrte Schriftstellerin, deren Bücher immer auch Bewusstseins-Bücher sind. Ein gutes Beispiel dafür ist ihr 2011 erschienenes Buch Blumenberg. Sie denkt sich darin nicht nur in die Figur des Philosophen Hans Blumenberg hinein, sondern bietet eine eigene Choreografie seiner Wirklichkeit und seines Nachdenkens. Dieses Element der eigenen Choreografie tritt auch in ihrem Buch zu Dantes Göttlicher Komödie wieder deutlich hervor. Es beinhaltet reale, surreale und komische Elemente.
Unsere Gesprächspartnerin zu diesem Buch ist Sabine Doering, Theologin und Germanistin, die insbesondere ausgewiesen ist in der Hölderlin-Forschung. Sie lehrt an der Universität Oldenburg und ist Präsidentin der Hölderlin-Gesellschaft. Friedrich Hölderlin ist vielleicht kein Pendant zu Dante, aber er ist doch jemand, der als Dichter auch sehr philosophisch war …
SABINE DOERING … und auch ziemlich gut.
MATTHIAS BORMUTH Beide, Dante wie Hölderlin, dichten mit großem Pathos, aber das Pathos hält Stand, die Dichtung hält Stand. Sie sind beide Schwergewichte der Weltliteratur. Ich freue mich, dass Sie, Frau Doering, die Gesprächspartnerin von Sibylle Lewitscharoff sind. Wir haben ausgemacht, dass ich mich zurückhalte in der Beschreibung des Buches und Ihnen das Wort überlasse. Bitte!
Das ist für jeden Rationalisten eine absolute Zumutung
SABINE DOERING Danke, Herr Bormuth! Indem Sie mir den Ball zuspielen, beginne ich mit meinem Leseeindruck. Und ich schicke vorweg, dass der erste Eindruck, den ich formuliere, Bewunderung zum Ausdruck bringen soll. Frau Lewitscharoff, Ihr Roman ist eine großartige Zumutung! Er ist es in vielerlei Hinsicht. Ich greife jedoch drei Aspekte heraus und denke, dass wir über diese gut ins Gespräch kommen werden. Die erste Zumutung liegt im Sujet: ein akademischer Kongress; 34 Philologen, also 34 Menschen, die sich als Professoren mit Literatur beschäftigen, drei Tage in einem Raum; kein Einstellungswechsel; kein Schauplatzwechsel; ein kollektives Heldentum. Dann gibt es den Erzähler, der als Nummer 34 eine Sonderrolle einnimmt und durch dessen Reflexion wir erfahren, was drei Tage lang dort in Rom geschehen ist. Das ist wirklich ein Plot, der uns Lesern einiges zumutet. Zweite Zumutung: Ihr Buch ist ein Roman über eines der großartigsten und zugleich unbekanntesten Werke der Weltliteratur: Dante Alighieris Göttliche Komödie, geschrieben im 14. Jahrhundert in Italien. Ein unglaublich gelehrtes Buch. Und auch Sie bringen uns einiges bei. Auf der Suche nach einer Lektüre für die Weihnachtsferien würde vermutlich kaum jemand freiwillig von sich aus sagen: Ich will einen Roman lesen, in dem lauter Professoren vorkommen, die sich über Übersetzungsfragen streiten. Die dritte und vielleicht auch größte Zumutung besteht jedoch darin, dass es um Wunder geht. Ihr Protagonist scheut sich zunächst noch, das Wunder beim Namen zu nennen. Er spricht von dem »Vorkommnis«, von dem »Ereignis«. Und auch hier wird keine Spannung aufgebaut. Man erfährt ziemlich rasch, was geschehen ist. 33 von den 34 Philologen plus drei andere Personen sind am Pfingstsamstag beim Glockengeläut in Rom in den Himmel gefahren. Das ist eine heftige Zumutung. Aber erst alle drei zusammen bedingen die ganz große Zumutung, die Sie bitte wirklich als Kompliment verstehen, denn Ihr Roman liest sich großartig!
SIBYLLE LEWITSCHAROFF Danke! Das höre ich gerne.
SABINE DOERING Sind das für Sie bei der Anlage des Romans auch Zumutungen gewesen?
SIBYLLE LEWITSCHAROFF Mit einer Zumutung hat der Roman tatsächlich extrem zu tun. Seine Hauptfigur ist der Erzähler, ein deutscher Romanist, der in Frankfurt an der Universität unterrichtet und als Dante-Kenner auch theologisches Wissen besitzt – das muss man als Dante-Kenner schon, zumindest rudimentär –, aber zugleich ein Rationalist ist, wie wir es von den meisten Professoren kennen. Vor dessen Nase ereignet sich ein riesiges Spektakel, eigentlich ereignen sich zwei Spektakel, die miteinander verbunden sind. Zunächst einmal stammen die 34 Teilnehmer des Kongresses aus unterschiedlichen Sprachregionen. Aus Polen, aus China, aus Japan, aus Russland und andern Ländern. Es sind also sehr viele Sprachen vertreten. Und man muss wissen, dass Kongresse üblicherweise sehr spitzig sind, denn es geht dort auch um Konkurrenzen. Der Kongress in meinem Roman ist jedoch eine erstaunlich gutartige Versammlung. Und in dem Moment, in dem am Samstagabend das Pfingstwunder seinen Anflug nimmt, strebt diese Gutartigkeit einem Höhepunkt zu, bei dem alle Sprachen durcheinanderfliegen. Ein Chinese versteht plötzlich einen Polen, die Französin versteht die Japanerin und so weiter. Sprachen, die den einzelnen Kongressteilnehmern bisher verschlossen blieben, sind hier plötzlich pfingstwunderlich geöffnet. Und dann klettern die Wissenschaftler auf die Fensterbänke und verschwinden mit einem riesigen Enthusiasmus gen Himmel. Das ist für Sie, für mich, für jeden Rationalisten eine absolute Zumutung.
SABINE DOERING Sag’ ich doch!
36 Menschen gen Himmel fahren zu lassen übersteigt auch die Möglichkeiten eines guten Professors
SIBYLLE LEWITSCHAROFF Genau! »Zumutung« ist das treffende Wort. Ich habe mir dann vorgestellt, wie so ein armer Kerl wie mein Erzähler damit umgeht. Er hockt nach der erfahrenen Zumutung wieder in seiner Frankfurter Bude und weiß nicht aus noch ein. Er kann nicht erzählen, was er erlebt und gesehen hat, weil ihn dann jeder für einen Verrückten hält, obwohl er selber dabei war. Aber es ist eine verbürgte Tatsache, dass 36 Menschen einfach verschwunden sind. Das steht auch in der Zeitung. Um diese Geschichte herum habe ich den Roman komponiert und den armen Zurückgebliebenen in Frankfurt unter anderem in eine schlimme Depression fallen lassen.
SABINE DOERING Und auch uns Leserinnen und Leser bringen Sie in diese Situation. Wir glauben dem Übriggebliebenen, der auch noch den schönen, erzprotestantischen Vornamen Gottlieb trägt. Wir glauben ihm, dass er nicht halluziniert hat. Wir wissen, dass die Polizei dort war. Die anderen Kongressteilnehmer sind also wirklich verschwunden. Die Frage ist jedoch, wie er mit dieser Erfahrung umgeht. Die generelle Frage, wie man Wunder erklärt, besteht immerhin, seit es die gelehrte Bibelwissenschaft gibt.
SIBYLLE LEWITSCHAROFF Genau!
SABINE DOERING In Ihrem Roman klingt dann Verschiedenes an, was wir zum Beispiel aus der Aufklärungstheologie kennen, etwa die Frage nach der Wahrhaftigkeit solcher Ereignisse, also danach, ob ihre Darstellung schlicht eine Fälschung sei. Oft und häufig wurde zum Beispiel die Frage diskutiert, ob die Jünger die Auferstehung Jesu gefälscht haben. Ihr Roman wirft die Frage auf, ob Gottlieb selbst das Verschwinden irgendwie fertiggebracht haben kann. Aber 36 Menschen gen Himmel fahren zu lassen übersteigt auch die Möglichkeiten eines guten Professors. Es ist Ihnen gelungen, mit diesem ganz und gar zeitgenössischen, r...