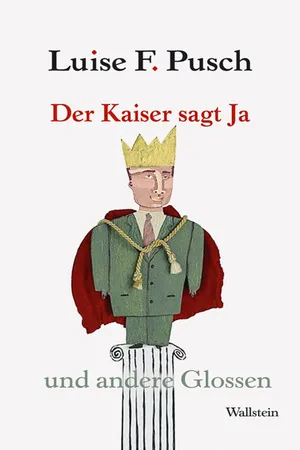![]()
Literatur
Lessings Neffe
Seit gut 200 Jahren kennen wir Rameaus Neffe von Diderot in Goethes Übersetzung – war das klassische Werk des großen Aufklärers nur das Prequel zu »Lessings Neffe«??
Aber der Reihe nach: Vor einer Woche hatte ich einen Workshop zur feministischen Sprachkritik in Graz. Getreu dem Titel der Veranstaltung schickte ich die TeilnehmerInnen an die Arbeit und ließ sie u. a. den lehrreichen Zeitungsartikel »Der Kaiser sagt Ja« analysieren (s. S. 105 f.). Sie identifizierten im Handumdrehen sämtliche Sexismen und brachten mir sogar noch was bei. Unsere Kultur kenne nicht nur die Vorschrift »Mann vor Frau«, sondern auch »Celebrity vor Nobody«, erklärten die GrazerInnen. Neben »Kaiser Franz heiratet seine Heidi« sei deshalb auch »Madonna heiratet ihren Guy« durchaus gängig.
Einer der Kommentatoren zu meinem Blog hatte mich auch schon darauf hingewiesen: »Kinderkriegen können auch Kühe, aber gut Fußball spielen können nur Götter!«
Falsch – möchten wir diesem rüden Herrn zurufen. Die Frauen unserer National-Elf können beides.
Aber die Regeln »Mann vor Frau« und »Celebrity vor Nobody« erklären noch nicht alles. Es gibt auch noch die Meta-Regel »wir vor den anderen«. (»Mann vor Frau« ist nur die patriarchale Ausprägung dieser Regel.) Die beiden deutschen Nobelpreisträger für Chemie und Physik, Ertl und Grünberg, wurden bei uns endlos gefeiert; in den USA blieben sie Nobodys. Es war nur zu lesen, daß der Physikpreis an Leute gegangen war, ohne die es den iPod nicht gäbe (das klang doch wenigstens nach amerikanischer Mitwirkung). Auch von dem Preis an Doris Lessing war wegen der Turbulenz um den Friedenspreis an Gore noch nicht viel durchgedrungen, als ich eine Woche später in Boston ankam.
FemBio-Autorin Cristina Fischer, die regelmäßig die Ostsee-Zeitung liest, berichtet mir hin und wieder von merkwürdigen Lesefrüchten. Zum Nobelpreis an Doris Lessing titelte die OZ: »Nobelpreis für Gysis Tante«.
Ob die Ostsee-Zeitung ihre LeserInnen nicht ein wenig unterschätzt? Glauben sie wirklich, daß MeckPomm so provinziell ist, daß mann Doris Lessing nicht kennt, sondern nur ihren angeheirateten Neffen Gregor Gysi?
Wir sollten die Anregung der OZ sofort aufnehmen und hinfort statt »Gregor Gysi« nur noch »Lessings Neffe« sagen. Es wird ihn sicher freuen.
Die Kommentare zu Lessings Nobelpreis waren überhaupt sehr aufschlußreich. Unser Literaturpapst fand die Wahl bedauerlich, auch Denis Scheck hätte lieber Philip Roth oder John Updike gesehen. Ich muß zugeben, daß ich mit Lessing auch ein wenig enttäuscht war. Ich warte nämlich jedes Jahr darauf, daß Swetlana Alexijewitsch den Preis bekommt, nachdem Galina Starowojtowa und Anna Politkowskaja ermordet wurden, bevor sie mit dem Friedensnobelpreis geehrt werden konnten.
Übrigens fand keiner unserer Literaturversteher, die jemand anders für den Preis vorgesehen hatten, daß der Preis an eine andere Frau hätte gehen sollen. Sie fürchten wohl, daß der Preis dann an Prestige verliert. Aber zum Glück werden die Preise in Skandinavien vergeben, wo in letzter Zeit das Prinzip »Mann vor Frau« sogar für die Thronfolge abgeschafft wurde.
Umberto Eco fand die Wahl in Ordnung, wunderte sich nur, daß der Preis schon wieder nach England geht. Italien wäre ihm da wohl lieber gewesen. Elfriede Je linek fand den Preis an Lessing überfällig, genau wie die Preisträgerin selber. Sehr sympathisch auch die Reak tion von Julia Franck, die ein paar Tage zuvor den deutschen Buchpreis bekommen hatte: Natürlich stünde der Preis Lessing schon lange zu, er komme viel zu spät. »Hoffentlich hat sie noch genug Zeit, das Geld auch auszugeben«, meinte sie nachdenklich. Sie spricht die wirklich wichtigen Dinge des Lebens unverblümt an, ganz wie Doris Lessing. Möge sie selbst den Preis zeitig genug bekommen – aber erst nach Swetlana Alexi jewitsch!
Oktober 2007
Pippi Langstrumpf, Harry Potter und Co.
In diesem Monat (November 2007) würdigt FemBio (www.fembio.org) ungewöhnlich viele Kinderbuchautorinnen: In der ersten Woche Else Ury zum 130. Geburtstag, in der zweiten Elise Averdieck zum 100. Todestag, in der letzten Louisa May Alcott zum 175. Geburtstag. Und jetzt in der dritten Woche Astrid Lindgren die Große zum 100. Geburtstag. Ihre Verlage und alle anderen Lindgren-Fans kommen schon das ganze Jahr aus dem Feiern nicht mehr heraus.
Eine Leserin schrieb mir neulich, ob ich nicht mal was zu dem eklatanten Sexismus in den Harry-Potter-Büchern sagen wolle. Ich muß zugeben, ich kenne mich mit Harry Potter kaum aus, habe mich nur immer gefreut, daß mit J. K. Rowling mal eine Frau das richtig große Geld abräumt.
Ich habe nur den ersten Potter-Band gelesen und den ersten Potter-Film gesehen, mehr mußte es nicht sein, schließlich bin ich kein Kind mehr, sondern eine Matrone. Rowlings übersprudelnder Einfallsreichtum gefiel mir sehr, aber ihre Charaktere fand ich zu flach. Und natürlich zu männlich insgesamt, da halfen auch Hermione/Hermine und die paar Lehrerinnen nicht, deren Namen ich vergessen habe. Männerhorden reichen mir schon in der Wirklichkeit. Bei meiner Lektüre bevorzuge ich eine schöne weibliche Mehrheit als Gegengewicht – oder mindestens Ausgewogenheit.
Ich bin mit den ausgewogenen Kinderbüchern von Elise Averdieck aufgewachsen, die meine Großmutter durch den Krieg gerettet hatte und die damals schon hundert Jahre alt waren. Sie hießen Karl und Marie und Roland und Elisabeth – die Reihenfolge zwar wie gewöhnlich, aber es kommt doch wenigstens ein Mädchen im Titel vor. Bei Heidi und Alice im Wunderland wurde es dann noch besser.
Aber als ich acht war, brachte mein Bruder Karl-May-Bände mit nach Hause, die Schulfreunde ihm geliehen hatten. Ich durfte sie nach ihm lesen – noch mit zwölf schwärmte ich für den edlen mädchenhaften Winnetou.
Mein Bruder war es auch, der mich mit Mickymausund anderen Comic-Heften bekannt machte, wie Prinz Eisenherz, Tarzan und Fix und Foxi. Die Erwachsenen sahen unsere Begeisterung für die Comics nicht gern, sie fanden die Bildchen wohl nicht so bildend. Wirklich fatal ist natürlich, daß keine Frauen vorkommen, wenn doch mal, sind sie dumm und/oder hysterisch wie Daisy Duck oder später Miss Piggy. In der Sexta lieh mir eine Mitschülerin den ersten Pippi-Langstrumpf-Band, 1954 war das, ein kleines festes blaues Buch. »Pippi« erinnerte mich an Pipimachen, das war mir peinlich. Aber im übrigen fand ich Pippi toll und verschlang alle drei Bände.
Nesthäkchen, Trotzkopf und Pucki las ich nur selten, ab 13 dann sowieso lieber Dostojewsky und Thomas Wolfe; Der Idiot und Schau heimwärts, Engel haben mich tief erschüttert. Erst mit 15 entdeckte ich die wunderbare Welt der Literatur von Frauen und bin seither darin verblieben: Jane Austen, Katherine Mansfield, Virginia Woolf und Carson McCullers liebte ich so sehr, daß ich beschloß, Englisch zu studieren, was ich dann auch tat. In den 60er Jahren las ich gerne die Peanuts, und noch immer fiel mir zum Personal nichts auf, dabei gibt es bei den Peanuts an weiblichen Gestalten nur die Furie Lucy.
Fazit: Es gibt Mädchenbücher (Heidi, Nesthäkchen, Trotzkopf, Pucki), die kein Junge anrührt. Dann gibt es »Kinderbücher«, die meistens Jungenbücher sind, aber nicht so heißen. Sie werden Mädchen und Jungen angedient und von beiden konsumiert. Die Mädchen – und ihre Eltern! – merken in der Regel (so wie ich früher) gar nicht mal, daß sie im Dschungelbuch, bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn, in Entenhausen, bei Pu der Bär, den Peanuts, dem Herrn der Ringe, Asterix und Obelix, in der Muppet-Show, der Sesamstraße und jetzt in der Harry-Potter-Serie kaum vorkommen.
Und dann gibt es noch das Wunder Pippi Langstrumpf, ein Mädchen mit den Insignien der Männerherrschaft: Kraft, Reichtum, Unabhängigkeit. Sie hebt spielend ihr Pferd von der Veranda, bedient sich und andere reichlich aus ihrem Vorrat an Goldstücken, Eltern zum Dreinreden sind nicht vorhanden.
Die Kinderbuchautorinnen haben meist eine gemischte Kinderschar im Auge. Daß es auch Mädchen gibt, ist ihnen nicht entgangen, und sie versuchen dieser Tatsache gerecht zu werden, manchmal gar, dem Männlichkeitsdrall bewußt entgegenzusteuern und die hingebungsvollsten unter ihren LeserInnen mit einer weiblichen Heldin ganz gezielt aufzubauen, ihnen Identifikationsfiguren anzubieten, wie es heute heißt.
Bis auf die Ausnahmeerscheinung des mädchenliebenden Mathematikprofessors Dodgson alias Lewis Carroll (Alice im Wunderland) scheren sich männliche Autoren, angefangen bei Karl May über A. A. Milne, Tol kien, Disney und Charles M. Schulz bis hin zu den Franzosen Goscinny und Uderzo den Teufel um Mädchen; sie basteln unbeirrt an ihren männlichen Universen, in denen weibliche Menschen nichts zu suchen haben.
Daß auch J. K. Rowling mitbastelt, ist verdammt schade. Und daß Astrid Lindgren nicht mehr ist, ist ein ewiger Jammer. Aber wir haben ihre Werke. Und auch den Nils Holgersson ihrer großen Landsfrau Selma Lagerlöf (deren 150. Geburtstag wir nächstes Jahr um diese Zeit feiern). Was wäre der kleine Däumling ohne seine weise Beschützerin Akka von Kebnekajse, die Anführerin der Wildgänse?
Nachtrag: Meine Nichte, inzwischen 15, war verrückt nach Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg von Elfie Donnelly und den Wilden Hühnern von Cornelia Funke, bevor sie Harry Potter verfiel. Matrone hin oder her, ich muß jetzt endlich auch Donnelly und Funke hören, lesen und sehen! Sie scheinen würdige Nachfolgerinnen Astrid Lindgrens zu sein.
November 2007
Die Wohlgesinnten, die Ausgebufften und andere seltsame Titel
Am 22. Februar, dem Vorabend des Erscheinens der Wohlgesinnten, brachte 3sat Kulturzeit einen längeren Beitrag über den Schocker von Jonathan Littell. Ich hatte von dem Buch bis dahin nichts gehört, erfuhr nun aber, daß das französische Original ein rasender Bestseller sei und zudem den Prix Goncourt bekommen hätte.
Den Titel fand ich für die fiktiven Bekenntnisse eines Nazischergen etwas verschroben, dachte aber nicht weiter darüber nach. Es ging in dem Bericht auch hauptsächlich um die literarische Kontroverse, die das Buch in Deutschland schon vor seinem Erscheinen ausgelöst hatte: Haben wir es mit einem genialen Jahrhundertwerk oder mit einem mönströs mißlungenen Machwerk zu tun? Interessanterweise vertreten Männer überwiegend die These vom Geniestreich (Cohn-Bendit, Schirrmacher, Lanzmann, Semprun), Frauen wie z. B. Deutschlands bekannteste Literaturkritikerinnen Sigrid Löffler und Iris Radisch hingegen finden das Buch total mißlungen.
Ich kann zu der Debatte nichts beitragen, denn ich habe das Buch nicht gelesen, und wie ich mich kenne, werde ich es auch nicht lesen (wollen). Da vertraue ich gern dem Urteil der Expertinnen (»Landser-Kitsch«, »häufig ekelerregende, noch häufiger einfach langweilige Lektüre«). Und überhaupt: Es gibt so viele Bücher von Frauen, die ich noch nicht gelesen habe, Hedwig Dohm, Annette Pehnt, Julia Franck, Naomi Klein, Alice Rühle-Gerstel, Judith Thurman, Doris Lessing, Shere Hite – um nur acht von hunderten zu nennen.
Mir geht es heute um meine Erlebnisse mit dem seltsamen Titel des Littell-Buchs. Die Wohlgesinnten, dachte ich zunächst, das ist eine bitterironische Bezeichnung für die Nazimörder, die den »deutschen Volkskörper« wohlmeinend oder eben »wohlgesinnt« vom »jüdischen Ungeziefer« ein für alle Mal »befreien wollten«. Vage erinnerte mich der Titel auch an Goldhagens Buch Hitlers willige Vollstrecker (Hitler’s Willing Executioners).
Im Original hieße das Buch Les Bienveillantes, erfuhr ich dann und mußte meine Assoziationen revidieren, denn Bienveillantes ist ein Femininum. Ein weiblicher Titel für diese Nazi-Männer-Saga? Was mochte das bedeuten?
Ich las mich durch die entsprechenden Internetseiten und erfuhr, daß Die Wohlgesinnten auf den dritten Teil der Orestie des Aischylos anspielt, der bei uns Die Eumeniden heißt, auf französisch Les Euménides, auf englisch The Eumenides.
Warum also Jonathan Littell sein Buch Les Bienveillantes statt Les Euménides genannt hat, bleibt sein Geheimnis. Ich habe Latein und Griechisch studiert – mit Die Eumeniden hätte ich etwas anfangen können, Die Wohlgesinnten aber führte mich erst mal gründlich in die Irre. Vielleicht war das Absicht.
Littell gibt seinen ÜbersetzerInnen Ratschläge, wie sie den Titel am besten in all die Sprachen übersetzen sollten, in die sein Werk voraussichtlich übersetzt werden wird, wenn sich der Hype fortsetzt: Direkt aus dem Griechischen.
Die Eumeniden, zu Deutsch »Die Wohlmeinenden, Wohlgesinnten, Gnädiggestimmten« sind in der griechischen Mythologie ursprünglich Rachegöttinnen, Erinnyen oder Erinyen. Auf lateinisch furiae, die Furien.
Im dritten Teil der Orestie werden die Erinnyen, die zuvor Orest wegen des Mordes an seiner Mutter Klytaimnestra bis zum Wahnsinn verfolgten, von Göttin Athene umgestimmt; sie werden quasi domestiziert (hier könnten sich lange feministische Auslegungen der Mythologie anschließen). Die Umgestimmten und Umgepolten heißen nunmehr »Eumeniden« – aber wir durchschauen solche Augenwischerei und verstehen gemeinhin unter »Eumeniden« – Erinnyen, Rachegöttinnen, Furien.
In ihrem Verriß in der Zeit findet Iris Radisch kraftvolle Worte für die antike Verbrämung des Littell-Wälzers:
Veredelt wird der Edelnazi auch durch das intertextuelle Spiel des Romans mit der Orestie des Aischylos, das noch viele Doktorarbeiten alimentieren wird. Aue [so heißt der »Held« des Romans] als Orest, die beiden Polizisten, die Aue als Muttermörder überführen, in der Rolle der Erinnyen (auf Deutsch der »Wohlgesinnten«) … all dies sind hochkulturelle Köder, nach denen die Interpreten schnappen wie der Fisch nach dem Wurm an der Angel. … Den Täter … intellektuell und mythologisch aufzurüschen und gleichzeitig für unschuldig – im antiken Sinn schuldunfähig – zu erklären, das ist Legendenbildung.
An dieser Legendenbildung will ich mich nun nicht länger beteiligen, auch nicht länger nach den »hochkulturellen Ködern schnappen«.
Kommen wir zu ganz was anderem und doch ...