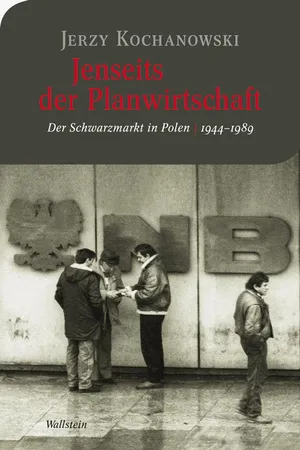![]()
1.Terminologische und methodologische Vorbemerkungen
»Während des Krieges war alles zu bekommen«, erinnerte sich der bekannte Maler Franciszek Starowieyski. »Als jedoch das sozialistische Durcheinander zu herrschen anfing, konnte man selbst Kleinigkeiten nicht mehr auftreiben. Und die Leute wussten sehr rasch um die verwüstende Kraft des Sozialismus. Der Witz: ›Was passiert in der Sahara, wenn die Sozialisten kommen?‹ – und die Antwort: ›Der Sand geht aus‹ – wurden im Jahre 1945 erfunden, als man sah, wie schnell mit dem Sozialismus alles zu bröckeln und zu verschwinden begann.«1 Das vorliegende Buch widmet sich den Versuchen der polnischen Gesellschaft der Nachkriegszeit, die »sozialistische Wüste« sowohl zu bewässern als auch möglichst hohe Erträge aus ihr herauszupressen. Bedenkt man, dass die meisten Oasen und Wasserreserven verstaatlicht worden waren, so mussten sich die gesellschaftlichen Akteure mit dem Staat auf ein kompliziertes Spiel einlassen, in dem gegen das geltende Recht gewöhnlich verstoßen wurde. Dies dauerte fast ein halbes Jahrhundert.
1.1. Welche Farben hatte der Schwarzmarkt?
Das Buch erhebt nicht den Anspruch auf eine wirtschaftliche, sozialwissenschaftliche oder anthropologische Analyse, sondern zielt auf eine eher interdisziplinär angelegte, jedoch betont geschichtswissenschaftliche Rekonstruktion verschiedener Verhaltensweisen, Mechanismen, Erscheinungen, Praktiken, Prozesse und Strategien unter dem gemeinsamen Nenner des Schwarzmarktes ab. Von vornherein sei hier unterstrichen, dass es sich dabei um außerordentlich heterogene und mehrdimensionale Mechanismen und Strategien handelt, die sich in Zeit und Raum wandeln und blitzartig auf die jeweiligen internen und externen Bedingungen reagieren; deren Akteure ihre eigene Sprache sowie ihr besonderes Wertesystem besitzen und in diesem Schwarzmarktspiel gezielt und ausschließlich auf Profit, mitunter notgedrungen und wider Willen setzen.2 Ähnlich wie im Falle jedweden Massenphänomens fehlt es auch in diesem nicht an Unklarheiten, Diskussionsthemen und Streitfragen, beginnend mit terminologischen und methodologischen Problemen. Auch diese bedürfen einer etwas weitläufigeren Erklärung.
Es gibt kein Land, in dem der Staat in der Lage wäre, eine völlige Kontrolle der Bürger auszuüben – das gilt auch für ihr Wirtschaftsleben. Ebenso besteht die Gesellschaft nirgends ausschließlich aus Individuen, die das gemeinsame Wohl dem eigenen vorzögen. Deshalb erinnert die Wirtschaft immer an einen Fluss, der an der Oberfläche und zugleich darunter fließt. Die Tiefe, die Kraft der Strömung, die Art des Flussbetts, die Fauna und Flora jener unterirdischen Wasserläufe (wenn man sich schon an diese fluviale Terminologie hält) sind von sehr zahlreichen Faktoren abhängig und sehen von Land zu Land anders aus, was den Forschern nicht wenig Probleme bereitet. Dies lässt sich sowohl an der Anzahl der Termini (Grauzone; Schatten-, Schwarz-, Untergrund-, Zweit- oder Parallelwirtschaft; verborgene, informelle, inoffizielle, geheime, unbeobachtbare, unregistrierbare bzw. unberechenbare Wirtschaft) als auch am Mangel an einer alle zufriedenstellenden Definition erkennen. Im Versuch, eine solche zu schaffen, bedienen sich einige moralischer Kategorien, während andere auf Kriterien der Rechtmäßigkeit, der Institutionalität, der Statistik (und insbesondere deren Erfassungsvermögen) oder schließlich der Ideologie zurückgreifen. Unabhängig von der Perspektive muss eine auf Gewinn ausgerichtete Produktions-, Handels- oder Dienstleistungstätigkeit (mit oder ohne Geld) existieren, die außerhalb der formalisierten Institutionen (und im Bewusstsein dessen, dass sie abseits der geltenden rechtlichen Bestimmungen stattfindet) ausgeübt wird und im Bruttosozialprodukt (BSP) nicht mit eingeschlossen ist.3
Überall begleitet die Grauzone unweigerlich die offizielle Wirtschaft. Sie zeichnet sich auch stets durch ihre oftmals geradezu endemischen Eigenschaften aus, die u. a. mit der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Struktur, den Traditionen, dem Rechtssystem zusammenhängen. Man kann jedoch annehmen, dass sie in Ländern mit fest verankertem und entwickeltem Freihandelssystem vor allem auf Steuerhinterziehung und Nutzung der Schwarzarbeit beruht. Eine andere Frage stellt sich bei kriminellen Aktivitäten im engeren Sinne – Drogen-, Menschen-, Waffenhandel, Handel mit Spaltprodukten, Kuppelei. Gerade diese sorgen für Schlagzeilen und bringen enorme Gewinne, doch andererseits haben sie nur geringen Einfluss auf den Alltag des Durchschnittsbürgers – ob Franzose, Deutscher oder Finne.
In den Volksdemokratien, sei es in Polen, der Sowjetunion oder Rumänien, kümmerte sich der Mann auf der Straße ebenfalls nicht so sehr um den Schwarzmarkt für Uran oder für Panzer, sondern es ging ihm vielmehr darum, wie und wo Schuhe, Benzin, Möbel und Kochtöpfe aufzutreiben waren und womit man Letztere füllen könnte. Der Besitz von Geld gewährleistete nämlich nicht so sehr die Befriedigung des Konsumbedarfs, als oft nur das Anrecht, einen Platz in der Warteschlange einzunehmen, ohne Garantie dafür, dass man nicht bloß das erträumte, sondern gar irgendein Produkt erhalten würde. Die Aufgabe dieser Arbeit liegt jedoch nicht darin, offene Türen einzurennen und zu entdecken, dass die sozialistischen Volkswirtschaften durch mehr oder minder chronische Engpässe gekennzeichnet waren. Zu diesem Thema wurde bereits viel geschrieben, darunter das klassische, doch durchaus nicht unumstrittene Werk János Kornais.4 Für unsere Überlegungen sind nicht die Prozesse der Entstehung von Engpässen wesentlich, sondern die Art, wie diese gemildert wurden. Dazu gab es zwei Wege: entweder die Rationierung der Güter und Dienstleistungen durch den Staat, oder die Übernahme der (Re-)Distributionspflicht durch die Gesellschaft. Aus der Perspektive des totalitären bzw. autoritären kommunistischen Staates kam eine solche Wahl nicht in Frage, und das liberale Schlagwort: »Was nicht verboten ist, ist erlaubt«, wurde grundsätzlich durch die klare Weisung ersetzt: »Was nicht ausdrücklich verordnet wird, ist verboten«.5
Gleichzeitig aber akzeptierten die Gesellschaften dieses wirtschaftliche Diktat in der Regel nicht und verbesserten andauernd ihre Anpassungsstrategien, zumal da, wo die Engpässe besonders spürbar waren. Indem man gewöhnlich die sprichwörtliche »Hintertür« benutzte, wurde der staatliche Sektor dräniert; es entwickelten sich soziale Netzwerke, die auf gegenseitige (durchaus nicht selbstlose) Hilfe beim Erwerb von mangelnden Gütern und Dienstleistungen eingestellt waren. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass die witzige polnische Bezeichnung der größtmöglichen Strafe – »zwei Jahre ohne gute Beziehungen« – in wohl jedem sozialistischen Land ihr Pendant hatte (in der UdSSR hieß es, »Blat ist stärker als Stalin«6). Der Strudel der zweiten Wirtschaft saugte die Reserven der ersten aus, wobei er die Engpässe reproduzierte und zu einer Verstärkung verschiedenartiger informeller Aktivitäten führte.7 Dieser Teufelskreis bewirkte in den sozialistischen Ländern nicht nur die Entstehung einer zweiten Wirtschaft, sondern die Schaffung einer »zweiten Gesellschaft«8 mit ihren eigenen ethischen Grundsätzen, Zielen, Mustern und Mentalitäten. Am sichtbarsten war sie unter dem Blickwinkel der Wirtschaft.
Wenn die Wirtschaft fast zur Gänze dem Staat nicht nur untersteht, sondern ihm gehört, dann kann man auf die »Untergrundwirtschaft« nur schwer das Adjektiv »parallel« anwenden. Parallelität setzt ja Unabhängigkeit voraus, diese war jedoch auf keinen Fall ein Merkmal der sozialistischen second economy. Die – vor allem schmarotzerhaften – Beziehungen waren allerdings ungemein eng. Die offizielle Sphäre war es, die als Geld-, Rohstoff- oder Fertigerzeugnisquelle für private – legale und illegale – Handwerker und Kaufleute bzw. (ausschließlich illegale) Schmuggler fungierte; Privathäuser entstanden aus staatlichen Ziegelsteinen und staatlichem Zement, Autos fuhren mit staatlichem Benzin.9 Andererseits war aber eine eigenartige Symbiose beobachtbar. Die staatlichen Betriebe konnten nicht arbeiten (und auch den Plan nicht erfüllen), ohne auf Strategien aus der Grauzone zurückzugreifen, sowohl in den Kontakten zu staatlichen Partnern als auch zu privaten. Oft reichten sie in ihrer Tätigkeit bewusst bis an die Grenzen des Rechts (wobei diese übrigens manchmal überschritten wurden), da die Fabrik ohne die sprichwörtlichen Schräubchen, die von tüchtigen Handwerkern geliefert wurden, nicht hätte funktionieren können. Ebenso bemühte man sich, keine unnötigen Fragen u. a. zur Herkunft des für die Produktion des Einzelhandels benutzten Stahls zu stellen. In einer solchen Situation ist die auf Marktwirtschaften angewendete Farbpalette zur Bezeichnung derer informeller Verästelungen (von grau bis schwarz) entschieden unzureichend. Es mag auch nicht verwundern, dass die Spezialisten, die sich mit der sozialistischen Zweitwirtschaft befassen, sie beträchtlich erweitert haben. Das nachstehende Modell wurde zwar für die Sowjetunion erarbeitet, doch bezieht es sich ebenfalls in nicht geringem Maße auf andere Staaten des Ostblocks (nicht nur in Europa).10
Legale Märkte
Beim nicht ohne Grund als rot bezeichneten Markt handelte es sich in Wirklichkeit um die wenig effiziente und kaum reaktionsfähige staatliche Distribution. Unterstützt wurde sie vom rosa Markt, auf dem private, sich in rechtmäßigem Besitz befindende Güter getauscht wurden. Der Staat hatte nämlich ein Vertriebsnetz von Kommissionsgeschäften (skupočniye) gegründet, durch welche zu Preisen, die diejenigen des Detailhandels nicht überschritten, Kleidung, Bücher, Möbel usw. verkauft werden konnten. Die Kommissionsläden zählten zu den wenigen Stellen, wo noch residual Verhaltensweisen aus der Marktwirtschaft anzutreffen waren; Preise z. B. konnten ausgehandelt und im Falle unverkaufter Ware herabgesetzt werden. Dieser skupočniye gab es jedoch nicht viele und sie hatten nur einen geringen Einfluss auf den Markt.
Eine bedeutendere Rolle spielten die sog. weißen Märkte, sowohl die städtischen, wo man Gebrauchtes (d. h. die oft aufgrund eines sehr freien Umgangs mit dem Begriff »gebraucht« liquidierten baracholka11) verkaufen konnte, als auch diejenigen der Kolchose, auf denen Nahrungsmittel im Umlauf waren. Auf beiden wurden die Preise nicht von oben geregelt; nur in Zeiten besonders schwieriger Engpässe in der Versorgung wurden – selten eingehaltene – Maximalpreise eingeführt.
Halblegale Märkte
Zum grauen Markt zählte man die Vermietung von Wohnungen oder Datschen für die Urlaubszeit sowie Dienstleistungen (insbesondere die Instandsetzung von Wohnungen, Autoreparationen, Schuster- bzw. Schneiderhandwerk, die nach Feierabend – und manchmal während der Arbeitszeit – von sog. šabašniki12 realisiert wurden), aber auch Einkünfte aus Nachhilfeunterrichtsstunden oder ärztlicher Beratungstätigkeit. Auf dieser Grauskala befand sich zudem der nicht gerade legale, doch allgemein akzeptierte Tauschhandel zwischen den Betrieben, ohne welchen sich die Planerfüllung oft als unmöglich erwies. Die Erscheinungen des grauen Marktes betrachtete die Behörde gewöhnlich mit Nachsicht, vor allem da, wo die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen unzureichend war.
Illegale Märkte
Der braune Markt beschäftigte sich zuallererst mit Gütern, die theoretisch auf dem roten Markt erhältlich waren, an denen es jedoch in Wirklichkeit chronisch mangelte. Die Nachfrage übertraf das Angebot an Fleisch, Molkereiprodukten, Kleidung, Kühlschränken, mechanischen Geräten, Personenwagen, Baumaterial, was dazu führte, für diese Produkte breitgefächerte Distributionsmöglichkeiten durch die sog. Hintertür zu entwickeln. An diesem zwielichtigen Gewerbe waren sowohl Hersteller als auch Arbeiter der (Groß-)Handelszentralen, Lagerarbeiter und Transportbegleiter, Fahrer und Verkäufer beteiligt. In diesem Fall ging es eher um den Aufbau eines sozialen Kapitals, in der Hoffnung auf »Gegenleistungen« in einem anderen, genauso defizitären Gebiet. Ein eigenes Segment auf dem braunen Markt stellten die importierten Luxuswaren (aus sowjetischer Perspektive) dar, insbesondere Kleidung, in den achtziger Jahren u. a. Videokassetten oder gar Autos, die in nicht geringen Mengen von Seeleuten, Sportlern und Künstlern (oft legal) eingeführt wurden. Theoretisch hätten sie durch das dünne Netz der Kommissionsläden verteilt werden sollen, wodurch sie allerdings dauerhafte Spuren hinterließen (man war verpflichtet, sich dabei auszuweisen). Deshalb bemühte man sich ebenso, weniger auffällige (aber auch weniger formelle) Vertriebswege zu erschließen.
Auf der anderen Seite zogen die Unternehmen vom braunen Markt Vorteile. Die Führung der Kolchose zum Beispiel, die ständig mit dem Mangel an Ersatzteilen zu kämpfen hatte, verfügte über einen Geheimfonds und erlangte sie auf informellem Wege, indem diese im Rahmen einer inoffiziellen Nebentätigkeit von Fabrikarbeitern verfertigt oder gestohlen wurden usw.
Waren die Teilnehmer des braunen Marktes – wenn auch nicht immer – toleriert, so galten die Personen, die auf dem schwarzen Markt engagiert waren, sowohl für den Staat als auch in breiten Teilen der Gesellschaft als Straftäter. Zu den Erscheinungen des schwarzen Marktes zählte man das Anzapfen des roten Marktes zur Gewinnerzielung (Diebstahl in Geschäfte...