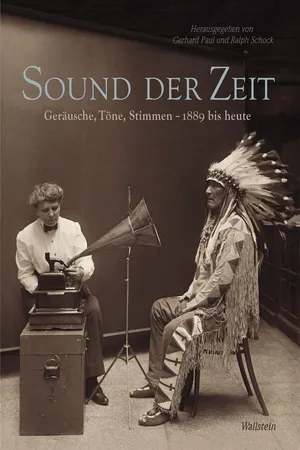![]() 1949 bis 1989
1949 bis 1989![]()
Soundrevolutionen und Ätherkrieg
Klanglandschaften einer gespaltenen Welt
Die Zeit zwischen der »doppelten« deutschen Staatsgründung 1949 und dem Fall der Berliner Mauer 1989 war geprägt von einer doppelten Spaltung: einer politischen Aufspaltung der Welt in Ost und West und einer generationsmäßigen Spaltung der Gesellschaft in eine Kriegs- und eine Nachkriegsgeneration. Die akustischen Spuren dieser doppelten Spaltung bestimmten die akustische Grundsignatur dieser Jahre. Hinzu kamen die Auswirkungen einer doppelten Soundrevolution, die um 1960 einsetzte und das Dezennium bis 1970 nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und Nordamerika zum lautesten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts werden ließ, so R. Murray Schafer. Diese Spuren setzten sich zusammen aus dem ungefilterten und weitgehend ungebremsten Lärm der großen Städte und der neuen Düsenflugzeuge und aus dem lärmenden Sound des musikalischen Aufbruchs. Die Zeitgenossen nahmen diese Revolutionen abhängig von ihrer generationellen Zugehörigkeit weitgehend positiv wahr.
So wie für die Menschen des 19. Jahrhunderts die rauchenden Schlote der Fabriken Zeichen des Fortschritts waren, sah die Kriegsgeneration die Lärmkulisse der expandierenden Großstädte und der Flughäfen als akustisches Synonym des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs. Für die Jüngeren bedeutete die elektronisch verstärkte Rock- und Beatmusik den Ausbruch aus der miefigen und sentimentalen Welt der Erwachsenen. Die Revolte von ’68 hatte ein musikalisches Vorspiel.
Begleitet wurden beide Soundrevolutionen im Alltag vom allmählichen Verschwinden hergebrachter Klänge: etwa des Ausrufers, der mit seiner Schelle durch das Dorf zog und Bekanntmachungen verkündete, des Straßenbahnschaffners, der die nächste Station ausrief, aber auch der mehrstimmigen Ladentürglocken und der mechanischen Registrierkassen in den »Tante-Emma-Läden«, die rasch von den elektrischen Kassen der mit Muzak beschallten Selbstbedienungsläden und Supermärkte verdrängt wurden. In den 1960er Jahren verklang dann auch – im Westen früher, im Osten später – das schwere Schnauben der Dampflokomotiven; es hielt sich lediglich in nostalgischen Eisenbahnfahrten oder wurde kultiviert in Arthur Honeggers sinfonischem Satz Pacific 231.
Der Lärmpegel in den deutschen Großstädten verdoppelte sich in den 1960er Jahren. Man riss ab und baute neu ohne jede Rücksicht auf die Ruhebedürfnisse der Bewohner. Autobahnen und Schnellstraßen wurden ohne irgendwelche Skrupel durch dicht bevölkerte Wohngebiete geführt. Zum Symbol des Baulärms geriet der Presslufthammer, festgehalten 1973 in dem Kinderbuch Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder. Neben dem Baulärm war es vor allem der Lärm des rasch zunehmenden Individualverkehrs, der sich über die Stadtlandschaften der Wirtschaftswunderzeit legte. Die Automobilkonzerne warben in jenen Jahren geradezu mit erhöhtem Motorenlärm, gleichsam als akustischem Synonym für (männliche) Potenz. Um im Großstadtgetümmel Gehör zu finden, benötigte eine Polizeisirene im Jahr 1912 eine Lautstärke von 88 Dezibel (dB), jetzt bedurfte es Lautstärken von weit über 100 dB.
Hinzu kam der sich ausbreitende Fluglärm. Wie Straßen wurden auch Flughäfen und Einflugschneisen ohne Abstimmung mit der Bevölkerung geplant. Den meisten Lärm verursachten seit 1960 allerdings die neuen Düsenjets, welche ein Vielfaches lauter waren als die alten Propellerflugzeuge. Ein startender Düsenjet brachte es auf 120 dB und mehr. Der Fluglärm breitete sich über das ganze Land aus, er war nicht mehr nur auf die Nähe von Flughäfen eingegrenzt. Der Himmel, so Schafer, wurde zur akustischen »Kloake«.
Verstärkt wurde der Alltagslärm durch den politischen Sound des Kalten Krieges: durch regelmäßige Probealarme, die die Bürger beständig an die Möglichkeiten eines neuen Weltkriegs erinnerten, und den Knall der Kampfjets, die über dicht besiedelten Wohngebieten die Schallmauer durchbrachen, sodass in den Küchenschränken die Gläser zitterten und nicht selten Fensterscheiben zersprangen.
Ähnliches geschah im östlichen Teil Deutschlands, in dem das Militär genauso wenig Rücksicht auf die Bewohner nahm wie im Westen. Indes entwickelten sich die Bundesrepublik und die DDR unter Lärmaspekten in entgegengesetzte Richtungen. Wurde die alte Bundesrepublik aufgrund des Wirtschafts- und Baubooms immer lauter, blieb die DDR politisch wie soundgeschichtlich ein vergleichsweise stilles Land, geprägt vom Klang der Zweitakter und Krafträder, den verordneten Sprechchören und den im Stechschritt marschierenden Soldaten. Todesstill war es am Grenzstreifen in der Mitte Deutschlands, wo nur ab und zu Minen explodierten oder auf Flüchtende gefeuert wurde.
Ein hörbarer Ausdruck der Teilung Deutschlands waren die unterschiedlichen Hymnen. 1945 hatten die Alliierten das Deutschlandlied zunächst verboten, dessen erste Strophe ja die Nazis als »Vorspiel« des Horst-Wessel-Lieds gesungen hatten. Der Versuch des Bundespräsidenten, eine neue Hymne einzuführen, traf auf breite Ablehnung der Bevölkerung. Von »Hymnenstreit« war die Rede, bis Kanzler Adenauer ein Machtwort sprach und auf der Beibehaltung des Deutschlandlieds als akustischem Identitätszeichen der neuen Republik bestand. In den 1950er und 1960er Jahren wurde es indes außer bei großen Sportveranstaltungen nur selten gespielt und noch seltener gesungen. Erst in den 1980er Jahren beschloss es in einer Instrumentalversion das Sendeprogramm des Fernsehens.
Die Hymne der DDR war seit 1949 Auferstanden aus Ruinen von Hanns Eisler und Johannes R. Becher. Sie gehörte zum Alltag der DDR-Bürger, war aber trotz ihres »würdigen und menschlichen« Klangs nicht wirklich populär. Im Westen wurde sie als »Spalter-Hymne« verspottet. Nur eine Episode blieb bei den Olympischen Spielen von 1956 bis 1968 das Abspielen des Liedes Freude, schöner Götterfunken aus dem Finalsatz von Beethovens 9. Sinfonie als gemeinsamer Hymne der deutschen Sportler.
Von Anbeginn an tobte ein zum Teil heftig geführter Ätherkrieg zwischen West und Ost. Auf die Propagandasendungen des amerikanischen RIAS in Westberlin antwortete der Berliner Rundfunk im Ostteil der Stadt mit ähnlichen Kampagnen. Auf frühen DDR-Plakaten wurde das RIAS-Programm als eine Mischung aus »1. Lüge und Hetze 2. Mord- und Sabotageanweisungen 3. Amerikanische Boogi-Woogi-›Kultur‹« diffamiert. Namenlose Stör- und Propagandasender wie der Deutsche Freiheitssender 904 der DDR wurden eingerichtet, um die Sendungen der anderen Seite zu stören bzw. zu beantworten. Nach dem Bau der Mauer eskalierte der Ätherkrieg in einem Lautsprecherkrieg unmittelbar an der Sektorengrenze. Den riesigen Lautsprechern des West-Berliner Studios am Stacheldraht standen auf östlicher Seite Lautsprecherwagen der Nationalen Volksarmee gegenüber. Es blieb – glücklicherweise – beim Gefecht der Worte.
Zu den bekanntesten Stimmen des televisuellen Ätherkriegs wurden Karl-Eduard von Schnitzler, einst Kommentator des NWDR in Köln und nun Chefkommentator des DDR-Fernsehens, der den schwarzen Kanal mit seinem unverkennbaren akustischen Intro moderierte, und der rechtskonservative ehemalige RIAS-Journalist Gerhard Löwenthal, der das Deutschland-Magazin des ZDF leitete. Aber auch mit anderen Nachrichten- und Magazinsendungen unterhöhlte der Westen über vier Jahrzehnte die Autorität der DDR-Staatsführung, bis der andere deutsche Staat schließlich im November 1989 auch durch die mediale Schützenhilfe des Westens implodierte.
Auf musikalischer Ebene setzten sich Spaltung und Soundkrieg ebenfalls fort. Während im Westen die Jugend zu wilden Rock- und Beatrhythmen tanzte, waren diese in der DDR verpönt, galten sie doch als »Waffe« des Klassenfeinds. Nach Erich Honecker nutzte der Westen die Beatmusik, »um durch die Übersteigerung der Beatrhythmen Jugendliche zu Exzessen aufzuputschen«. Um dem schleichenden Siegeszug von Rock und Beat unter DDR-Jugendlichen Einhalt zu gebieten, gründete man mit mäßigem Erfolg eigene Rock- und Beatformationen, was indes nicht verhinderte, dass »westliche« Musiksendungen weiterhin mitgeschnitten und West-LPs und -Singles unter der Hand vertrieben wurden. In den 1980er Jahren weichten die Fronten auf. Davon zeugte nicht zuletzt der Auftritt Udo Lindenbergs im Ost-Berliner Palast der Republik.
Trotz vorsichtiger Annäherungen blieben die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten geprägt von einem tiefen gegenseitigen Misstrauen und von der Furcht vor Agenten der jeweils anderen Seite. Dies hatte weitreichende Auswirkungen. Mit riesigen Lauschapparaturen, sogenannten Horchposten, überwachten die beiden Seiten gegenseitig ihre Kommunikation. Der amerikanischen Anlage auf der Wasserkuppe im hessischen Teil der Rhön stand der Abhörkomplex der Stasi auf der Kuppe des Ellenbogens im thüringischen Teil gegenüber; ähnliche Anlagen gab es auf dem Brocken im Harz und in und um Berlin, von denen die auf dem Teufelsberg die bekannteste war. Abgehört und bespitzelt wurden aber auch die tatsächlichen oder vermeintlichen Gegner im Innern durch sogenannte Lauschangriffe. Auf beiden Seiten des »Eisernen Vorhangs« wurden Abhöranlagen in einem Umfang und in einer Qualität installiert, von denen die Gestapo nur geträumt hätte. Akustisch waren die häuslichen vier Wände durchlässig geworden.
Mediengeschichtlich setzte sich in den 1950er Jahren das Radio als wichtigstes technisches Medium durch. Es bestimmte den häuslichen Alltag und war das Zentrum familiärer Geselligkeit. Die durchschnittliche Hördauer lag bei täglich knapp drei Stunden. Musikalisch beherrschte der sentimentale deutschsprachige Schlager mit seinen eskapistischen Tendenzen das Programm. Eine starke Abwehrhaltung der Zuhörer bestand weiterhin gegenüber der Neuen Musik und dem Jazz, der oftmals noch immer als »jüdische Musik« bezeichnet wurde. Große Radioereignisse der Zeit waren die Fußballweltmeisterschaft von 1954 und die Kubakrise von 1962, als die Deutschen regelrecht an den Lautsprechern klebten, um die neuesten Ergebnisse und Nachrichten zu verfolgen.
Bereits Ende der 1950er Jahre bekam das Radio Konkurrenz durch die rasche Ausbreitung des Fernsehens und des Plattenspielers, der ab 1968 auch stereo abspielbar war. 1964 verfügten bereits 55 % aller Haushalte über ein Fernsehgerät, 1970 85 %. Zugleich besaßen 95 % der Haushalte weiterhin mindestens ein Radiogerät. Der Rundfunk büßte durch diese Konkurrenz nicht seine bisherige Funktion ein. Vielmehr operierte er im häuslichen Alltag nun im Verbund mit Fernsehapparat und Plattenspieler. Sichtbarer Ausdruck dessen war die Fernseh- bzw. Musiktruhe, ein Hybridmöbel, auf das die Deutschen optisch wie akustisch ihre Wohnzimmer ausrichteten. Das öffentliche Pendant zur heimischen Truhe war in Kneipen und Eiscafés die Jukebox. Populär wurde sie bereits in den 1950er Jahren durch in Deutschland stationierte US-Soldaten. Ihren Durchbruch verdankte sie populären Interpreten des Rock ’n’ Roll wie Bill Haley und Elvis Presley. Überhaupt brachten die 1950er Jahre eine bis dahin unbekannte Internationalisierung der Musik mit sich. Gleichsam zum akustischen Erkennungszeichen dieser Entwicklung wurden die Intros der großen amerikanischen Filmgesellschaften.
Konkurrenz erwuchs den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern zunehmend auch durch ausländische Sender, vor allem durch Radio Luxemburg und die Soldatensender AFN und BFBS, später durch Lokalradios und Piratensender. Die ARD-Sender reagierten auf diese Konkurrenz mit einem Modernisierungsschub: mit neuen Magazinsendungen, mit der Verjüngung der Unterhaltungsmusik, mit Hitparaden, mit unzähligen Infoprogrammen und anderem. Zugleich veränderte sich – wissenschaftlich nachweisbar – seit Mitte der 1960er Jahre der Klang der Radiostimmen. Die Sprechgeschwindigkeit wurde immer schneller und die Sprechpausen wurden immer kürzer, sodass man als Hörer kaum mehr zum Nachdenken kam und sich mitunter »zugequatscht« fühlte. Betrug die durchschnittliche Sprechgeschwindigkeit in den 1930er / 40er Jahren im Radio noch 4,5 Silben pro Sekunde, lag sie im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bereits bei 5,34 Silben pro Sekunde bei gleichzeitiger Verkürzung der Pausenzeitanteile. Positiv indes: Nachdem jahrzehntelang männliche Sprecher Rundfunk und Fernsehen akustisch dominiert hatten, waren nun immer öfter auch weibliche Stimmen zu hören.
Einen Aufschwung erlebte das Radio durch die Rundfunkindustrie, die ab den 1950er Jahren, wie zuvor schon in den USA, Koffer- und Transistorradios auf den Markt brachte und damit die Attraktivität des Mediums Radio gerade bei den Jüngeren erhöhte. Die Portables, wie sie in den USA hießen, waren das mediale Äquivalent zur mobilen Gesellschaft. Durch sie wurden die Klänge mobil, bekamen die Töne Beine, wie es ein Zeitgenosse formulierte. Radiohören war nicht mehr an einen Ort gebunden, es war nun auch unterwegs möglich, im Garten, im Schwimmbad und im Auto. Ein Portable zu besitzen war für Jugendliche auch deshalb erstrebenswert, weil dann nicht länger das Familienoberhaupt entscheiden konnte, was und wann gehört wurde. Portables bedeuteten ein Stück Unabhängigkeit und Freiheit. Zu Beginn der 1960er Jahre kamen dann die ersten, mit Transistoren bestückten Autoradios auf den Markt. Allerdings sollte es noch zehn Jahre dauern, bis sich die Sender mit dem Verkehrsfunk auf die neuen automobilen Möglichkeiten eingestellt hatten. Vorre...