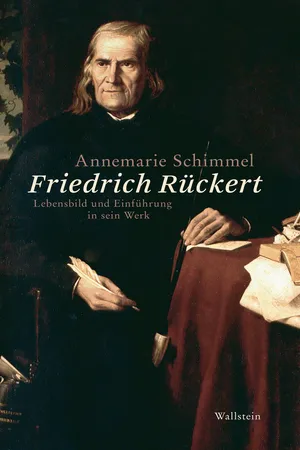![]()
Das Werk des gelehrten Dichters
Was mir den Busen bewegt am tiefsten: hier die Gesänge,
Da das gelehrte Gebiet, das unendliche; dort der geliebten
Heimat steigende bald, bald sinkende Hoffnungen: …
So hat Rückert die drei Kreise seiner Interessen beschrieben, die in gewisser Weise nahtlos ineinandergreifen. Denn sie umschließen die von Goethe 1827 in einem Brief an Carlyle ausgedrückte Idee der Weltliteratur, die durch die deutsche Sprache verwirklicht werden könne:
»… Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Völkerschaften auf sich beruhen läßt, bei der Überzeugung jedoch festhält, daß das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit angehört. Zu einer solchen Vermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon bei. Wer die deutsche Sprache studiert und versteht, befindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waren anbieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.«
Man wird daher mit Herman Kreyenborg übereinstimmen, der 1923 fragte (und heute vielleicht mit noch mehr Recht fragen könnte): »Wieviele Deutsche … ahnen heute, daß eine erschöpfende Gesamtausgabe der Meisterübersetzungen Rückerts einen Thesaurus der Weltliteratur in deutscher Sprache darstellen würde, der die kühnsten Träume eines Herder und Goethe an Vielseitigkeit und Meisterschaft überstiege, ein Orient und Okzident in umfassendstem Maße vereinigender literarischer Riesenschatz, wie ihn keine andere Nation der Erde aufzuweisen hat?«
Die Idee der Weltliteratur, erstmals von Herder erträumt, stand in Rückerts Leben seit früher Zeit im Mittelpunkt, hatte er ja schon in seiner Jenaer Dissertation von 1811 die These aufgestellt, daß »unsere Sprache versuche, durch Zusammenziehung aller jener Formen [fremder Idiome] in eine einzige sich als universellste Form der Sprache, als wahrhaft ideale Sprache auszubilden«.
Was mich erfreut, entzückt, das ist die Sprach’ an sich,
schrieb er später in einem Gedicht in der »Weisheit des Brahmanen«, das dann doch wieder im Lob der Muttersprache endet:
Drum ist die schönste Sprach’ und beste, die du nennst,
Die Muttersprache, weil du sie am besten kennst.
Niemand hat Rückerts Begabung besser beschrieben als Theodor Benfey in seiner »Geschichte der Sprachwissenschaft«. Er lobt darin »sein wunderbar großes und eigentümliches Sprachtalent, welches ihn befähigte, alle Töne des dichterischen Triebes der gebildeten Völker, insbesondere der orientalischen, in einem Umfang und in einer Meisterschaft widerklingen zu lassen, wie sie bis auf ihn nie hervorgetreten war. Rückert hatte einen Sprachsinn, in welchem das rezeptive Moment, wie es dem Sprachgelehrten in einem mehr oder minder hohen Grade notwendig ist, auf das innigste mit dem schöpferischen verbunden ist, wie es bei dem großen Dichter und Denker hervortritt; ja gerade letzteres war ihm in einem so hohen Maße zuteilgeworden, daß man fast berechtigt ist, zu behaupten, wenn die Sprache noch nicht existiert hätte, würde Rückert einen sehr wesentlichen Teil zur Schöpfung derselben beigetragen haben. Seinem Hauptcharakter nach darf man ihn, wie mir scheint, als ein großartiges, aber höchst eigentümliches Sprachgenie bezeichnen. Er hatte ein wunderbares Gefühl dafür, wie die Dinge in Worten auszudrücken sind, und zwar nicht bloß in geistiger, sondern auch in materieller Beziehung. Allein seine Dichtung rang weniger nach Vertiefung in die Dinge, als nach einem anschaulichen Ausdruck derselben. Man kann – wenn auch mit einiger Übertreibung – fast sagen, daß die Dinge für ihn nicht selbständig existierten, sondern nur in den Worten, in denen sie zu sprachlichem Leben gelangen, zu Elementen der Sprache werden; sie hatten einen überragenden Wert für ihn in ihrer sprachlichen Seite; in ihrer Selbständigkeit waren sie ihm mehr oder weniger unzugänglich. Darum ist er als Dichter mehr redselig und malerisch als tief und konzis, mehr im besten Sinne des Wortes nachbildend als selbständig schaffend. Dadurch aber war er von der Natur in hervorragender Weise gerade zum wunderbaren Übersetzer und selbst ausgezeichneten Interpreten ausgestattet.«
Rückerts von Benfey so fein charakterisiertes »eigentümliches Sprachgenie« zeigt sich auch in seiner Art des Sprachenlernens und seiner Ablehnung einer gewissen Art trockener Philologie – so, wie er erschrocken-bewundernd an den Sanskritisten Franz Bopp schreibt, daß er mit dessen Arbeiten über Pronominalstämme nichts anfangen könne, »weil man sich nichts dabei phantasieren kann«. Und im Dezember 1857 bekennt er: »Mir am begreiflichsten ist bei meinem des Abstrakten ungewohnten Denken … die Parallele der ursprünglichen Sprachentwicklung mit der fortwährenden in unseren Kindern.« Dem entsprach auch seine Weise des Dozierens, die Paul de Lagarde als ein Vorleben, ein Verstehen vor den Augen der Hörer beschrieben hat; »an den Krücken schlechter Wörterbücher und noch schlechterer Grammatiken« schleppte man sich sonst durch die Sprachen dahin, aber »Rückert ging mit ihnen um wie mit Freunden«. Und der Schüler fand, »wie fein das Gefühl für die Sprache ausgebildet werden kann, wie sicher das Rechte trifft, wer dem fremden Volksgeiste nicht mit einer fertigen Kategorientafel, zu der Beispiele gesammelt werden müssen, sondern mit dem demütigen Wunsch entgegentritt, zu lernen, was jener, der Herr in seinem Hause ist, zu sagen hat.« Es ist eben dieses Gefühl, das Rückert in seinem Gedicht:
Wenn dir nicht deine Toten leben …
ausgedrückt hat:
Dir werden leben von den Toten
So viele, wie dein Herz beleben,
Die Dichter, Weisen aller Zeiten
Erheben sich, dich zu erheben …
Sie alle – Araber, Perser, Inder, Griechen – waren seine Geistesfreunde, und so lernte er dankbar, gewissermaßen durch direkten Kontakt mit ihnen. Deshalb meinte Lagarde, daß Rückerts Unterricht nicht »mit gelehrtem Kram« befrachtet gewesen sei, sondern »so lernen wohl Kinder sprechen und sich benehmen«; und genau das hatte der Dichter selbst schon früh poetisch am Ende der Rumi-Ghaselen zugegeben:
Manches hab’ ich nicht verstanden, was ich wagte nachzulallen;
Also singen dir zum Preise Unverstandnes Nachtigallen,
Also lernen Kinder sprechen, welche lieb dir sind vor allen.
Und aus eben diesem Gefühl, daß man sich ganz in die Seele der anderen Sprache hineindenken und sie sich gewissermaßen durch Osmose aneignen müsse, stammt sein Vers, der jedem Nur-Schulphilologen Schauder einjagen würde:
Der Übersetzung Kunst, die höchste, dahin geht,
Zu übersetzen recht, was man nicht recht versteht.
Deshalb hält er es auch, in der »Weisheit des Brahmanen«, für »des Schrifterklärers Fluch«, alles erklären und analysieren zu wollen:
Denn was dir Einzelnes geblieben unverständlich
Aus dem Zusammenhang verstehst du es doch endlich.
Das eigentliche Paradox des Wortes ist, daß es,
Je mehr du es verstehst, je minder übersetzlich,
Ist, sich dem nur rationalen Zugriff entzieht und dem intuitiven Verstehen öffnet.
Es war das »orientalische Studium« in Wien, das, obgleich nur wenige Wochen während, Rückerts eigentliche Begabung deutlich werden ließ, jene Begabung, auch die Äußerungen fernster Geistesverwandter im Deutschen »ästhetisch wiederzugebären«. Schon im Dezember 1819 schrieb er an Joseph von Hammer: »Da Sie so viel schreiben und sich Ihrer Sachen nicht so genau besinnen können, so wird es Ihnen, wenn Sie das Goethesche Buch gelesen, schwerlich aufgefallen sein, wie viele Zeilen und Halbzeilen der alte Herr aus Ihrem Hafis wörtlich beibehalten hat. Noch viel ärger denke ich es damit zu machen. Eh ich ihn kriegte, saß ich über der Geschichte der schönen Redekünste und stahl ganz über die Maßen unverschämt aus den Versen und aus der Prosa und machte aus beiden Verse mit eigener Zutat. Als der Hafis kam, wollte ich nur einige Stückchen herausreißen, aber es ward immer mehr und mehr, anfangs mehr auf die Gedanken und innere Poesie angelegt, zuletzt auf Nachbildung der Form. Nun habe ich wirklich ein gut Teil deutsche Ghasel elaboriert …« Wenn Rückert dann in seinem fast gleichzeitigen Brief an seinen Verleger Cotta meint, daß man sich, wenn man Hammers Masse, Goethes Inhalt und seine Form zusammennähme, wohl eine Vorstellung von persischer Poesie machen könne, so ist das völlig richtig: die Bildersprache des Hafis, des größten, 1389 in Schiras verstorbenen persischen Lyrikers, dessen Sprachkunst immer für unübertrefflich gegolten hat, ist mit unnachahmlicher Leichtigkeit ins Deutsche übertragen, so fremd manche Ausdrücke dem deutschen Leser wohl auch vorgekommen sein mögen. Das schönste der Gedichte aus der Rückertschen Sammlung, die im Sommer 1821 als »Östliche Rosen« veröffentlicht wurde, spiegelt den Geist der persischen Poesie getreuer wider als irgendein anderes mir bekanntes Gedicht oder eine gelehrte Abhandlung:
Was steht denn auf den hundert Blättern
Der Rose all?
Was sagt denn tausendfaches Schmettern
Der Nachtigall?
Auf allen Blättern steht, was stehet
Auf einem Blatt,
Aus jedem Lied weht, was gewehet
Im ersten hat:
Daß Schönheit...