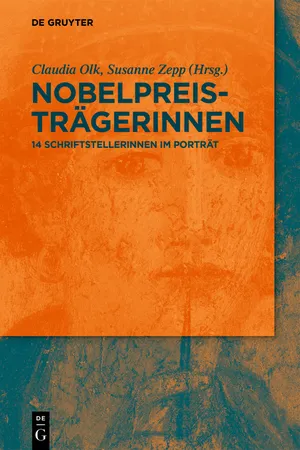Die Nobelpreiskriterien und der Streit um Aleksievič
Mit einem Wort würde ich die Nobelpreisträgerin des Jahres 2015 als ‚Geschichtensammlerin‘ bezeichnen. Aufgrund meiner deutschen Sozialisation denke ich dabei zuerst an die Gebrüder Grimm, die durch die Lande gefahren sind und Märchen gesammelt haben. Der Unterschied zu Aleksievič besteht in diesem Zusammenhang ohne jeden Zweifel darin, dass sie selbst für sich in Anspruch nimmt, dokumentarisch zu arbeiten, und sich dabei der Wahrheit verpflichtet fühlt. So ganz genuin eigenständig erfunden hat sie dieses Genre des ‚Stimmensammelns‘ wohl nicht. In einem Interview sagt sie, dass sie sich hier in der Tradition des belarussischen Schriftstellers Ales’ Adamovič [Аляксандр [Алесь] Міхайлавіч Адамовіч] sehe: „Als ich diese Bücher gelesen hatte, bekam ich das Gefühl für meinen Weg. Ich begriff, was ich gesucht hatte. Gerade so hörte ich das Leben: ‚in Stimmen‘“ und „Adamovič war für mich eine Offenbarung“ (Hielscher 2018, 7).
Der Nobelpreis für Aleksievič hat weltweit hohe Wogen geschlagen und war von Anfang an auch sehr umstritten.
Für ihr vielstimmiges Werk, das dem Leiden und Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt […]. In den vergangenen 30 oder 40 Jahren hat sie sich damit beschäftigt, das Individuum der Post-Sowjet-Zeit zu kartografieren. Aber sie beschreibt keine Geschichte der Ereignisse. Es ist eine Geschichte der Gefühle. Was sie uns bietet, ist eine Welt der Gefühle (Danius zitiert nach Arte 2015)
– so lautet die offizielle Begründung des Nobelpreiskomitees für den Preis. Die Problematik beginnt damit, dass in Person der Schriftstellerin Aleksievič dieser Nobelpreis zum ersten Mal für belarussische Literatur verliehen worden ist. Aleksievič schreibt ihre Texte allerdings auf Russisch. Der Hauptakzent des Schaffens von Aleksievič liegt aber zweifelsohne auf dem Sammeln von Stimmen, wie es Karl Schlögel sehr eindrucksvoll in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahre 2013 formulierte:
Und nun geschieht es: Die bisher stumm Gebliebenen ergreifen das Wort; Menschen, die bisher keinen Namen hatten, erhalten ihren Namen zurück; wo es vorher nur Massen, eine Klasse und Kollektive gegeben hatte, gibt es jetzt einzelne, individuelle Stimmen, Einzelschicksale. Der Mensch ist zurück auf der von Menschen leergefegten Bühne der Geschichte. Aus all diesen Stimmen ergibt sich ein Chor, ein vielstimmiger Chor, mehr noch: es ist so etwas wie das Selbstgespräch, der innere Monolog einer zu Atem und wieder zu sich selbst kommenden Gesellschaft. (2016, 309–310)
Im Gegensatz zu diesem Lob aus dem Jahre 2013 wurde Aleksievič aber anfangs genau dieser Schreibstil vorgeworfen. Es sollte aus diesem Sammeln von Stimmen ein großer Skandal gemacht werden. Da sie aufgezeichnete Gespräche zusammenkomponiert hatte, wurde immer wieder argumentiert, dass es sich bei ihren Büchern gar nicht um ästhetisch verfasste Belletristik, sondern um dokumentarischen Journalismus handle. Fünfhundert bis siebenhundert Geschichten sind es pro Buch, die sie in vier bis sieben Jahren jeweils gesammelt hatte. Es geht hier also auch um die Mündlichkeit des Erzählens, die eine sehr lange russische Tradition hat, auf die Walter Benjamin in seinem berühmten Aufsatz über den Gegensatz von Romancier und Erzähler in Bezug auf Nikolaj Leskov hingewiesen hat. Benjamin argumentiert, dass nach dem Ersten Weltkrieg das Vermögen, Erfahrungen mündlich auszutauschen, verloren gegangen sei: „Die Kunst des Erzählens neigt ihrem Ende zu, weil die epische Seite der Wahrheit, die Weisheit, ausstirbt“ (1936, 106), wobei er auch nachprüfbare alltägliche Information von überlieferter fernerer Kunde abgrenzt. „So haftet an der Erzählung die Spur des Erzählenden wie die Spur der Töpferhand an der Tonschale“ (1936, 111), schreibt Benjamin.
Es steht also die Frage im Raum, ob die Vergabe des Literaturnobelpreises für dieses Genre des Zusammenführens von Erzählstimmen, das laut Benjamin in Kontrast zum neuzeitlichen Roman steht, überhaupt gerechtfertigt ist. Bereits im Jahre 2004 argumentierte Thomas Steinfeld in der Süddeutschen Zeitung gegen den Nobelpreis für Elfriede Jelinek:
All diese Missvergnügten, Satiriker wie Karl Kraus, Bauchredner wie Helmut Qualtinger, sind empfindliche Menschen ‒ aber keiner von ihnen findet aus der Subjektivität heraus, was notwendig wäre, um einen gesellschaftlichen Missstand zu ‚entlarven‘. Statt dessen jammern sie und kreischen, schimpfen und pöbeln manchmal auch herum, und ihr Schmerz ist immer auch Anklage wider die Weltlage im Allgemeinen und Österreich im Besonderen.
Hier wird ein durchaus bildungsbürgerliches Anliegen thematisiert, demgemäß der Nobelpreis für ‚hohe‘ Literatur verliehen werden möge. Einer der Autoren par excellence wäre in diesem Zusammenhang natürlich Thomas Mann, der 1929 den Literaturnobelpreis erhalten hatte. Ein Autor, der dem Leser enzyklopädisches Wissen vermittelt, den Wortschatz erweitert, an bürgerlichen Sehnsuchtsorten Ängste und Träume durchspielt. Wenn also schon der Nobelpreis an Elfriede Jelinek im Jahre 2004 als Skandal empfunden wurde, so der Nobelpreis des Jahres 2015 wohl noch viel mehr. Eine belarussische Frau, die sich selbst immer als ein Kind der Sowjetunion bezeichnet, fährt mit einem Tonbandgerät durch die Weiten des Ostens und zeichnet Hunderte von Gesprächen einfacher Menschen auf. Jede Gesprächspartnerin und jeder Gesprächspartner verwenden ihren eigenen beschränkten Wortschatz und vermitteln ihren kleinen Horizont des alltäglichen Lebens und ihre subjektive Wahrheit des selbst Erlebten. Im Sinne der Hermeneutik à la Hans-Georg Gadamer denken wir an den hermeneutischen Zirkel, in dem wir uns in einer Spiralbewegung zur Erkenntnisvergrößerung über all unsere einzelnen Horizonte hinausbewegen. Und dennoch sind es die Stimmen der sogenannten ‚kleinen Leute‘. Mit Dostoevskijs Buchtitel könnte man auch von den Erniedrigten und Beleidigten (Уни́женные и оскорблённые) sprechen. Warum also ist eine solche Poetik des Nobelpreises würdig? Und worin besteht der Wert dieser Texte für uns Lesende?
Da sie in Bezug auf Aleksievič sehr wichtig sind, möchte ich die Vergabekriterien für den Literaturnobelpreis hier noch einmal explizit thematisieren: Bei diesem der insgesamt fünf von Alfred Nobel gestifteten Preise geht es ganz explizit nicht in erster Linie um die ästhetische Qualität der geschriebenen Bücher, sondern um ein mutiges Lebenswerk und um eine hörbare Stimme, die für die Zivilgesellschaft eintritt, also um diejenigen, „die […] der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben“ (zitiert nach Wikipedia 2018) – so der konkrete Wortlaut. Aus dieser Sicht ergibt die Vergabe des Literaturnobelpreises des Jahres 2015 nun durchaus sehr großen Sinn. Und der Erfolg gibt Aleksievič Recht: Ihre Werke sind in über fünfzig Sprachen übersetzt, und haben millionenfache Auflagen erreicht. Es ist der Lehrerstochter, die aus sehr kleinen Verhältnissen kommt, gelungen, alle wichtigen neuralgischen Punkte im Prozess des Untergangs der Sowjetunion zu thematisieren – und zwar ganz besonders Phänomene, die zunächst öffentlich streng tabuisiert gewesen sind. Wenn ein Karl Schlögel (als gebürtiger Allgäuer wie ich) aus der historischen Distanz heraus sein epochales Buch Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt veröffentlicht und dafür den Preis der Leipziger Buchmesse 2018 in der Kategorie Sachbuch/Essayistik erhält, dann ist es das eine. Wenn eine Frau aus der belarussischen Provinz plötzlich ihre Stimme in der durchweg männlich dominierten Welt erhebt und mutig Tabuthemen öffentlich publiziert und somit ganz deutlich aufbegehrt, dann ist es das andere. Gerade dieser Mut, der dafür nötig war, hat in jedem Fall den Menschen in der ehemaligen Sowjetunion genutzt. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass ihr Buch über Tschernobyl zunächst ein sehr singuläres Ereignis darstellt, das man von seiner sozialen Sprengkraft auch mit Christa Wolfs Störfall in der späten DDR vergleichen kann, so ist die Preisvergabekategorie Alfred Nobels, der Menschheit den größten Nutzen geleistet zu haben, zweifelsohne schon alleine aus diesem Grunde erfüllt.
Trotz ihrer oppositionellen Haltung gegenüber dem diktatorischen System unter Präsident Aljaksandr Lukašenka in Belarus – ihr Telefon wird abgehört, öffentliche Auftritte werden untersagt – kehrte sie nach Aufenthalten in Paris, Stockholm und Berlin 2011 nach Minsk zurück. Wiederholt hat Aleksievič sich in aktuelle politische Debatten eingemischt. Sie kritisierte die innenpolitische Repression in Belarus unter Lukašenka. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft 2014 politisch motivierte Ermittlungen gegen ihren Verleger Ihar Lohwinau ein (Ackermann 2015, 15). Sie nennt auch die Re-Sowjetisierung und Re-Militarisierung der russischen Gesellschaft unter Vladimir Putin beim Namen (Breitenstein 2015). Dieser lüge seine Landsleute an und baue seine Macht auf deren „Sklavenmentalität“ auf. Ihre Bücher wurden in Belarus von 1999 bis 2013 nicht gedruckt. Dank verschiedener Stipendien und Literaturpreise lebte Aleksievič von 2000 bis 2002 in Italien, von 2003 bis 2005 in Frankreich, von 2005 bis 2007 in Schweden, von 2008 bis 2011 in Deutschland, und auch heute lebt sie wieder im Exil (Hielscher 2018, 23).