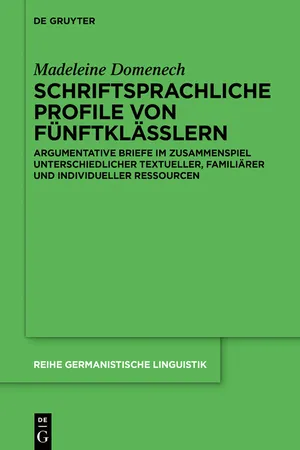
eBook - ePub
Schriftsprachliche Profile von Fünftklässlern
Argumentative Briefe im Zusammenspiel unterschiedlicher textueller, familiärer und individueller Ressourcen
- 309 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Schriftsprachliche Profile von Fünftklässlern
Argumentative Briefe im Zusammenspiel unterschiedlicher textueller, familiärer und individueller Ressourcen
Über dieses Buch
Die soziolinguistisch orientierte Studie empirischer Schreibforschung befasst sich mit persuasiven Briefen von Fünftklässlern. Auf Basis umfangreicher Daten des Projekts FUnDuS integriert die Untersuchung ressourcenbasiert textbezogene (u.a. Argumentationsstruktur), familiäre (u.a. sozioökonomischer Status) und individuelle (u.a. Erstsprache, literale Praktiken) Variablen in der Herausarbeitung vier schriftsprachlicher Profile.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Schriftsprachliche Profile von Fünftklässlern von Madeleine Domenech im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Deutsch. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Einleitung
1.1Begründung des Gegenstandes und Erkenntnisinteresse
1.1.1Relevanz des Gegenstandes
Der kompetente Umgang mit Schrift gilt in vielerlei Hinsicht als ‚door-opener‘: Entwicklungspsychologisch schafft Schrift Zugang zu Erkenntnisgewinn (Vygotskij 2002), Sprachbetrachtung und metasprachlichem Bewusstsein (Günther 2010, 10–11), gesellschaftlich ermöglicht sie u. a. soziale und edukative Partizipation.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Schrift nicht gleich Schrift ist, sondern in Abhängigkeit des jeweiligen Kontextes systematisch variiert: In ursprünglich mündlich geprägten Situationen schriftlicher Interaktion, z. B. in Messenger-Apps, ist ein anderer Gebrauch von Schrift üblich als in einem Bewerbungsschreiben oder in einem juristischen Kommentar (siehe z. B. Dürscheid 2011 12). Gerade die im Bildungssystem verlangten Formen der Kommunikation mit Schrift bzw. deren Rezeption oder Produktion zeichnen sich durch relativ stabile Anforderungen aus, welche damit jedoch zum Teil erheblich von der medial und (schrift-)sprachlich dynamischen Lebenswelt Jugendlicher abweichen.
Die Beherrschung eben jener Varianten schriftlicher Kommunikation wird mit steigendem Alter zunehmend relevant, wenn es beispielsweise um das Erlangen eines Schulabschlusses oder eines Ausbildungsplatzes geht. Hier bekommt der kompetente Umgang mit Schrift also auch eine qualifizierende und selektierende Funktion.
In diesem Zusammenhang bzw. in diesem Altersabschnitt nimmt auch die Bedeutung argumentativer Fähigkeiten zu, welche insbesondere ab der Sekundarstufe I als durchgängige und zentrale Schlüsselkompetenz bzw. Diskursfunktion gelten (z. B. Feilke 2013; Vogt 2002; Vollmer 2011) – wobei gerade das schriftliche Argumentieren im Kontext der aktuellen Diskussion um bildungssprachliche bzw. literale Qualifikationen als paradigmatisch hervorgehoben wird (z. B. Feilke 2010b; 2013).
Die bildungsbiographische Relevanz argumentativer Fähigkeiten spiegelt sich beispielsweise auch in curricularen Vorgaben wie den aktuellen Bildungsstandards des Faches Deutsch, in denen das Argumentieren von der Primarstufe bis zum Ende der Sekundarstufe II auftaucht (siehe KMK 2004; 2005; 2014). Dabei findet u. a. eine Verlagerung von mündlicher zu schriftlicher Kommunikation und von kommunikativen zu epistemischen Funktionen statt. In diesem Sinne lassen sich argumentative Fähigkeiten auch als „cognitive linguistic function“ (Beacco, Fleming, Goullier, Thürmann & Vollmer 2015, 15) beschreiben, welche sich sowohl durch spezifische kognitive Umgangsweisen mit einem Sachverhalt als auch typische Formen der Versprachlichung auszeichnen. Damit kommt ihnen neben der bildungsbiographischen insbesondere auch eine facherübergreifend zentrale Rolle zu, da sie zugleich als Lernmedium, -gegenstand und -ergebnis fungieren (z. B. Beacco et al. 2015; Gogolin & Lange 2011). Diese enge Verzahnung von schulischen Leistungen und Argumentationskompetenz ist inzwischen auch im Längsschnitt für den gesamten Verlauf der Sekundarstufe I und unterschiedliche Fächer empirisch nachgewiesen (z.B. Domenech, Krah, Hollmann 2017; Quasthoff, Wild, Domenech, Hollmann, Kluger, Krah & Otterpohl 2016).
Die Erforschung eben jenes schulischen oder sprachlichen (Miss-)Erfolgs findet spätestens seit dem ‚PISA-Schock‘ auch verstärkt unter Berücksichtigung familiärer oder individueller Ausgangsbedingungen statt.
Dabei sind angesichts der Konfundierung dieser Aspekte in der Realität – so hängen beispielsweise migrations- und bildungsassoziierte sowie sozioökonomische Merkmale oft zusammen (siehe z. B. Schwippert, Hornberg, Freiberg & Stubbe 2007) – in den letzten Jahren zunehmend komplexere Designs in Untersuchungen der empirischen Bildungsforschung zu beobachten. Diese arbeiten in der Regel hoch standardisiert unter Einbezug zahlreicher Variablen und aufwändiger statistischer Auswertungsverfahren.
Auch im Bereich der Sprach- und Schreibdidaktik bzw. der Erforschung sprachlicher oder schriftlicher Fähigkeiten unter schul- und anwendungsbezogener Perspektive lassen sich diese Tendenzen einer zunehmenden Empirisierung feststellen, so z. B. die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte interdisziplinäre Forschungsinitiative Sprachdiagnostik und Sprachförderung (FiSS)1.
1.1.2Forschungsdesiderate in Bezug auf den Gegenstand
Trotz der zentralen Rolle des Schreibens für eine erfolgreiche soziale und edukative Teilhabe ist seine empirische Erforschung sowie theoretische Modellierung nach wie vor als fragmentarisch zu bezeichnen.
Dies gilt insbesondere für die Altersgruppe zu Beginn der Sekundarstufe I, zu der die vorliegenden Befunde im Vergleich zu jüngeren oder älteren Schreibern2 „weniger einheitlich [sind], weil die Entwicklung hier aufgrund unterschiedlicher Faktoren differenzierter verläuft“ – wie Becker-Mrotzek & Böttcher (2012, 58) stellvertretend konstatieren.
Auch die Untersuchung schriftlicher Argumentationen ist im Vergleich zu anderen Textorten, wie z. B. Narrationen, erst ‚verspätet‘ bzw. seit einigen Jahren in den Fokus einzelner empirischer Arbeiten (z. B. Böhnisch 2009; Henrici 2012; Petersen 2014; Rezat 2011) oder größerer Projekte3 gerückt. Gleichsam kumulativ trifft dieses relative Forschungsdefizit schließlich auf die Erforschung schriftlicher argumentativer Fähigkeiten zu Beginn der Sekundarstufe I zu. Hier liegen bis heute vergleichsweise wenige und widersprüchliche Erkenntnisse vor (siehe z. B. Augst, Disselhoff, Henrich, Pohl & Völzing 2007 für eine Übersicht). Dies ist möglicherweise auch auf die besondere Beschaffenheit argumentativer Texte zurückzuführen, welche in der Forschung als textuell und kommunikativ offen, hybrid oder mehrdimensional beschrieben werden (z. B. Becker-Mrotzek & Böttcher 2012; Feilke 2008; Pohl 2014; Vollmer 2011). Somit stellen sich womöglich besondere Anforderungen an ihre Produktion – beispielsweise die funktionale Koordination unterschiedlichster textueller Ebenen im Verlauf eines anspruchsvollen Schreibprozesses – sowie ihre empirische Analyse.
Auch das Wissen über die soziale Bedingtheit schriftlicher Textproduktion ist bisher nur lückenhaft bzw. widersprüchlich, wie erste Ergebnisse des vom BMBF geförderten textsortenübergreifenden Projekts Teilkomponenten von Schreibkompetenz (TkSk)4 exemplarisch belegen (Knopp, Becker-Mrotzek & Grabowski 2013). Domenech & Petersen (2018) stellen vor dem Hintergrund ihrer Analyse vorliegender Befunde zum schriftlichen Argumentieren in der Zweitsprache Deutsch fest, dass diese sowohl auf die Wirkung migrations- und bildungsassoziierter Aspekte auf familiärer und individueller Ebene verweisen, weshalb es zukünftig „empirischer Untersuchungen [bedarf], welche die aus vorheriger Forschung bekannte Vielzahl potentiell relevanter Hintergrundmerkmale erheben und in transparenten Auswertungen differenziert berücksichtigen“.
Dies stellt jedoch, wie Jost & Becker-Mrotzek (2014) stellvertretend beobachten, das sich erst formierende Feld deutschsprachiger empirischer Schreibforschung vor bedeutsame Herausforderungen, beispielsweise mit Blick auf fundierte und praktikable Operationalisierungen der jeweiligen Untersuchungsgegenstände oder geeignete Verfahren der Text- und Datenauswertung.
1.1.3Erkenntnisinteresse der Arbeit
Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Untersuchung situiert sich genau an dem Schnittpunkt der dargestellten Aspekte: Ziel ist es, das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher textueller und sozialer Aspekte bei der argumentativen Textproduktion zu Beginn der Sekundarstufe I empirisch basiert mit Hilfe verschiedener Verfahren der Text- und Datenauswertung quantitativ-explorativ zu untersuchen und typisiert zusammenzufassen.
Durch diese Ausrichtung schließt die vorliegende Studie nicht nur ‚empirische Lücken‘ hinsichtlich der sozialisatorischen Erforschung schriftlicher Fähigkeiten in einer bisher vergleichsweise wenig untersuchten Altersgruppe und Textsorte, sondern schafft außerdem vielfältige Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Bereiche der Schreibforschung.
Unter theoretischer Perspektive liefern die Analysen u. a. wichtige Beiträge für die bisher bruchstückhafte Modellierung der Ontogenese schriftsprachlicher argumentativer Fähigkeiten zu Beginn der Sekundarstufe I unter besonderer Berücksichtigung textsortenübergreifender vs. -spezifischer Aspekte, der Interaktion verschiedener Facetten der Textproduktion oder deren (un) systematische soziale Bedingtheit.
Damit tragen die Ergebnisse perspektivisch auch dazu bei, sich im Laufe des Erwerbs herausbildende Differenzen in einem für den Schulerfolg zentralen Kompetenzbereich adäquater zu erklären, fundierter und differenzierter zu diagnostizieren sowie diese perspektivisch auf Basis möglichst passgenauer Förderangebote zu minimieren.
Schließlich verspricht die Anlage dieser Studie auch wichtige methodische Impulse für das noch junge Forschungsfeld bzw. die Bearbeitung aktueller Fragestellungen empirischer Schreibforschung zu geben, beispielsweise durch die Operationalisierung verschiedener textueller und sozialer Variablen sowie die Erprobung unterschiedlicher Auswertungsverfahren.
1.2Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in vier Teile: die Darstellung des relevanten Forschungskontextes (Kapitel 2), die Anlage, Zielsetzung(en) und das Design der Studie (Kapitel 3), die empirischen Analysen (Kapitel 4) sowie einen resümierenden Rück- und Ausblick (Kapitel 5).
Kapitel 2 arbeitet den für diese Untersuchung relevanten, internationalen und interdisziplinären Forschungskontext aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf.
Zunächst skizziert Kapitel 2.1.1 zentrale Merkmale des Forschungsfeldes und des Untersuchungsgegenstandes der Schreibforschung. Die folgenden Kapitel 2.1.2 bis 2.1.4 zeichnen prominente Diskurslinien der letzten Jahre nach (Empirisierung – Kompetenzorientierung – ‚Soziolinguistisierung‘). Diese werden anschließend in Kapitel 2.1.5 mit Blick auf die Verortung dieser Studie im aktuellen Forschungsdiskurs sowie sich daraus ableitende zentrale Annahmen und Begriffe resümierend zusammengeführt.
Die anschließende Aufarbeitung der unmittelbar einschlägigen Vorarbeiten erfolgt in Anlehnung an einen Vorschlag von Baurmann (1989, 263) differenziert nach zwei Perspektiven: Kapitel 2.2 fasst empirische Erkenntnisse der Schreibforschung zum Entwicklungsstand schriftlicher argumentativer Textproduktion zu Beginn der Sekundarstufe I zusammen – sowohl hinsichtlich ihrer ontogenetischen (Kapitel 2.2.1), textuellen (Kapitel 2.2.2) und sozialen (Kapitel 1.2.3) Bedingtheit. Kapitel 2.3 gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der verwendeten Methoden in der empirischen Schreibforschung, bezogen auf die Ebene der Textauswertung (Kapitel 2.3.1), messmethodische Dimensionen (Kapitel 2.3.2) sowie Aspekte der statist...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Relevanter Forschungskontext
- 3 Anlage der Untersuchung
- 4 Empirische Analysen
- 5 Rückblick und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis