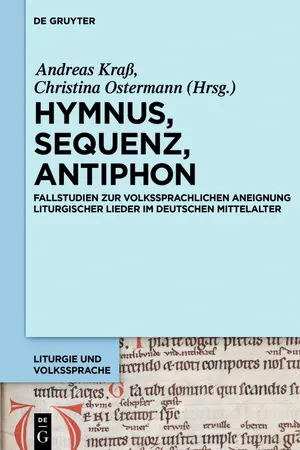
Hymnus, Sequenz, Antiphon
Fallstudien zur volkssprachlichen Aneignung liturgischer Lieder im deutschen Mittelalter
- 283 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Hymnus, Sequenz, Antiphon
Fallstudien zur volkssprachlichen Aneignung liturgischer Lieder im deutschen Mittelalter
Über dieses Buch
Die volkssprachlichen Bearbeitungen lateinischer geistlicher Lieder im deutschen Mittelalter sind noch kaum erforscht. Welche Hymnen, Sequenzen und Antiphonen wurden übersetzt? Wo, in welcher Weise und zu welchem Zweck wurden sie ins Deutsche übertragen? Wie schlägt sich der ursprünglich liturgische Charakter der lateinischen Lieder im volkssprachlichen Gebrauch nieder?
Der Sammelband vereint eine Reihe von Fallstudien, die auf der Basis des Berliner Repertoriums entstanden, einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Online-Datenbank, die die mittelalterlichen deutschen Übertragungen lateinischer Hymnen, Sequenzen und Antiphonen erschließt. Behandelt werden berühmte Lieder auf ihrem Weg in die Volkssprache wie die Hymnen Ave vivens hostia und Veni creator spiritus, die Sequenzen Lauda Sion salvatorem und Stabat mater dolorosa sowie die Antiphonen Media in vita und Salve regina. Prominente Liederdichter wie der Mönch von Salzburg werden ebenso untersucht wie anonyme Bearbeitungen aus dem monastischen Milieu. So dokumentieren die Beiträge die breiten Spielräume des volkssprachlichen Zugriffs auf die lateinische Liturgie im Mittelalter.
Der Sammelband bietet neue Impulse für alle mediävistischen Fächer, die sich mit Überlieferung und Gebrauch liturgischer Lieder im Mittelalter befassen, insbesondere der germanistischen und mittellateinischen Philologie, der Theologie und der Musikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
1. Der lateinische Hymnus
1.1 Text
| I | Veni, Creator Spiritus: mentes tuorum visita! imple superna gratia, quae tu creasti pectora! |
| II | Qui Paracletus diceris, donum Dei altissimi, fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio: |
| III | Tu septiformis munere, dextrae Dei tu digitus, tu rite promisso Patris sermone ditans guttura. |
| IV | Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti: |
| V | Hostem repellas longius pacemque dones protinus: ductore sic te praevio vitemus omne noxium: |
| VI | Per te sciamus da Patrem noscamus atque filium, te utriusque Spiritum credamus omni tempore! |
| VII | Praesta hoc, Pater piissime Patrique compar unice cum Paraclito Spiritu regnans per omne saeculum! |
I,1 crator B; veni sancte creator D1.I,3 gratie D1.I,4 quae tu] tu que I.II,1 deique donum Mone; paraclitus R; Strophenreinfolge in R: I, II, IV, III, V, VI.II,3 vivis D1; ignis] om. B.III,1 munere] gracie R.III,2 dexterae G.III,3 promissum B.III,4 ditas D7; gutture D1.IV,3 pectoris L.IV,4 perpetim CHL.V,2 donans L.VI,3 Mone: „te für et haben alle, ein Schreibfehler, der sich festgesetzt hat“8.VII,3 cum spiritu paracleto B.
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Einleitung
- Abteilung I Hymnen
- Abteilung II Sequenzen
- Abteilung III Antiphonen
- Index
- Autorenverzeichnis