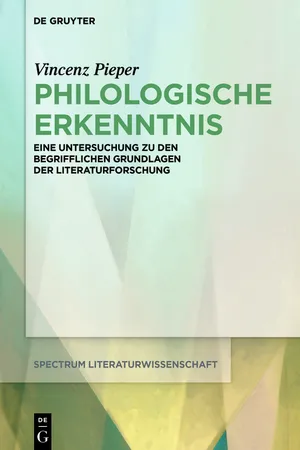Das Ziel dieses ersten Teils ist es, eine Mythologie zu rekonstruieren, die sich im Nachdenken über Sprache und Sprachverstehen etabliert hat. Aus unauffälligen Gedankensprüngen und subtilen Verwechslungen entstehen folgenreiche Verwicklungen, die das Verständnis von Philologie tiefgreifend beeinflussen. Ich beginne mit einigen vorbereitenden Erläuterungen zur kritischen Funktion der Begriffsanalyse (1.1). Es folgt die Untersuchung einzelner Denkmuster, wobei sich zeigen wird, wie verschiedene Traditionen der Theoriebildung von der unreflektierten Neigung geprägt sind, Bedeutungen und Darstellungsinhalte als Begleiterscheinungen oder Ergänzungen der bloßen Schriftzeichen zu deuten (1.2, 1.3). Die problematische Tendenz zur Verdinglichung führt nicht nur zu einer konfusen Bedeutungsauffassung, sondern auch zu einer umfassenden Mythologisierung des Mentalen, deren Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Literaturwissenschaft in den folgenden Kapiteln dargelegt wird (1.4, 1.5, 1.6, 1.7). Das letzte Kapitel diskutiert einige Einwände, die man gegen die sprachkritische Analyse wissenschaftlicher Theorien erhoben hat (1.8).
1.1 Zur Methode: Die kritische Aufgabe der Begriffsanalyse
In der Abhandlung Über philologische Erkenntnis dokumentiert Peter Szondi seinen Widerstand gegen eine traditionelle Konzeption des Lesens und Verstehens: Er bestreitet, daß die Philologie herausfinden müsse, „welche Bedeutung oder auch welche Bedeutungen von dem Dichter gemeint waren“,1 er will die Wörter nicht als „Vehikel im Dienst von Gedanken und Vorstellungen“2 verstanden wissen und lehnt es ab, einen Text „ins imaginäre Netz der Intention zu ziehen“.3 Szondi hat weder Einwände gegen die Bemühung, die ‚volle Bedeutung‘ des Ausdrucks „abendländische Junonische Nüchternheit“ zu ergründen, noch gegen den Anspruch, Hölderlins ‚Gedanken‘ und ‚Vorstellungen‘ möglichst genau zu verstehen.4 Es ist das theoretische Verständnis dieser Begriffe, das aus Szondis Perspektive dafür sorgt, daß der Gegenstand der Philologie „eher verkannt denn erkannt“,5 ja „verfälscht“6 wird. Was Szondi anstrebt, ist die „Revision“ einer irreführenden „Vorstellung von der Natur der Sprache“,7 die zu einem veränderten Selbstverständnis der Literaturforschung führen soll.
Die beste Kritik an der Sprachauffassung, die auch in den gegenwärtigen Diskussionen noch zu einem unzureichenden Verständnis von Philologie führt, stammt wohl von Ludwig Wittgenstein. Szondi hat Wittgensteins Schriften gelesen und in Über philologische Erkenntnis mit spürbarer Anerkennung zitiert.8 Vielleicht hat er die Tragweite der Philosophischen Untersuchungen nicht in vollem Umfang erfaßt, seine von Friedrich Schleiermacher inspirierte Auffassung der Schrift als Lebensäußerung und sein lebhaftes Interesse an Jacques Derridas Sprachkonzeption (bei gleichzeitiger Distanzierung von einer „Esoterik à la Derrida“9) rechtfertigen es jedoch, seine Überlegungen zu den „methodologischen und erkenntnistheoretischen Voraussetzungen“10 der Literaturwissenschaft in Wittgensteins Richtung weiterzudenken.11 Das Bild vom Funktionieren der Sprache, von dem sich Szondi, ohne seine Natur und seinen weitreichenden Einfluß ganz zu durchschauen, befreien will, wird in Wittgensteins Blauem Buch erhellend analysiert:
Es scheint, daß es gewisse definitive geistige Vorgänge gibt, die mit dem Arbeiten der Sprache verbunden sind, Vorgänge, durch die allein die Sprache funktionieren kann. Ich meine die Vorgänge des Verstehens und Meinens. Die Zeichen unserer Sprache erscheinen tot ohne diese geistigen Vorgänge; und es könnte der Eindruck entstehen, daß es die einzige Funktion der Zeichen ist, solche Vorgänge hervorzurufen, und daß diese Vorgänge eigentlich das sind, wofür wir uns interessieren sollten. […] Wir sind versucht zu denken, daß die Aktion der Sprache aus zwei Teilen besteht; einem inorganischen Teil, dem Handhaben von Zeichen, und einem organischen Teil, den wir als Verstehen, Meinen, Deuten und Denken dieser Zeichen bezeichnen können.12
Diese Rekonstruktion gibt eine erste Idee von der Sprachauffassung, mit der sich Szondi auseinandersetzt. Die Aussagen, die Wittgenstein wiedergibt, kennzeichnen die Muster, nach denen Theorien des Sprachverstehens aufgebaut sind: Man beginnt mit der Feststellung, daß die sprachlichen Ausdrücke von sich aus nichts bedeuten und mit einer Bedeutung verbunden werden müssen. Daß eine Verbindung von Ausdruck und Bedeutung zustande kommt, liegt daran, daß Autoren nicht nur Zeichen produzieren, sondern auch etwas mit ihnen zu verstehen geben wollen. Sie intendieren bestimmte Bedeutungen, die vom Leser reproduziert werden sollen. Das Verstehen des Textes ist ein seelischer Vorgang, bei dem der Leser die Zeichen wieder mit Bedeutungen verbindet, wobei er ihnen möglichst die Bedeutungen zuweisen sollte, die der Autor intendiert hat. Bei der Interpretation schließt man von den gegebenen Zeichen auf die verborgenen Absichten, um die richtigen Bedeutungszuweisungen vorzunehmen. Die Übereinstimmung der gemeinten mit der verstandenen Bedeutung ist das Ziel, dem man sich annähert.
Es ist nicht leicht, die skizzierte Sprachauffassung richtig zu beurteilen. Selbst einige ihrer radikalsten und beharrlichsten Gegner gehen in ihrer Kritik nicht weit genug. Die Aussage, daß Zeichen mit Bedeutungen verbunden sind, die Aussage, daß das Verstehen ein Vorgang ist, und die Aussage, daß das Denken im Kopf stattfindet, wirken so vertraut und einsichtig, daß man es nicht für nötig hält, sie genauer zu prüfen – und so bestimmen sie nicht nur die vorwissenschaftliche Auffassung vom Textverstehen, sondern werden auch von Forschern verschiedener Disziplinen bei der Ausarbeitung von mehr oder weniger anspruchsvollen Theorien bedenkenlos vorausgesetzt. Im Laufe der Untersuchung wird sich allmählich zeigen, daß diese Basisannahmen, die viele Sprach- und Literaturwissenschaftler für unverdächtig und von selbst einleuchtend halten, unstimmig sind: Sie entstehen aus einer unbewußten Fehldeutung der Begriffe ‚Verstehen‘, ‚Bedeutung‘, ‚Absicht‘, ‚Gedanke‘, ‚Vorstellung‘ – einer Fehldeutung, die schwer zu korrigieren ist. Die Tendenz, diese und andere Grundbegriffe der Literaturwissenschaft verdinglichend zu deuten, führt unbemerkt zu einer metaphysischen Auffassung des Sprach- und Textverstehens: Es werden Fragen gestellt, die auf falschen Voraussetzungen beruhen, Prozesse und Strukturen postuliert, die unverständlich bleiben, und Probleme bearbeitet, die keine sind.
Wittgenstein versteht unter ‚Metaphysik‘ eine wissenschaftliche oder quasi-wissenschaftliche Theoriebildung, die eine Fehldeutung der Sprachformen voraussetzt: „Man bevölkert die Welt mit ätherischen Wesen, den schattenhaften Begleitern der Substantive. Die Wissenschaft von diesen Scheinwesen könnte man mit Recht Metaphysik nennen.“13 Carnap benutzt ‚Metaphysik‘ „als Bezeichnung für den Bereich angeblichen Wissens über das Wesen der Dinge […], der sich der empirisch begründeten induktiven Wissenschaft entzieht“,14 und er nennt, mit welcher Berechtigung sei dahingestellt, die Schriften von Fichte, Schelling, Bergson und Heidegger als Beispiele. Damit ist jedoch nur ein geringer und vielleicht nicht einmal der interessanteste Teil dessen abgedeckt, was mit Wittgenstein und Carnap als ‚Metaphysik‘ verstanden werden kann.15 Denn auch in wissenschaftlichen Theorien, die den Anspruch erheben, durch empirische Belege gestützt zu sein, können „Scheinsätze“16 vorkommen, d. h. täuschende Sätze, die auf den ersten Blick bestätigungsfähig zu sein scheinen und oft auch für begründet gehalten werden, die aber bei genauerer Betrachtung einen Mangel an Klarheit aufweisen, der mit dem Anspruch auf Nachprüfbarkeit unvereinbar ist.17
Unter dem Einfluß von Harald Fricke hat sich die Literaturwissenschaft Carnaps Explikationsprojekt erfolgreich zu eigen gemacht.18 Die metaphysikkritischen Einsichten der Analytischen Philosophie wurden hingegen eher vernachlässigt. Dabei könnten sie die Methodologie der Textanalyse bereichern.19 Eine sprachkritische Untersuchung kann zeigen, daß Sätze, die mit wissenschaftlichem Anspruch vorgetragen werden und etwas Richtiges zu sagen scheinen, keine Kandidaten für empirische Bewährung sind. Der Eindruck, daß sie eine nachprüfbare Beschreibung besonderer Phänomene geben, entsteht aus einer trügerischen Verwendung der Wörter. Die Begriffsanalyse entkräftet, indem sie klarstellt, daß der Anschein empirischer Bestätigung auf Konfusionen und Trugschlüssen beruht, die unberechtigten Erkenntnisansprüche. Theorien werden also nicht deswegen zurückgewiesen, weil sie die Erfahrungsdaten nicht gut erklären können, gegen sie wird auch nicht bloß der bekannte Vorwurf erhoben, überflüssige Wesenheiten einzuführen. Das Hauptanliegen der Untersuchung ist es vielmehr, die – oft uneingestandenen – rhetorischen Operationen offenzulegen, die „Blendwerken den Anstrich der Wahrheit“20 geben. Die sprachliche Analyse von Theorien fällt in den Aufgabenbereich der Literaturforschung. Die „philologische Leidenschaft des Differenzierens“21 findet hier ein sinnvolles Betätigungsfeld.
Der Gefahr, sich von Ungereimtheiten täuschen zu lassen, ist jeder Forscher ausgesetzt, der systematisch über das Sprachverstehen nachdenkt. Der Grund dafür ist, daß die Illusionen von vertrauten Wörtern und Redewendungen hervorgerufen werden, die im Alltag und in den Wissenschaften regelmäßig zur Anwendung kommen. Schon Lichtenberg stellte fest, daß eine falsche Philosophie „der ganzen Sprache einverleibt“22 sei und sich jedem, der von ihr Gebrauch mache, unwillkürlich aufdränge. Auch Nietzsche sprach von einer „Verführung von Seiten der Grammatik“, die das wissenschaftliche Denken systematisch irreleite. Er war sich bewußt, daß die „philosophische Mythologie“, die in der Sprache versteckt ist, „alle Augenblicke wieder herausbricht, so vorsichtig man sonst auch sein mag“.23 Doch erst im 20. Jahrhundert bemühte man sich systematisch darum, der Entstehung grammatischer Illusionen auf den Grund zu gehen. Wittgenstein gab diesem Projekt eine ganz neue Wendung und die von ihm beeinflußte Strömung der Analytischen Philosophie konnte seine methodologischen Einsichten produktiv weiterentwickeln.24 Als deren Hauptvertreter sind Moritz Schlick, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Friedrich Waismann, Gilbert Ryle, John Austin, Peter Strawson, Norman Malcolm, Anthony Kenny, Alan White, Bede Rundle, Peter Hacker, John Hyman, Hans-Johann Glock, Severin Schroeder und Eugen Fischer zu nennen.25 Welche Aufgabe die Begriffsanalyse in Bezug auf die Psychologie und andere Geisteswissenschaften hat, legt Rundle pointiert dar:
Negatively, the philosopher’s task is to disentangle confusions, to expose nonsense. Positively, it is to elucidate the interrelations between t...