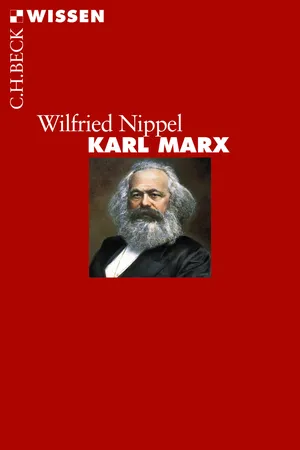
- 128 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Karl Marx
Über dieses Buch
Karl Marx hat als Politiker, Journalist und Wissenschaftler ein immenses Werk hinterlassen, das aber Zeitgenossen nur in kleinen Teilen bekannt war und überwiegend erst durch posthume Editionen erschlossen wurde. Begonnen hat dies Friedrich Engels, der zugleich auf vielfältige Weise seine Deutungshoheit über Leben und Werk von Marx etablierte – mit Nachwirkungen bis heute. Anlässlich des 200. Geburtstags von Marx legt Wilfried Nippel eine Darstellung vor, die sich auf dessen Wirkung in seiner Zeit konzentriert.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
VI. London – Das Elend des Exils
London wurde nach den gescheiterten Revolutionen zum Sammelplatz politischer Flüchtlinge aus ganz Europa. Viele, die in der Schweiz Zuflucht gefunden hatten, kamen nach der Verschärfung der dortigen Ausländerpolitik nach London, oft als Zwischenstation, bevor sie in die USA weiterzogen.
England wies keinen Flüchtling ab oder aus. Ausländer konnten sich in Vereinigungen zusammenfinden und eigene Presseorgane gründen. Es gab diskrete Überwachungen durch die (im Vergleich zu anderen Ländern unterentwickelte und von der Öffentlichkeit kritisch beäugte) Polizei, doch keine Briefkontrollen und Hausdurchsuchungen. Man ließ aber auch Spitzel im Dienste anderer Regierungen gewähren.
Das «Flüchtlingselend» der Familie Marx
Marx führte in London das Leben eines mittellosen Flüchtlings, der zudem durch die Sorge um eine wachsende Familie und Schicksalsschläge belastet wurde. Jenny war hochschwanger nach London gekommen. Im Oktober bezog die Familie eine Wohnung in Chelsea. Der am 5. November 1849 geborene Sohn Guido verstarb nach einem Jahr (19.11.1850). Zwischenzeitlich, im April 1850, war man auf die Straße gesetzt worden, weil die Miete nicht bezahlt werden konnte; das Gleiche passierte, als man danach einige Wochen in einer Pension untergekommen war. Ende Mai 1850 wurde eine Wohnung mit zwei möblierten Zimmern in der Dean Street im heruntergekommenen Stadtteil Soho bezogen, zum Jahresende wechselte man in der gleichen Straße in eine Dreizimmerwohnung. Die am 28. März 1851 geborene Tochter Franziska wurde nur ein Jahr alt (†16. April 1852). Auf die Geburt von Eleanor am 16. Januar 1855 folgte am 6. April der Tod des achtjährigen Edgar. Ein weiteres Kind verstarb sofort nach der Geburt Anfang Juli 1857. Alle Familienmitglieder sind immer wieder von Krankheiten geplagt. Bei Marx betrifft dies Atemweg-, Gallen- und Leberbeschwerden, Augenentzündungen, Furunkel und vieles mehr, bei seiner Frau treten neben diversen Krankheiten wiederholt schwere Depressionen auf.
Immer wieder drohte der Verlust der Wohnung wegen Mietschulden, konnten Bäcker, Fleischer, Milchmann, Gastwirt nicht bezahlt werden, erst recht nicht Arztrechnungen beglichen oder Medikamente gekauft werden, standen Klagen und Pfändungen an, wurde alle Habe, selbst Kleidungsstücke, ins Pfandhaus gebracht.
Die schwierige Lage der Familie Marx soll nicht bestritten werden. Aber viele, zu Herzen gehende Details kennen wir nur aus den Briefen von Karl wie Jenny an Freunde und Verwandte, in denen sie Forderungen stellten oder um Mitleid heischten, es mit der Wahrheitsliebe nicht übertrieben und moralische Erpressungen nicht scheuten. Es gab immer wieder Besuche bei der Verwandtschaft in Trier und in Holland, um an Geld zu kommen; auch entfernte Verwandte wurden angegangen.
Marx lebte ständig über seine Verhältnisse. Mit etwa 200 £ im Jahr (ein Pfund entsprach damals ungefähr sieben Talern) hätte man in London auf dem Niveau der unteren Mittelklasse leben und besser wohnen können als in Soho. Als Marx ab 1852 gute, wenn auch schwankende Einnahmen durch seine Zeitungsartikel erzielte, hätte er, jedenfalls mit den immer wieder von Engels, aber auch von anderen erhaltenen Zuwendungen, zurechtkommen können. Es sollte der Eindruck sozialen Abstiegs (Jenny bezeichnete sich auf Visitenkarten als geborene ‹Baronesse von Westphalen›) vermieden, die Fassade der ‹Respektabilität› gewahrt werden. Neben ‹Lenchen› Demuth wurde ein Kindermädchen beschäftigt, Marx leistete sich in den ersten Jahren mit dem jungen Wilhelm Pieper einen ‹Sekretär›, obwohl der sich als wenig kompetent herausstellte. Ging eine größere Geldsumme ein, wurde auf großem Fuß gelebt. «Die Existenz des Marx besteht in Pendelschwingungen zwischen Champagner und Pfandhaus», beobachtete ein österreichischer Polizeispitzel 1859. Daran änderten auch mehrere große Erbschaften nichts: Ca. 280 £ für Jenny 1856 nach dem Tod eines Onkels und ihrer Mutter; ca. 580 £ für Karl 1864 nach dem Tod seiner Mutter (hinzuzurechnen sind ca. 400 £, die er in den drei Jahren zuvor von Onkel Lion Philips ausgezahlt bekommen hatte); im folgenden Jahr erhielt Marx 825 £ als Legat von Wilhelm Wolff (†9.5.1864), der seit 1853 in Manchester als Privatlehrer gearbeitet hatte. 1856 bezog man ein Haus im Nordosten Londons, 1864 ein größeres in der Nähe. Immer wieder liefen Schuldenberge auf, was nicht allein am Abtragen von Altlasten gelegen haben kann.
Engels als Finanzier
Engels war im Herbst 1850 in die Firma Ermen & Engels in Manchester eingetreten und vertrat dort mit Erfolg das Interesse seines Vaters gegenüber den Geschäftspartnern. Er begann als Angestellter mit ca. 100 £ plus Spesen, erhielt später eine Gewinnbeteiligung, so dass sein Einkommen kontinuierlich anstieg und um 1860 bei ca. 1000 £ lag. 1864 wurde er Teilhaber, ließ sich 1869/70 auszahlen und zog nach London um. Im ersten Jahrzehnt dürften sich die Zahlungen an Marx (anfangs auch heimlich aus der Firmenkasse) auf jährlich mindestens 50–60 £ belaufen haben, danach auf 200–300 £, gelegentlich mehr. Für die 1850er Jahre sind die Honorare für die Zeitungsartikel hinzuzurechnen, die Engels als ‹Ghostwriter› für Marx verfasst hat (S. 79). Als Engels aus der Firma ausschied, beglich er die Schulden von Marx (einige hundert Pfund) und setzte ihm eine Leibrente von jährlich 350 £ für die «gewöhnlichen, regelmäßigen Bedürfnisse» aus. Dass Engels nach heutigen Kategorien Multimillionär geworden war, verdankte er anscheinend nicht nur den Gewinnen aus einer florierenden, auf Strickgarne spezialisierten Fabrik, die um 1860 ca. 800 Arbeiter, davon 600 Frauen, beschäftigte, sondern auch privaten Börsengeschäften.
Die Geldzahlungen wurden in einem fast geschäftsmäßigen Ton abgesprochen. Der Dank von Marx war oft routiniert kurz. Gelegentlich hielt er es für angebracht, genauer darzulegen, welche unumgänglichen sozialen Verpflichtungen, widrigen Umstände oder bösartige Menschen seine Finanznot verursacht hatten.
Nur einmal ist eine größere Verstimmung erkennbar, als Marx zum Tod von Engels’ langjähriger Lebensgefährtin Mary Burns im Alter von 41 Jahren (6.1.1863) nur ein paar dürre Zeilen schrieb und sich anschließend ausführlich über seine Geldsorgen verbreitete. Als Engels tief gekränkt reagierte (dennoch auf Marx’ Problem einging), rang Marx sich nach einer ungewöhnlichen ‹Funkstille› von zehn Tagen einen Brief ab, den man bei gutem Willen als Entschuldigung deuten konnte. Engels war erleichtert, dass ihre Freundschaft keinen Schaden genommen hatte.
Marx und mehr noch seine Frau, die immer eine förmliche Distanz zum «lieben Herrn Engels» hielt, haben diese Abhängigkeit auch als bedrückend empfunden. Dies dürfte auch in Familienbriefen Ausdruck gefunden haben, die aber von den Marx-Töchtern vernichtet worden sind.
Einen Freundschaftsdienst der besonderen Art soll Engels geleistet haben, als ‹Lenchen› Demuth am 23. Juni 1851, knapp drei Monate nach der Geburt von Franziska Marx, einen Sohn zur Welt brachte. Er erhielt den Namen Frederick, im Geburtsregister wurde kein Vater eingetragen. Im Freundes- und Familienkreis wurde der Eindruck erweckt, Engels sei der Vater. Er hat vermutlich die Unterbringung in einer Pflegefamilie bezahlt. Drei Jahre nach Engels’ Tod hat dessen letzte Haushälterin August Bebel informiert, Engels habe ihr kurz vor seinem Tod enthüllt, das Kind sei von Marx. Als der genannte Brief 1962 publiziert wurde, wurde er von orthodoxer Seite als Fälschung abgetan. In Moskau in den 1930er Jahren gesammelte Zeugnisse zeigen, dass Bebel, Bernstein und auch Marx’ Tochter Eleanor die Angabe für glaubwürdig hielten, jedoch peinlich darauf bedacht waren, das Geheimnis zu bewahren. Diese Materialien sind bis zur ‹Wende› Ende des 20. Jahrhunderts unter Verschluss gehalten worden. Über die Beweiskraft dieser Indizien darf man weiter streiten. Bemerkenswert ist, dass die Sache so lange als Politikum behandelt wurde.
Die NRZ-Revue
Am 23. August 1849 schrieb Marx an Engels, sie könnten in London eine Zeitschrift herausgeben; ein Teil des benötigten Geldes sei schon beisammen. Welcher Art die Zusagen waren, ist unbekannt. Immerhin konnte 1850 die Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue, redigirt von Karl Marx (= NRZ-Revue) als Monatsschrift erscheinen. Bei der neuen Erscheinungsweise könne man nicht «Widerspiegelung der Tagesgeschichte» bieten, dafür «ein wissenschaftliches Eingehen in die ökonomischen Verhältnisse, welche die Grundlage der ganzen politischen Bewegung bilden».
Bis Ende Mai erschienen vier Hefte. Danach kam es zu einer Unterbrechung. Ende November 1850 wurde nochmals ein Doppelheft publiziert, dann musste die NRZ-Revue ihr Erscheinen einstellen. Von unwesentlichen Ausnahmen abgesehen, stammten die Texte sämtlich von Marx und Engels, die namentlich ausgewiesen wurden. Engels veröffentlichte hier seine ‹Reichsverfassungskampagne›.
Marx legte in den ersten drei Heften der NRZ-Revue unter dem Titel «1848 bis 1849» eine Analyse der französischen Entwicklung vor. Alle wichtigen Etappen seien unter die Überschrift «Niederlage der Revolution!» zu stellen, doch werde sich gerade daraus eine «wirklich revolutionäre Partei» entwickeln. Mit der Februarrevolution 1848 war die Macht der Finanzaristokratie gebrochen. Danach kam eine breite Koalition von der industriellen Bourgeoisie über das Kleinbürgertum bis zu den Arbeitern an die Macht. Die mit der Beschwörung der ‹Brüderlichkeit› zugekleisterten Klassengegensätze brachen auf, als das Bürgertum nicht mehr bereit war, die Nationalwerkstätten zu finanzieren. Der gescheiterte Arbeiteraufstand Ende Juni 1848 war die erste große Schlacht zwischen Arbeit und Kapital. Danach kam es zum Bruch zwischen der republikanischen Fraktion der Bourgeoisie und dem Kleinbürgertum aus Kleinhändlern und Handwerkern, dessen Forderungen unerfüllt blieben. Mit der Wahl von Louis Bonaparte zum Staatspräsidenten (10. Dezember 1848), mit der sich erstmals die vom allgemeinen Wahlrecht profitierenden Bauern als politischer Faktor geltend machten, verlor das republikanische Bürgertum seine Machtbasis. Es fusionierte deshalb mit den royalistischen Fraktionen im Frühjahr 1849 zur «Partei der Ordnung», dem ein neues Bündnis aus enttäuschten Kleinbürgern, Bauern und Proletariat gegenüberstand, das im Juni an der legalistischen Haltung der Montagne scheiterte. Seitdem haben sich das desillusionierte Proletariat und Teile des Kleinbürgertums so radikalisiert, dass sie unter Führung der Kommunisten zu einer neuen Revolution bereit sind, die nicht nur die Veränderung der Staatsform, sondern die Umwälzung der Gesellschaftsordnung bringen werde. «Die Klassendiktatur des Proletariats» ist der «notwendige Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenverhältnisse überhaupt». (Mehr wird dazu nicht gesagt, auch nicht an anderen Stellen. Das änderte sich auch nicht, als Marx ein Vierteljahrhundert später darauf zurückkam; S. 112f.).
Marx thematisiert den Zusammenhang zwischen Klasseninteressen, Parteibildungen, Verfassungs-, Steuer- und Wirtschaftspolitik in einer Weise, wie dies wohl kein anderer Zeitgenosse gemacht hat. Des Problems, objektive Klassenlagen mit Fraktionsbildungen und der Eigendynamik politischer Kämpfe zu vermitteln, ist er sich bewusst; dennoch werden Klassen im Prinzip als Akteure verstanden, die ‹notwendig› gemäß ihren Interessen handeln oder es jedenfalls dann tun (werden), wenn sie sich ihrer Illusionen entledigt haben.
Engels hat den Text 1895 neu herausgegeben und um einen kurzen Abschnitt aus dem letzten Heft der NRZ-Revue erweitert, in dem Marx die Revolutionserwartung an den Ausbruch einer großen Wirtschaftskrise geknüpft hatte. Diese Neuausgabe bekam den ‹knackigen› Titel Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848–1850. Engels erklärt den Text aus den Entstehungsbedingungen und demonstriert zugleich seine Aktualität. Der erste Versuch einer materialistischen Analyse von Zeitgeschichte habe nicht zu den letzten ökonomischen Ursachen durchdringen können, die nur aus größerer Distanz zu analysieren seien. Die Revolutionen 1848/49 seien an ihrer Fixierung auf die Wiederholung der Großen Französischen Revolution gescheitert; das Proletariat habe sich in Barrikadenkämpfe treiben lassen, die es nicht gewinnen konnte. In der Gegenwart sei diese Art des Aufstands ohne jede Chance. Inzwischen habe das allgemeine Wahlrecht die Chance auf einen legalen Machtgewinn eröffnet; man lasse sich aber das Recht auf Revolution angesichts der Staatsstreichdrohungen von oben nicht nehmen. Da dies der letzte größere Text von Engels war, entbrannte sofort der Streit, ob sein ‹politisches Testament› Absage an die Revolution sei oder nicht.
Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte
Neue Publikationsmöglichkeiten taten sich für Marx auf, als Weydemeyer Ende 1851 nach Amerika auswanderte. Er wollte in New York eine Wochenzeitung, Die Revolution, herausgeben. Angekündigt wurden Artikel von Marx zum Staatsstreich von Louis Bonapar...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Zum Buch
- Über den Autor
- Inhalt
- I. Einleitung
- II. Der junge Marx
- III. Die erste Station im Exil: Paris
- IV. Die zweite Station im Exil: Brüssel
- V. Im Revolutionsjahr 1848/49
- VI. London – Das Elend des Exils
- VII. Neustart in London
- VIII. Politiker hinter den Kulissen
- IX. Ein unvollendetes Hauptwerk
- X. Der Urmarxismus
- Literatur
- Impressum
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Karl Marx von Wilfried Nippel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Historische Biographien. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.