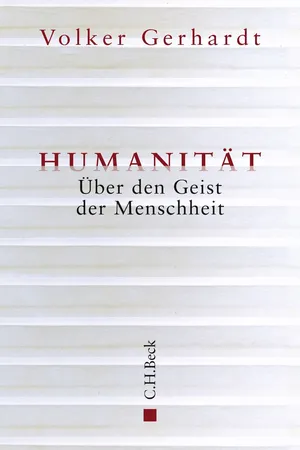![]()
Kapitel 1
PhilanthropieIm Menschen die Menschheit lieben
«Die Philanthropie ist aller Menschen
Pflicht gegen einander, man mag diese
nun liebenswürdig finden oder nicht.»
(Kant, Tugendlehre § 27)
1. Den Menschen lieben wie sich selbst. Die Menschen, so heißt es bei Jean Paul, «soll keiner belachen als einer, der sie recht herzlich liebt».[1] Die Wahrheit dieser ironischen Einsicht liegt darin, dass sie auch für die ernste Beschäftigung mit den Menschen gilt: Zumindest in einer philosophischen Betrachtung kommt man nicht umhin, den Menschen, wenn nicht zu lieben, dann doch wenigstens zu schätzen – gerade auch dann, wenn man ihn verstehen, ihm raten und auch verzeihen will.
Der Grund liegt auf der Hand: Man erkennt und beurteilt keinen Menschen unabhängig davon, wie man sich selbst versteht. Also kann das, was über den Menschen im Allgemeinen zu sagen ist, nicht unabhängig von dem sein, was man im Besonderen von sich selbst als Mensch zu wissen glaubt. Und ohne Selbstschätzung kann man auch den Wert, den andere haben, nicht würdigen.
Dass dies nicht ohne Anteilnahme möglich ist, wird niemand bestreiten wollen. Die muss man nicht als «herzliche Liebe» bezeichnen. Aber man kann, auch ohne über Jean Pauls romantische Begabung zu verfügen, feststellen, dass ein Verständnis des Menschen, bei allem Befremden, das unvermeidlich ist, nicht ohne eine von Sympathie getragene Nähe möglich ist.
Dass dabei äußere Bindungen, die der Verstand zu beurteilen hat, eine Rolle spielen, versteht sich von selbst. Kein Mensch kann ohne den Beistand anderer Menschen leben; und die Gesamtheit aller Menschen kann nur bestehen, solange es Individuen gibt, die ihr Leben mit ihrer Erkenntnis, ihrem Verständnis und ihrer Einsicht so führen, dass sie von anderen Menschen verstanden werden. Und solange es um Erkenntnis und Verständnis geht, kommt es, so unwahrscheinlich es klingt und so wenig sich das Leben, die Geschichte und die Gesellschaft darum auch zu kümmern scheinen, auf jeden Einzelnen an!
Das aber ist nicht nur eine Frage des Erkennens. Die Notwendigkeit von Zuneigung, Zugehörigkeit und Vertrauen, damit auch der Wunsch nach emotionaler Nähe, lassen sich nicht leugnen. Doch auch Abneigung ist eine Realität. Sie kann mit der Furcht beginnen und in Hass und Verachtung münden, die uns verständlich machen, warum es auch Gleichgültigkeit geben und Toleranz als Errungenschaft begriffen werden kann.
Ich gestehe, dass es mir persönlich alles andere als leichtfällt, Jean Pauls ironische Bemerkung ernsthaft und nachdrücklich auf die – vornehmlich ja Distanz erfordernde – theoretische Annäherung an den Menschen zu übertragen. Kann denn der Mensch, der Kriege führt, der seinesgleichen bedrängt, belästigt, quält, vertreibt, unterdrückt und tötet, der als einziges Lebewesen auf der Erde in der Lage ist, absichtlich Böses zu tun, so dass Begriffe wie die des Lügners, des Treulosen, des Schänders, des Verräters oder des Verbrechers nur auf ihn anzuwenden sind, überhaupt ein Gegenstand sympathetischer Betrachtung sein?
Die Frage verschärft sich, wenn wir bedenken, dass kein anderes Wesen auf der Welt sich den Titel eines «Ungeheuers» so sehr verdient wie der Mensch. Das Urteil des Sophokles[2] wird durch nichts abgeschwächt, was in den zweitausendfünfhundert Jahren, seit es erstmals auf einer Bühne in Athen gesprochen wurde, bis heute geschehen ist. Weder einem anderen Tier noch einem Gott noch den wie immer beschaffenen «Umständen» ist auch nur die geringste Mitschuld an den Bosheiten anzulasten, die seit dem Anfang der Menschengeschichte begangen wurden und unablässig weiter begangen werden. Und da wir von einem Teufel nichts wissen, muss allein der Mensch als Urheber alles Bösen angesehen werden. Hinzu kommt die fehlende Hoffnung darauf, dass es jemals anders werden könne. Für Kant, dem wir das Motto über diesem ersten Kapitel verdanken, war die «Kürze des Lebens» die dankbar empfundene Bedingung dafür, es darin überhaupt auszuhalten![3]
Wie kann man unter diesen Bedingungen überhaupt von «Liebe» sprechen? Gesetzt, wir wüssten es wirklich nicht, empfehle ich, einfach jene zu fragen, die Liebe entweder in ihrer Kindheit erfahren haben oder die das Glück hatten oder haben, in Liebe zu leben – vor allen aber auch jene, die sich nach Liebe sehnen. Zu den Antworten, die man erwarten kann, dürfte der Hinweis auf das Gefühl gehören, von seinesgleichen (gerade auch in den eigenen Schwächen) verstanden und angenommen zu werden sowie in einer Bindung gleichwohl frei und zufrieden, ja sicher, glücklich und voller Hoffnung zu sein. Wer wollte bestreiten, dass es dies, zumindest als Hoffnung, tatsächlich gibt?
«Tatsächlich Liebe»[4] ist der treffende Titel eines Films, der in spektakulärer Vielfalt das Verlangen der Menschen nach Nähe derart heiter und mitfühlend illustriert, dass man in so gut wie in allen Fällen die Brüchigkeit, den Leichtsinn, die Flüchtigkeit oder die falschen Erwartungen erkennt, die hier die Menschen von «Liebe» sprechen lassen. Man könnte meinen, der Film sei darauf angelegt, seinen Titel zu widerlegen. Doch er zeigt nur die Vielfalt der real gelebten Liebe.
Tatsächlich ist im Leben der Menschen von wenig anderem mehr die Rede als von der Liebe – von der, die man sich wünscht, von der, die man als großes Glück empfindet und die folglich «niemals» missen möchte, und von der, die man verloren hat – sei es durch wechselseitige Enttäuschung, innere Entfremdung, Treulosigkeit oder durch Tod.
Vor diesem Hintergrund erscheint es weniger abwegig, von der Liebe zum Menschen zu sprechen. Denn die Liebe hat auch in der Suche nach dem einen Partner oder nach dem Kreis von Freunden, zu denen man sich hingezogen fühlt und denen man vertraut, etwas durchaus Unwahrscheinliches, Seltenes und rasch wieder Vergängliches; sie ist rar und kostbar; auch deshalb wird sie so beharrlich mit dem Glück assoziiert.
Wenn von Liebe die Rede ist, muss sie nicht notwendig auf das singuläre Paar, die Familie oder den Kreis der verlässlichen Freunde bezogen sein. In der Tradition des Begriffs ist das schon seit der Antike so, auch wenn hier unterschiedliche Termini verwendet werden. Doch so richtig es ist, zwischen eros und agápe, zwischen amor, caritas oder ardor zu unterscheiden, so gut begründet ist zugleich, dass im Deutschen alles mit dem einen Begriff der Liebe benannt werden kann.
Wir werden im Folgenden Gründe für dieses weite Verständnis des einen Worts benennen. Vorab ist nur daran zu erinnern, dass Liebe in ihrem hochindividualisierten Verständnis nicht frei von Erkenntnis vorgestellt werden muss. Zwar kommt es vor, dass man sich «Hals über Kopf» oder «Herz über Kopf» verliebt. Aber ob das gänzlich ahnungslos, ohne Selbstkenntnis und frei von Kriterien geschieht, sei dahingestellt. Zu wünschen ist in jedem Fall, dass auch die Verliebten wissen, was sie tun. Und je größer der Bereich jener ist, denen man sich in Liebe zuwendet, umso größer ist der Anteil der erklärten Gründe, die man für sein Verhalten aufbieten kann.
Dafür steht die Nächstenliebe, die auch dort, wo sie aus Neigung, spontanem Mitgefühl oder ernsthaft angenommener Gesinnung praktiziert wird, immer wieder mit Einwänden und Bedenken zu tun haben wird, gegen die sie sich zur Wehr zu setzen hat. Der Liebe zum Menschen aber stehen so viele innere und äußere Widerstände entgegen, dass man hier, um es deutlich zu sagen, die besten Gründe braucht, um daran festzuhalten. Diese Gründe sind nicht zuletzt so anspruchsvoll, weil sie sich nur in eindringender Selbstkenntnis erschließen und sich allein in dem Bewusstsein festigen können, dass sich Mensch und Menschheit nicht trennen lassen.
2. Selbst- und Nächstenliebe bilden eine Einheit. Obgleich in der Geschichte der Ethik von Cicero bis Nietzsche immer wieder Argumente vorgetragen wurden, die es verbieten sollten, Egoismus und Altruismus als Gegensätze zu behandeln, herrscht im alltäglichen Urteil wie auch in öffentlichen Debatten die Neigung vor, in beiden eine Art ewiger Alternative auszumachen. Das kann und muss man verstehen, wenn man mit den individuellen und kollektiven Erscheinungsformen des persönlichen, ökonomischen und politischen Egoismus zu tun hat. Und wenn man ihn den nur zu oft von jedem Realitätssinn verlassenen altruistischen Meinungsäußerungen gegenüberstellt, dann scheinen sich Egoismus und Altruismus tatsächlich wechselseitig auszuschließen.
Blickt man hingegen auf die Entwicklung einzelner Individuen und stellt sie in Relation zu dem, was wir überhaupt über den Umgang mit Neugeborenen, heranreifenden Kindern und Jugendlichen sagen können, wird man das allgemeine Urteil nicht zurückhalten können, dass ohne den Altruismus der Eltern und ohne den Egoismus ihrer Schützlinge gar nichts geht. Gewiss treten die mit den Begriffen bezeichneten Verhaltensweisen nur selten in Reinform auf; aber durchschnittlich wird sich der Eindruck rechtfertigen lassen, dass es des Gegensatzes zwischen der Sorge für den Anderen und dem opponierenden Eigensinn bedarf, um nicht nur Entwicklung und Erziehung, sondern produktives Leben überhaupt gelingen zu lassen.
Dabei darf man nicht vergessen, dass die gesellschaftliche Rollenerwartung beide Seiten für ihr Verhalten kompensatorisch belohnt: Gute Eltern können, wenn ihre Mühe nicht umsonst ist, auch ihren Egoismus als Eltern belohnt sehen; und gute Kinder haben viele Chancen, in der Liebe zu den Eltern, im Teilen mit den Geschwistern sowie in der Verlässlichkeit gegenüber ihren Freunden Altruismus einzuüben. Von einem diametralen Gegensatz zwischen Fremd- und Selbstliebe kann unter den notwendig sozialen Konditionen des Lebens, vor allem mit Blick auf die Generationenfolge und die Notwendigkeit der Kooperation keine Rede sein.
Es ist nicht überzogen, das so allgemein zu formulieren. Denn Egoismen und Altruismen können sich in Abhängigkeit von jeweiligen Funktionen und Konventionen durchaus bei ein und derselben Person vereinigt finden. Die sich für ihre Kinder aufopfernden Eltern können als Geschäftsleute kompromisslos auf ihren Vorteil bedacht sein. Außerdem kommen Egoismus und Altruismus, wenn man sie überhaupt so nennen kann, in vielen Varianten auch bei anderen Lebewesen vor. Es gibt das Selbstopfer für die eigene Brut: ein Akt, in dem der individuelle «Altruismus» mit einem gattungsspezifischen «Egoismus» zusammenfällt. Es gibt Parasiten, die ihre ganze Existenz in den Dienst ihrer Wirtstiere stellen und dabei dennoch nur ihren eigenen Vorteil verfolgen. Sieht man sie bei der Arbeit (wie etwa die Fische, die den Nilpferden die Zähne «putzen»), kann man von ihrer Hingabe an ihre Aufgabe nur beeindruckt sein.
3. Darwin als Philanthrop. Man darf es als einen wissenschaftsgeschichtlich und philosophisch exemplarischen Akt ansehen, dass der von manchen noch...