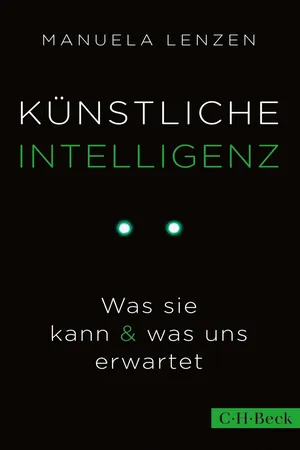Künstliche Intelligenz ist in. Es ist ein Etikett, das Maschinen interessant macht und gerne und inflationär auf vielerlei geklebt wird, ob Autos, Suchmaschinen oder Onlineshops. Noch inflationärer wird das Wörtchen «smart» gebraucht: Handys sind schon lange smart, und glaubt man der Werbung, gilt das auch für Kameras und Kühlschränke, Feuermelder, Staubsauger und Fernseher, Zahnbürsten, Armreifen, Toiletten und Bettlaken. Künstliche Intelligenz, so scheint es, ist überall. Aber was bedeuten die beiden Wörter überhaupt?
Optimistische Anfänge, diverse Winter und ein neuer Boom
Anfang September 1955 reichte der 28-jährige John McCarthy, damals Assistenzprofessor für Mathematik am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, zusammen mit drei Kollegen bei der Rockefeller-Stiftung einen Antrag zur Förderung eines ambitionierten Projekts ein:[1] Zehn ausgewählte Forscher sollten im Sommer 1956 zwei Monate lang herauszufinden versuchen, «wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen und Begriffe zu bilden, Probleme zu lösen, die zu lösen bislang dem Menschen vorbehalten sind, und sich selbst zu verbessern». Dieses Projekt nannte er «Artificial Intelligence», Künstliche Intelligenz.
Die «Dartmouth-Konferenz» gilt heute als Startschuss der KI-Forschung. Tatsächlich steckten die Forscher damals schon mittendrin, nur ein griffiger Name hatte dem Projekt bislang gefehlt. Viele, die heute zu den Gründervätern der KI zählen, waren damals dabei: Warren McCulloch, der schon 1943 zusammen mit Walter Pitts in Anlehnung an die Architektur des menschlichen Gehirns erste künstliche neuronale Netze entworfen hatte; Allen Newell und Herbert Simon, die ihr Programm «Logical Theorist» präsentierten, das logische Theoreme beweisen konnte. Zwei Monate später stellte der Linguist Noam Chomsky auf einer Tagung am Massachusetts Institute of Technology seine Theorie der Sprache vor, der zufolge ein unbewusst bleibendes Regelsystem es Sprechern ermöglicht, immer neue Sätze zu bilden. Sollte man diese Regeln nicht auch einer Maschine beibringen können?
Die Computertechnik war in den 1950er Jahren gerade dabei, von Röhren auf Transistoren umzusteigen, erste Firmen wie die US-amerikanischen Bell Labs und die deutsche Firma Siemens begannen, kleiderschrankgroße Rechner in Serie zu bauen. Trotz ihrer aus heutiger Sicht bescheidenen Rechenkapazität – UNIVAC I, der erste in den USA für den Markt produzierte Computer, schaffte knapp 2000 Rechenoperationen in der Sekunde – kannte der Optimismus der jungen Forscher kaum Grenzen: Das Problem sei nicht die Leistungsfähigkeit der Maschinen, sondern «unsere Unfähigkeit, Programme zu schreiben, die das Beste aus dem machen, was wir haben», hieß es in McCarthys Forschungsantrag. Eine Maschine zu programmieren, die aus Versuch und Irrtum lernen könne, sei nicht schwierig. Er selbst sei zuversichtlich, bis zum Sommer 1956 eine Maschine, die ein Modell ihrer Umwelt entwickeln und Probleme durch Experimente mit diesem Modell lösen könne, so weit zu haben, dass man sie programmieren könne.[2]
Die großen Fortschritte kamen, wenn auch deutlich später als erwartet. Erst in den letzten Jahren zeichnet sich ab, dass und wie sich einige der kühnen Ideen des legendären Dartmouth-Sommers verwirklichen lassen. Eine Maschine, mit der man sprechen kann, trägt heute jeder in der Tasche herum, lernende Programme können selbstständig Muster in großen Datenmengen erkennen, schon das Navigationsgerät im Auto löst ein alles andere als triviales Problem – wie komme ich am besten von A nach B? –, und in Ansätzen können Programme sich auch selbst verbessern. John McCarthy, der 2011 starb, hat unter anderem mit der Entwicklung der Programmiersprache Lisp viel dazu beigetragen.
Künstliche Intelligenz: Diese beiden Wörter stehen heute für ein weites, interdisziplinäres und wenig übersichtliches Gebiet, auf dem Forscher mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen und Methoden daran arbeiten, Systeme zu entwickeln, die Dinge können, wie McCarthy sie aufzählte: Sprache verwenden, Begriffe bilden, Probleme lösen. Künstliche Intelligenz, so heißt es bisweilen flapsig, das ist, Maschinen zu bauen, die können, was die Maschinen in den Science-Fiction können.
Zu den Teilgebieten der KI gehört die Sprachverarbeitung ebenso wie die Darstellung von Wissen in Datenverarbeitungssystemen, automatisches Schlussfolgern, Wahrnehmung und Bildanalyse, die Robotik und diejenige Disziplin, die aktuell am meisten von sich reden macht, die Geschichte der KI jedoch von Beginn an begleitet hat: das maschinelle Lernen.
Die KI-Forschung baut auf Arbeiten vieler Disziplinen auf, vor allem natürlich auf der Informatik: Künstliche Intelligenz ist die Suche nach Computer- und/oder Roboterintelligenz. Andere Möglichkeiten, intelligente Leistungen künstlich zu realisieren, sind bislang nicht bekannt. Die Psychologie steuert Erkenntnisse zu zwischenmenschlicher Interaktion, Lernen und Wahrnehmen bei. Aus der Logik kommen Einsichten in die Struktur von Aussagen, aus der Philosophie Überlegungen, wie Begriffe Bedeutung bekommen oder wie Geist und Materie zusammenhängen. Hinzu kommen mathematische Arbeiten, die elementare Konzepte wie Berechenbarkeit, Algorithmus und Wahrscheinlichkeit definieren, entscheidungs- und spieltheoretische Überlegungen aus der Ökonomie, Erkenntnisse der Neurowissenschaft über das Funktionieren des Gehirns, Einsichten aus der Sprachwissenschaft, der Pädagogik und der Ethnologie sowie, für den Bau der Roboter, der unerschöpfliche Pool biologischer Vorbilder für Körperbau, Sinnesorgane und Gliedmaßen bei Mensch und Tier.
Zeitgleich mit der KI entstand die ebenfalls interdisziplinär ausgerichtete und größtenteils auf dieselben Disziplinen zurückgreifende Kognitionswissenschaft. Im Vergleich zur KI kehrt sie die Perspektive um: Statt sich am Menschen zu inspirieren, um Computer besser zu machen, bedient sie sich – unter anderem – der Computer, um besser zu verstehen, wie die menschliche Kognition funktioniert. Beide Gebiete, KI wie Kognitionswissenschaft, führen das jeweils andere als Teilgebiet des eigenen Unternehmens. Die parallele Entstehung beider Disziplinen zeigt: Der Computer weckte von Anfang an nicht nur die Hoffnung auf intelligente Maschinen, sondern auch auf ein neues, besseres Verständnis von Intelligenz überhaupt.
Bis heute prägt ein Auf und Ab zwischen Phasen der Euphorie und Phasen der Ernüchterung die Geschichte der KI. Mitte der 1950er Jahre schien alles möglich und zum Greifen nahe. Doch die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten: Erste Programme zum automatischen Übersetzen zwischen Englisch und Russisch, die sich die US-Armee im Kalten Krieg gewünscht hatte, scheiterten an der Komplexität der Aufgabe, autonome Panzer ließen sich nicht realisieren, erste lernende Systeme auf der Basis künstlicher neuronaler Netze zeigten gravierende Mängel. Nachdem Kommissionen von staatlicher wie von militärischer Seite zu dem Schluss gekommen waren, die vollmundigen Ankündigungen der Forscher würden sich nicht realisieren lassen, fuhr die DARPA, die Forschungsabteilung des US-Militärs, die die KI-Forschung in ihren Anfängen massiv und ohne große Vorgaben gefördert hatte, ihre Zahlungen mehrmals zurück. Ende der 1970er und Ende der 1980er Jahre kam es so zu Einbrüchen in der KI-Forschung, die heute als «KI-Winter» bezeichnet werden. Auch in diesen frostigen Zeiten wurde freilich weitergeforscht und -entwickelt. Im Schatten des Scheiterns zu groß angekündigter Projekte wurden die Grundlagen des aktuellen Hypes gelegt. Denn zurzeit, man kann es kaum anders sagen, herrscht in der KI ein Sommer mit nie da gewesenen Höchsttemperaturen.
Wer blufft, gewinnt: der Turing-Test
Nicht jedes Gerät mit einem Prozessor oder einem Internetanschluss ist intelligent. Digitalisierung und Datenverarbeitung, die Erfassung von Informationen in digitaler, also computerlesbarer Form und ihre Verarbeitung sind noch keine Künstliche Intelligenz. Aber wann ist eine Maschine intelligent? Die berühmteste Antwort auf diese Frage gab 1950 der britische Mathematiker Alan Turing. Er erklärte sie zu einer Frage des Sprachgebrauchs und für zu belanglos, um sie überhaupt zu diskutieren. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, so seine Prognose, werde man sich schlicht daran gewöhnt haben, von denkenden Maschinen zu sprechen. Deshalb schlug er vor, die Frage «Kann eine Maschine denken?» durch die Frage zu ersetzen, ob eine Maschine sich in einem Spiel bewähren könne, das er «Imitationsspiel» nannte. Ein Mensch kommuniziert dabei so, dass er seine Gesprächspartner nicht hören oder sehen kann, mit einem Menschen und einer Maschine. Seine Aufgabe besteht darin, durch Fragen herauszufinden, wer von beiden der Mensch, wer die Maschine ist. Dieses Imitationsspiel ist heute als «Turing-Test» bekannt. Halten 30 Prozent der durchschnittlichen Anwender den Computer nach einer Fragezeit von fünf Minuten für einen Menschen, sollte der Test als bestanden gelten.
Die Vorteile dieses Verfahrens liegen auf der Hand: Eine klare Aufgabe tritt an die Stelle einer Definition, die mit dem notorisch unklaren Begriff des Denkens arbeiten müsste oder mit einer ebenso notorisch umstrittenen Liste, welche Fähigkeiten denn nötig seien, damit ein System als intelligent gelten kann. Das Aussehen des Gegenübers spielt keine Rolle. Zudem ist der Test anspruchsvoll: Ein System, das ihn bestehen kann, muss Sprache verarbeiten können und Weltwissen besitzen, es muss speichern können, was es schon gesagt hat, und sich am besten auch auf den Fragenden einstellen können.
Doch ist dieser Test überzeugend? Zuerst einmal funktioniert er nur bei Systemen, mit denen man einen Dialog führen kann. Das Programm, das Lee Sedol im Go-Spiel besiegte, käme nicht infrage, weil man sich mit ihm nicht unterhalten kann. Auch autonome Autos, die zu den am weitesten fortgeschrittenen Produkten der KI-Forschung gehören, blieben außen vor.
Taugt dieser Test zumindest für dialogfähige Systeme? Turing hatte ausdrücklich betont, in den zu führenden Dialogen seien alle Tricks und Kniffe erlaubt. Schon zwei der ersten Dialogsysteme überhaupt machten sich dies zunutze: ELIZA, das der Computerpionier und -kritiker Joseph Weizenbaum 1966 vorstellte, mimte einen Psychotherapeuten, der ein Vorgespräch mit einem angehenden Patienten führt. Die mit ihm kommunizierenden Menschen waren schnell bereit, seltsam stereotype und zusammenhanglose Äußerungen – «Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie Hilfe bekämen?», «Erzählen Sie mir von Ihrer Mutter!» – der besonderen Gesprächssituation zuzurechnen. Hielten sich die Versuchspersonen daran, nur über sich zu sprechen und keine Fragen zu anderen Themenbereichen zu stellen, machte das Programm großen Eindruck. Dabei betreibt ELIZA nur eine rudimentäre Analyse der eingegebenen Sätze. Sie vergleicht sie mit vorgegebenen Musterbeispielen und ergänzt diese um Schlüsselwörter. Fällt das Wort «Vater», sagt ELIZA: «Erzählen Sie mehr von Ihrem Vater», fällt das Wort «Mutter», setzt das Programm «Mutter» ein. Sonst behilft es sich mit Floskeln wie «Warum glauben Sie das?» oder «Erzählen Sie mir mehr darüber!». In einem interessanten Sinne intelligent ist das Programm nicht. PARRY, ein Programm, das der Psychiater Kenneth Colby 1975 vorstellte, mimte einen paranoiden Patienten. Viele Psychiater, die mit dem System kommunizierten, sahen sich nicht in der Lage, den simulierten von einem echten Patienten zu unterscheiden.
2014 veranstalteten Forscher der Universität im britischen Reading aus Anlass von Alan Turings 60.Todestag einen Turing-Test. Dabei gelang es einem Programm namens «Eugene Goostman» 33 Prozent der Juroren davon zu überzeugen, dass sie es mit einem menschlichen Gesprächspartner zu tun haben. Auch «Eugene Goostman» bedient sich eines Tricks: Das System behauptet, ein 13-jähriger Junge aus der Ukraine zu sein, der nur schlecht Englisch spricht. Dies brachte die Juroren dazu, Fehler in der Grammatik, mangelndes Wissen in vielen Bereichen und seine Neigung, immer wieder das Thema zu wechseln, zu entschuldigen. Wegen solcher Strategien haben Kritiker aber immer wieder angemerkt, beim Turing-Test gehe es weniger darum, ein intelligentes System zu bauen, als eines, das den Menschen möglichst effektiv in die Irre führt.
Seit Turing sind viele Modifikationen seines Tests vorgeschlagen worden: Um als intelligent zu gelten, müsse ein System Fragen beantworten, die inhaltliches Verständnis voraussetzen und nicht durch Statistik erledigt werden können, etwa: Kann ein Krokodil Hürdenlaufen?[3] Es solle zusammen mit einem Menschen eine Fernsehsendung ansehen und dann dazu Fragen beantworten, es müsse an philosophischen Debatten teilnehmen oder Menschen zum Lachen bringen, es müsse lernen, ein neues Videospiel zu spielen oder gleich eine ganze Olympiade aus unterschiedlichen Herausforderungen, darunter Bilderkennung und Sprachverstehen, bewältigen. Seit 1990 können Dialogsysteme um den Loebner-Preis konkurrieren. Der von dem Soziologen und Millionär Hugh G. Loebner gestiftete Preis wird in drei Kategorien ausgelobt. Der bronzene Preis für das Programm, das sich am besten schlägt, wird in jedem Jahr vergeben, der silberne Preis winkt für das Bestehen des klassischen Turing-Tests, der goldene für eine erweiterte Version. Die beiden Letzteren wurden bislang nicht vergeben. Trotz beeindruckender Fortschritte in den letzten Jahren gibt es bis heute kein Dialogsystem, das Menschen, ohne sich besonderer Tricks zu bedienen, längere Zeit in die Irre führen ...