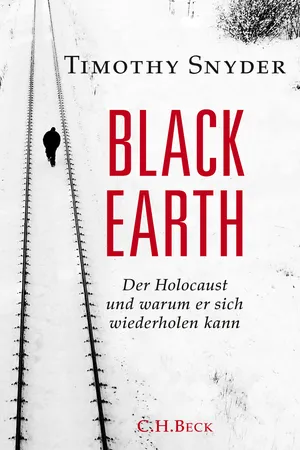![]()
Kapitel 1
LEBENSRAUM
Obwohl Hitler der Ansicht war, Menschen seien nichts weiter als Tiere, gelang es ihm dank seiner nur dem Menschen gegebenen Vorstellungskraft, seine zoologische Theorie in eine politische Ideologie zu verwandeln. Der Kampf ums Überleben der Rasse war demzufolge auch ein deutsches Ringen um Würde, und dem stand nicht nur die Biologie im Wege, sondern auch die Briten. Hitler war klar, dass die Deutschen im täglichen Leben nicht wie Tiere waren, die ihr Essen vom Boden zusammenscharrten. Als er seine Überlegungen 1928 im Zweiten Buch festhielt, erklärte er, eine gesicherte Lebensmittelversorgung sei nicht bloß eine Frage des physischen Überlebens, sondern auch eine Voraussetzung für das Gefühl von Souveränität. Die Seeblockade der Briten im Ersten Weltkrieg war nach Ansicht Hitlers nicht nur deshalb zum Problem geworden, weil sie während der Kampfhandlungen und in den Monaten zwischen dem Waffenstillstand und der Kapitulation Krankheiten und viele Opfer zur Folge gehabt hatte. Die Blockade hatte die deutsche Mittelschicht gezwungen, Gesetze zu brechen, um an die Lebensmittel zu gelangen, die sie benötigte oder zu brauchen meinte. Das hatte ihre Sicherheit und ihr Vertrauen in die Obrigkeit erschüttert.
In den 1920er und 1930er Jahren war die weltpolitische Ökonomie in Hitlers Augen von der britischen Seemacht geprägt. Hitler glaubte, dass die Briten für den Freihandel eintraten, um damit ihr Streben nach der Weltmacht zu kaschieren. Für sie war es sinnvoll, die Fiktion aufrechtzuerhalten, wonach Freihandel Zugang zu Nahrung für alle bedeute, denn dieser Glaube würde andere davon abhalten, mit den Briten um die Vorherrschaft zur See zu konkurrieren. Tatsächlich aber konnten einzig die Briten in einer Krisensituation ihren Zugang zu den Nahrungsressourcen verteidigen und auf demselben Wege anderen den Zugriff darauf verwehren. Die Briten verhängten also im Krieg die Blockade gegen ihre Gegner – im offensichtlichen Widerspruch zu ihrer eigenen Ideologie des Freihandels. Die Fähigkeit, über Nahrungsressourcen zu verfügen oder sie zu verweigern, so betonte Hitler, war eine Form von Macht. Hitler bezeichnete die Tatsache, dass niemand außer den Briten Versorgungssicherheit hatte, als «friedliche[n] Kampf der Wirtschaft».
Hitler wusste, dass sich Deutschland in den 1920er und 1930er Jahren nicht von den Erzeugnissen des eigenen Territoriums ernährte, er wusste aber auch, dass die Deutschen nicht verhungert wären, wenn sie es versucht hätten. Deutschland hätte genügend Kalorien produzieren können, um seine Bevölkerung von Produkten zu ernähren, die in Deutschland erzeugt wurden, aber dafür hätte es Teile seiner Industrie, seiner Exporte und Deviseneinnahmen opfern müssen. Deutschlands Wohlstand hing vom Austausch mit dem britischen Empire ab, aber Hitler meinte, diese Struktur von Handelsbeziehungen könnte durch die Eroberung eines Imperiums auf dem Kontinent ergänzt werden, was London und Berlin auf eine Stufe stellen würde. Sobald es geeignete Kolonien erworben hätte, würde Deutschland seine industrielle Leistungsfähigkeit beibehalten und gleichzeitig die Nahrungsmittelabhängigkeit von britisch kontrollierten Seewegen auf das eigene imperiale Hinterland verlagern können. Ein hinreichend großes deutsches Imperium konnte sich selbst versorgen, eine «autarke Wirtschaft» werden. Hitler verklärte den deutschen Bauern nicht zum friedlichen Ackermann, sondern zum heroischen Bezwinger ferner Länder.
Die Briten musste man als «Rassenverwandte» und Erschaffer eines riesigen Imperiums respektieren. Der Plan war, durch das Netzwerk ihrer Macht zu lavieren, ohne eine Reaktion zu provozieren. Hitler glaubte, anderen Land wegzunehmen würde keinerlei Bedrohung für diese große Seemacht darstellen. Langfristig ging er von einem Frieden mit Großbritannien «auf der Grundlage der Aufteilung der Welt» aus. Er erwartete, dass Deutschland eine Weltmacht werden, ein «Entscheidungskampf mit England» aber vermieden werden könnte. Das war für ihn ein beruhigender Gedanke.
Beruhigend war auch, dass eine solche Veränderung der Weltordnung schon einmal gelungen und die Erinnerung daran noch präsent war. Für Generationen deutscher Imperialisten wie auch für Hitler selbst gab es ein Vorbild für die Kolonialisierung großer Landmassen: die Vereinigten Staaten von Amerika.
Amerika war für Hitler das lehrreiche Beispiel dafür, dass sich Bedürfnisse in Begehrlichkeiten verwandelten und diese Begehrlichkeiten aus dem Vergleich entstanden. Die Deutschen waren nicht nur Tiere, die Nahrung suchten, um zu überleben, und auch nicht nur eine Gesellschaft, die in einer unvorhersehbaren, britisch dominierten Weltwirtschaft nach Sicherheit strebte. Familien schauten auf andere Familien, bei den Nachbarn, aber dank der modernen Medien auch überall auf der Welt. Vorstellungen davon, wie man leben soll oder muss, entziehen sich Bezugsgrößen wie Überleben, Sicherheit oder sogar Bequemlichkeit, wenn die Lebensstandards vergleichbar und die Vergleiche international werden. «Die internationalen Beziehungen der Völker sind durch die moderne Technik und den durch sie ermöglichten Verkehr so leichte und innige geworden, dass der Europäer als Maßstab für sein eigenes Leben, ohne sich dessen oft bewusst zu werden, die Verhältnisse des amerikanischen Lebens anlegt».
Die Globalisierung brachte Hitler zum amerikanischen Traum. Hinter jedem imaginären deutschen Rassenkrieger stand eine imaginäre deutsche Hausfrau, die immer mehr wollte. In seinen schrilleren Momenten drängte Hitler die Deutschen, sich die Tiere zum Vorbild zu nehmen und sich nur auf das Überleben und die Reproduktion zu konzentrieren. Doch seine eigene, kaum verhüllte Angst war eine sehr menschliche, vielleicht sogar eine sehr männliche: die vor der deutschen Hausfrau. Sie war es, die die Latte des natürlichen Kampfes immer höher legte. Vor dem Ersten Weltkrieg, als Hitler noch jung war, hatte die Rhetorik des deutschen Kolonialismus mit der doppelten Bedeutung des Wortes «Wirtschaft» gespielt: Gemeint war sowohl der Haushalt als auch die Ökonomie. Den deutschen Frauen hatte man beigebracht, den Komfort mit einem Imperium gleichzusetzen. Und da Komfort immer relativ war, war die politische Rechtfertigung von Kolonien unerschöpflich. In den USA spricht man von «keeping up with the Joneses», wenn man die Vorstellung bezeichnen will, dass der Lebensstandard relativ ist und auf dem wahrgenommenen Erfolg anderer basiert. Wenn der Maßstab der deutschen Hausfrau Mrs. Jones und nicht Frau Müller war, dann brauchten die Deutschen ein Großreich, das mit dem amerikanischen vergleichbar war. Die deutschen Männer mussten an irgendeiner fernen Front kämpfen und sterben, ihre Rasse und den Planeten erlösen, während die Frauen ihre Männer unterstützten, indem sie die gnadenlose Logik des unablässigen Verlangens nach einem immer komfortableren Heim verkörperten.
Die unvermeidliche Präsenz Amerikas in deutschen Köpfen war der eigentliche Grund, warum die Wissenschaft in Hitlers Augen das Grundproblem der deutschen Rasse nicht lösen konnte. Selbst wenn Erfindungen den Bodenertrag verbesserten, würde Deutschland allein dadurch niemals mit den USA Schritt halten können. Technologische Errungenschaften gab es in beiden Ländern; unterschiedlich hingegen war die Quantität der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Daher brauchte Deutschland genauso viel Technologie wie die Amerikaner und genauso viel Land. Hitler erklärte, der permanente Kampf um Land sei ein Gebot der Natur, aber er erkannte auch, dass das Verlangen nach einem wachsenden relativen Komfort ebenfalls eine unablässige Mobilisierung erzeugen konnte.
Wenn das Urteil über den Wohlstand in Deutschland immer relativ war, ließ sich ein endgültiger Erfolg niemals erreichen. «Die Aussichten des deutschen Volkes sind trostlose», schrieb Hitler mit Bedauern. Doch auf die Klage folgte sogleich die Klarstellung: «Weder der heutige Lebensraum noch der durch eine Wiederherstellung der Grenzen von 1914 erreichte gestatten uns, ein Leben analog dem amerikanischen Volk zu führen.» Zumindest würde der Kampf fortdauern, solange die USA existierten, und das würde sehr lange sein. Hitler betrachtete Amerika als die kommende Weltmacht und die amerikanische Kernbevölkerung («der rassisch rein und unvermischter gebliebene Germane») als ein «Weltvolk», das wesentlich gesünder und jünger sei als die Deutschen, die in Europa geblieben waren.
Als Hitler Mein Kampf schrieb, stieß er auf das Wort «Lebensraum» und machte es sich für eigene Zwecke zunutze. In seinen Schriften und Reden brachte es die gesamte Vielfalt an Bedeutungen zum Ausdruck, die er dem natürlichen Kampf zuschrieb, von einem niemals endenden Kampf der Rasse ums nackte Überleben bis zum endlosen Krieg um das subjektive Gefühl, den weltweit höchsten Lebensstandard zu haben. Der Begriff kam als Entsprechung des französischen Ausdrucks biotope ins Deutsche. In einem eher sozialen als biologischen Zusammenhang drückt «Lebensraum» noch etwas anderes aus: das behagliche Zuhause, etwas, das dem «living room» nahekommt. Die Zusammenführung dieser beiden Bedeutungen in einem Wort bildete den Wesenskern von Hitlers zirkulärer Idee: Die Natur ist nichts anderes als die Gesellschaft, und die Gesellschaft ist nichts anderes als die Natur. Insofern besteht kein Unterschied zwischen dem Kampf der Tiere ums physische Überleben und dem Wunsch von Familien nach einem schöneren Leben. Immer geht es dabei um den «Lebensraum».
Das 20. Jahrhundert sollte zu einem endlosen Kampf um relativen Komfort werden. Robert Ley, einer von Hitlers wichtigsten frühen Gefolgsleuten, definierte den «Lebensraum» so: «Eine tieferstehende Rasse braucht weniger Raum, weniger Kleider, weniger Essen und weniger Kultur als eine hochstehende Rasse.» Hitlers Propagandachef Joseph Goebbels definierte den Zweck eines Vernichtungskriegs als Kampf «für einen voll gedeckten Frühstücks-, Mittags-, und Abendtisch». Viele Millionen von Menschen mussten nicht deshalb hungern, damit die Deutschen im physischen Sinne überleben konnten. Sie mussten hungern, damit die Deutschen nach einem Lebensstandard streben konnten, der höher war als der aller anderen.
«Aber eines haben die Amerikaner, was uns abgeht», beklagte sich Hitler, nämlich «das Gefühl für die Weite und Leere des Raumes.» Damit wiederholte er nur, was deutsche Kolonialisten seit Jahrzehnten verkündeten. 1871, zur Zeit der Reichsgründung, war die Welt bereits von anderen europäischen Mächten kolonisiert worden. Durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg verlor Deutschland die paar Kolonien, die es bekommen hatte. Wo waren im 20. Jahrhundert die Gebiete, die deutscher Eroberung offenstanden? Wo war die deutsche frontier, was war die manifest destiny, die offenkundige Bestimmung der Deutschen?
Was blieb, war einzig und allein der eigene Kontinent. Hitler schrieb: «Für Deutschland lag demnach die einzige Möglichkeit zur Durchführung einer gesunden Bodenpolitik nur in der Erwerbung von neuem Lande in Europa selber.» Natürlich gab es nirgends in der näheren Umgebung Deutschlands unbewohnte oder auch nur unterbevölkerte Gebiete. Entscheidend war die Vorstellung, dass europäische «Räume» tatsächlich «offen» waren. Die Ideologie des Rassismus machte aus bevölkerten Ländern potenzielle Kolonien, und europäische Rassisten fanden die entsprechenden Mythologien in der noch nicht so fernen Kolonisierung von Nordamerika und Afrika. Die Eroberung und Ausbeutung dieser Kontinente prägte die literarische Vorstellungswelt der Europäer in Hitlers Generation. Wie Millionen andere Kinder, die in den 1880er und 1890er Jahren geboren wurden, spielte Hitler Kriege in Afrika nach und las die Romane Karl Mays, die vom Wilden Westen handelten. Hitler sagte, May habe ihm die «ersten geographischen Kenntnisse» vermittelt.
Im 19. Jahrhundert neigten die Deutschen dazu, das Schicksal der amerikanischen Ureinwohner als natürlichen Vorläufer für das Schicksal der afrikanischen Ureinwohner in ihrem Herrschaftsgebiet zu betrachten. Eine Kolonie war Deutsch-Ostafrika (heute Ruanda, Burundi, Tansania und ein kleiner Teil von Mosambik). Berlin nahm dieses Gebiet 1891 in Besitz. Während des Maji-Maji-Aufstands im Jahr 1905 griffen die Deutschen zu einer Strategie des Verhungernlassens, der mindestens 75.000 Menschen zum Opfer fielen. Eine andere Kolonie war Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, wo circa 3000 deutsche Kolonialisten ungefähr siebzig Prozent des Landes kontrollierten. Dort nahmen die Deutschen 1904 den Aufstand der Herero und Nama zum Anlass, diesen Stämmen den Zugang zu Wasser zu verweigern, bis «er [der Feind] schließlich willenlos ein Opfer der Natur seines eigenen Landes wurde», wie die offizielle Militärgeschichte es formulierte. Überlebende wurden in einem Konzentrationslager auf einer Insel interniert. Die Herero-Bevölkerung wurde von rund 80.000 auf etwa 15.000 dezimiert; von rund 20.000 Nama überlebte etwa die Hälfte. Für den verantwortlichen deutschen General war dieses Vorgehen historisch absolut gerechtfertigt: «Die Eingeborenen müssen weichen», sagte Lothar von Trotha, «schauen Sie nach Amerika.» Der deutsche Gouverneur dieses Gebiets, Theodor Leutwein, verglich Südwestafrika gerne mit den US-Bundesstaaten Nevada, Wyoming und Colorado. Der Direktor der Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt und spätere Staatssekretär im Reichskolonialamt Bernhard Dernburg, ein Zivilist, sah das ganz ähnlich: «Aber die Geschichte der Kolonisation der Vereinigten Staaten, doch des größten Kolonialunternehmens, das die Welt jemals gesehen hat, hatte als ersten Akt die nahezu vollständige Vernichtung der Ureinwohner.» Er sah die Notwendigkeit einer «Vernichtungsoperation». Der oberste deutsche Geologe forderte eine «Endlösung der Eingeborenenfrage».
Ein damals beliebter deutscher Jugendroman über diesen Krieg, Peter Moors Fahrt nach Südwest von Gustav Frenssen (erschienen 1906), verband, wie Hitler, die Vorstellung des Rassenkampfs mit göttlicher Gerechtigkeit. Die Tötung von «Schwarzen» war «Gottes Gerechtigkeit», denn den «Tüchtigeren und Frischeren gehört die Welt». Wie die meisten Europäer war Hitler, was Afrikaner anging, Rassist. Die Franzosen, so verkündete er, ließen «das eigene Blut vernegern». Er teilte die allgemeine Aufregung in Europa darüber, dass die Franzosen bei der Rheinlandbesetzung nach dem Ersten Weltkrieg afrikanische Soldaten einsetzten. Doch Hitlers Rassismus hatte nichts mit der europäischen Herablassung gegenüber Afrika zu tun. Für ihn war die ganze Welt eine Art «Afrika», und er betrachtete jeden, auch die Europäer, unter Rassengesichtspunkten. Hier war er, wie so oft, konsequenter als andere. Rassismus bedeutete schließlich den Anspruch, darüber zu entscheiden, wer Mensch war und wer nicht. Insofern ließen sich Vorstellungen von rassischer Überlegenheit und Minderwertigkeit nach Belieben und Zweckdienlichkeit anwenden. Selbst benachbarte Gesellschaften, die gar nicht so anders zu sein schienen als die Deutschen, konnte man damit als rassisch andersartig definieren.
Als Hitler in Mein Kampf davon sprach, dass Deutschland nur in Europa die Möglichkeit zur Schaffung eines Kolonialreichs habe, schloss er damit Afrika als Möglichkeit aus. Die Suche nach minderwertigen Rassen, über die man gebieten konnte, erforderte keine langen Fahrten übers Meer, denn es gab sie auch in Osteuropa. Im 19. Jahrhundert befand sich der zentrale Schauplatz des deutschen Kolonialismus schließlich nicht im geheimnisvollen Afrika, sondern im benachbarten Polen. Durch die Teilungen von Polen-Litauen Ende des 18. Jahrhunderts hatte Preußen sein Territorium um Landstriche erweitert, die mehrheitlich von Polen besiedelt waren. Ehemals polnische Gebiete wurden so Teil des 1871 von Preußen geschaffenen Deutschen Reiches. Die Polen stellten etwa sieben Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung, in den östlichen Gebieten bildeten sie die Mehrheit. Zuerst wurden sie zum Ziel von Bismarcks Kulturkampf, einer Kampagne gegen die römisch-katholische Religion, zu deren Hauptzielen die Beseitigung der nationalen polnischen Identität gehörte. Danach begannen vom Staat unterstützte Kampagnen der inneren Kolonisierung. In der deutschen Kolonialliteratur über Polen, die sich zum Teil bestens verkaufte, wurden die Polen als «Schwarze» bezeichnet. Die polnischen Bauern hatten dunkle Gesichter und nannten die Deutschen «Weiße». Die dekadenten und nutzlosen polnischen Aristokraten wurden mit schwarzem Haar und schwarzen Augen versehen, ebenso die schönen Polinnen. Sie waren die Verführerinnen, die in diesen Geschichten fast immer den naiven deutschen Mann in rassische Selbsterniedrigung und ins Verderben stürzten.
Während des Ersten Weltkriegs verlor Deutschland Südwestafrika. In Osteuropa war die Situation eine andere. Hier schien die deutsche Waffengewalt zwischen 1916 und 1918 ein neues großes Gebiet zu erobern, das beherrscht und ökonomisch ausgebeutet werden konnte. Zunächst schloss Deutschland seine polnischen Annexionen der Vorkriegszeit an jene an, die es dem russischen Zarenreich abgenommen hatte, um ein untergeordnetes Regentschaftskönigreich Polen zu schaffen, das von einem Marionettenmonarchen regiert werden sollte. Nach dem Krieg, so der Plan, wollte man alle polnischen Landbesitzer nahe der deutsch-polnischen Grenze enteignen und deportieren. Nachdem die bolschewistische Revolution den Krieg für Russland beendet hatte, schuf Deutschland eine Kette abhängiger Vasallenstaaten, die von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte und deren größter die Ukraine war. Deutschland verlor den Krieg 1918 in Frankreich, wurde aber auf den osteuropäischen Schlachtfeldern nie endgültig besiegt. Die Deutschen konnten somit den Eindruck gewinnen, dass man dieses neue Osteuropa aufgegeben hatte, ohne es jemals wirklich verloren zu haben.
Der vollständige Verlust der Kolonien in Afrika während des Ersten Weltkriegs und danach schuf Raum für eine verschwommene und dehnbare nostalgische Vorstellung von rassischer Überlegenheit. Beliebte Unterhaltungsromane über Afrika mit Titeln wie Komm wieder Bwana konnten nur nach einem solchen vollständigen Bruch reüssieren. Die Deutschen konnten sich weiterhin als gute Kolonisten betrachten, selbst als die Gefilde der Kolonisierung unklar und vage und in die Zukunft projiziert wurden. Hans Grimms Roman Volk ohne Raum, der vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland 500.000 Mal verkauft wurde, erzählt von der schwierigen Situation eines Deutschen, der aus Afrika zurückgekehrt ist und nun unter der Einengung in einem kleinen Deutschland und unter einem ungerechten europäischen System leidet.
Das Problem enthielt seine eigene Lösung. Da der Rassismus eine Hierarchie von Anrechten auf den Planeten postulierte, ließ er sich auch auf Europäer anwenden, die östlich von Deutschland lebten. Afrika als geographischer Ort war verloren, aber «Afrika» als Denkfigur ließ sich universell anwenden. Die Erfahrungen in Osteuropa hatten ergeben, dass auch die Nachbarn «schwarz» sein konnten. Man konnte sich auch Europäer vorstellen, die sich «Herren» wünschten und «Raum» abtraten, Platz machten. Nach dem Krieg war es pragmatischer, eine Rückkehr nach Osteuropa in Erwägung zu ziehen als eine nach Afrika. In diesem, wie in so vielen anderen Fällen, verwandelte Hitler dumpfe Gefühle in erbarmungslos zementierte Schlussfolgerungen. Als rassisch minderwertig deklarierte er die größte kulturelle Gruppe in Europa, Deutschlands Nachbarn im Osten, die Slawen.
«Der Slawe», schrieb Hitler, «ist eine geborene Sklaven-Masse, die nach dem Herrn schreit.» Die Slawen, die damit gemeint waren, waren in erster Linie Ukrainer, die ein Gebiet äußerst fruchtbaren Landes bewohnten, sowie all diejenigen, die um die Ukraine herum lebten: Russen, Weißrussen und Polen. «Ich brauche die Ukraine», konstatierte Hitler, «damit man uns nicht wieder wie im letzten Krieg aushungert.» Die Eroberung der Ukraine werde dafür sorgen, «unserem Volk durch die Zuweisung eines genügenden Lebensraumes für die nächsten 100 Jahre auch einen Lebensweg vorzuzeichnen». Für ihn war das eine Sache der natürlichen Gerechtigkeit. «Widersinnig ist es, dass ein hochstehendes Volk auf knappem Raum sich kaum ernähren kann, während die niedrigstehende russische Masse, die der Kultur nichts nützt, in unendlichen Räumen einen Boden innehat, der zum besten der Erde gehört.» Den Ukrainern, so Hitler, «liefern wir Kopftücher, Glasketten als Schmuck und was sonst Kolonialvölkern gefällt», wenn das Land einmal eingenommen ist. In ihren Dörfern sollte es nur einen einzigen «Radiolautsprecher» geben, aus dem vor allem «lustige Musik» kommen sollte. «Denn lustige Musik fördere die Arbeitsfreude. Und wenn die Leute viel tanzen könnten, so werde auch das nach unseren Erfahrungen in der Systemzeit allgemein begrüßt werden.» Die nationalsozialistische Propaganda entfernte die Ukrainer ganz einfach aus dem Bild. Ein NS-Lied für Kolonisten beschrieb die Ukraine so: «Dort wartet gute Erde,/Die niemals Saaten trug,/Dort stehn keine Höfe und Herde,/Dort ruft das Land nach dem Pflug.» Erich Koch, den Hitler während des Zweiten Weltkriegs zum Reichskommissar für die Ukraine ernannte, erklärte die Minderwertigkeit der Ukrainer kurz und knapp so: «Wenn ich einen Ukrainer finde, der wert ist, mit mir an einem Tisch zu sitzen, muss ich ihn erschießen lassen.» Selbst in den rassistischen Morddrohungen bildete das Esszimmer die Kulisse.
Als es 1941 zur deutschen Besatzung kam, stellten die Ukrainer selbst den Zusammenhang mit Afrika und Amerika her. Eine Ukrainerin schrieb in ihr Tagebuch – so belesen und so reflektiert, wie es sich die nationalsozialistischen Rassisten nicht vorstellen konnten: «Wir sind wie die Sklaven. Oft kommt einem Onkel Toms Hütte i...