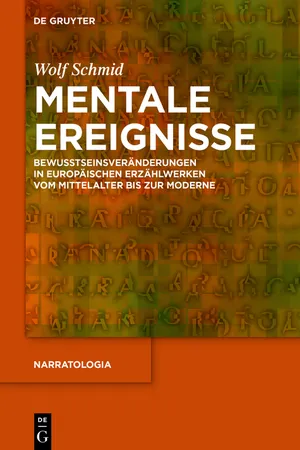1Einleitung: Handlung und Bewusstsein
Eine wesentliche Komponente des Erzählens, das in der gegenwärtigen Narratologie allgemein als Darstellung von Zustandsveränderungen verstanden wird, ist das Bewusstsein der Figuren, von denen erzählt wird.1 Seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts sind in den europäischen Literaturen die entscheidenden Zustandsveränderungen mentaler Natur, Veränderungen des Bewusstseins.
Das heißt jedoch nicht, dass Bewusstseinsdarstellung erst in dieser Zeit begänne. In den europäischen Literaturen des Mittelalters finden wir bereits eine entwickelte Darstellung der Gefühle und Gedanken der Figuren, die nicht nur in der Form narratorialer Wiedergabe, sondern durchaus auch in den Formen figuraler Rede gestaltet ist. Gottfrieds von Straßburg Versroman Tristan enthält sogar ausgedehnte innere Monologe, die in der Gestalt innerer Dialoge der Figur mit sich selbst äußerst widersprüchliche Bewegungen in der Seele des Helden ausdrücken. Bereits in antiken (hebräischen und griechischen) Werken finden wir Fälle ausgedehnter Bewusstseinsdarstellung, sogar elaborierte innere Monologe (vgl. Dinkler 2015).
Für die Chronologie der Bewusstseinsdarstellung hochrelevant sind Monika Fluderniks (2011) Untersuchungen zur mittelenglischen Literatur. Fludernik kommt zu dem Schluss, dass die mittelenglische Literatur wesentlich mehr Darstellung von Subjektivität und innerer Welt enthalte, als man ihr gemeinhin zugestehe, vor allem von Seiten jener Experten für die Renaissance, die den Aufstieg der Subjektivität mit dem späten sechzehnten Jahrhundert datieren.
Fludernik erklärt die generelle Unterschätzung mittelalterlicher Bewusstseinsdarstellung durch die Narratologie mit deren ausschließlichem Interesse für Erzählwerke seit dem Aufstieg des Romans im achtzehnten Jahrhundert. Der Mangel an narratologischen Untersuchungen mittelalterlicher Literatur mag allerdings auch durch die Skepsis der Mediävisten gegenüber Fragestellungen und Untersuchungen begründet sein, die ihnen anachronistisch, der Denk- und Dichtungsweise des Mittelalters nicht angemessen erscheinen.
Mit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts beobachten wir eine Verlagerung der Handlung aus der Außenwelt in die Innenwelt. Thomas Mann hat in seinem Vortrag Die Kunst des Romans (1939) diese Entwicklung „Verinnerlichung“ genannt und sich dafür auf Arthur Schopenhauer berufen:
Ein Roman wird desto höherer und edlerer Art seyn, je mehr inneres und je weniger äußeres Leben er darstellt […] Die Kunst besteht darin, dass man mit dem möglichst geringsten Aufwand von äußerem Leben das innere in die stärkste Bewegung bringe; denn das innere ist eigentlich der Gegenstand unsres Interesse. – Die Aufgabe des Romanschreibers ist nicht, große Vorfälle zu erzählen, sondern kleine interessant zu machen. (Schopenhauer, Parerga und Paralipomena [1851]; zit. nach Mann, X, 356)
In der Verinnerlichung sieht Mann das „Geheimnis der Erzählung“, das darin besteht, „das, was eigentlich langweilig sein müsste, interessant zu machen“:
Das Prinzip der Verinnerlichung muss im Spiele sein bei jenem Geheimnis, dass wir atemlos auf das an und für sich Unbedeutende lauschen und darüber den Geschmack am grob aufregenden, robusten Abenteuer ganz und gar vergessen. (Mann, X, 357)
Seit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wird äußeres Handeln mit mehr oder weniger ausführlich dargestellten inneren Vorgängen verbunden. Als Beleg dienen Schopenhauer sogar die Abenteuerromane Walter Scotts:
Selbst die Romane Walter Scotts haben noch ein bedeutendes Übergewicht des innern über das äußere Leben, und zwar tritt Letzteres stets nur in der Absicht auf, das erstere in Bewegung zu setzen, während in schlechten Romanen es seiner selbst wegen da ist. (Zit. nach Mann, X, 356)
Der Nexus zwischen Handeln und Bewusstsein wird zum Grundprinzip des neueren Erzählens, und der wechselseitigen Motivierung der beiden Faktoren gilt die Sorge der um Plausibilität bemühten Autoren.
Mit dem Stichwort Bewusstsein ist die kognitivistische oder – einfacher – kognitive Narratologie aufgerufen. Wenn in ihrem Fokus auch vor allem die Relation zwischen dem Text oder der in ihm erzählten Geschichte einerseits und dem Leser andererseits steht (vgl. Herman 2009), so interessiert sie sich doch ebenfalls für das im Erzählwerk dargestellte fiktive Bewusstsein.
„Novel reading is mind reading“. Mit dieser Losung beruft sich der britische Kognitivist Alan Palmer (2007, 217) auf Lisa Zunshines Buch Why We Read Fiction (2006). Es wird damit behauptet, dass in der Lektüre fiktionaler Literatur die wichtigste Rolle das Erschließen des Bewusstseins der fiktiven Figuren spiele, jene rezeptive Aktion, die in den kognitiven Wissenschaften mind reading oder theory of mind genannt wird (Gopnik 1999; Zunshine 2006, 6).2 Auch wenn das Bewusstsein der Figuren für fiktionale Narrationen von großer Bedeutung ist, kann ihm nicht der Rang des Wichtigsten im Erzählen zugesprochen werden. Gegen die in Alan Palmers „target article“ (2011a) vorgetragene These, Leser interessierten sich weniger für die Geschehnisse von Erzählungen als für die „workings of the fictional minds contained in them“ ist aus der Perspektive der empirischen Psychologie Widerspruch vorgebracht worden. Gegen die Schlussfolgerung „Fictional narrative is, in essence, the presentation of mental functioning“ (Palmer 2011a, 202), argumentiert Marisa Bortolussi, die als Ko-Autorin des Bandes Psychonarratology (Bortolussi & Dixon 2003) von realen Leserreaktionen auf Erzählstrukturen berichtet, dass die Vermutung Palmers über die Präferenz des Lesers für das Figurenbewusstsein nicht empirisch bestätigt sei, ja von den Ergebnissen der empirischen Psychologie widerlegt werde, die besagten, dass Leser nach der Lektüre von Geschichten vor allem Ereignisse erinnern (Bortolussi 2011, 286).
Den Primat der Handlung vor den Charakteren hat schon Aristoteles am Beispiel des Dramas betont:
Die Darstellung (μίμησις)3 der Handlung (πράξις) ist die Erzählung (μῦθος). Ich nenne Erzählung die Zusammensetzung der Geschehnisse (σύνθησις τῶν πραγμάτων)4 […] Die Tragödie hat sechs wesentliche Komponenten […]: Erzählung, Charaktere, sprachlicher Ausdruck, Erkenntnisfähigkeit, äußere Ausstattung und Musik […] Die wichtigste Komponente ist die Zusammenstellung der Geschehnisse (τῶν πραγμάτων σύστασις). Denn die Tragödie ist nicht Darstellung von Menschen, sondern von Handlungen (πράξεις) und von Leben […], und das Ziel [der Darstellung] ist eine Handlung (πράξις), nicht aber die Eigenschaft eines Charakters. Die Personen handeln nicht, um Charaktere darzustellen, sondern die Charaktere sind in den Handlungen enthalten. Deshalb sind die Geschehnisse (τὰ πράγματα) und die Erzählung das Ziel der Tragödie. Das Ziel aber ist das Wichtigste von allem. (Poetik 1450a)
Neuzeitlich formulierend können wir den Schluss ziehen: Erzählende Literatur wird nicht um der Bewusstseinsdarstellung willen geschrieben, sondern um Zustandsveränderungen handelnder und leidender Menschen darzustellen. Aristoteles’ Begriff des „Charakters“ (ἦθος) kann auch „Denkweise“, „Sinnesart“, „Seelenzustand“ und „künstlerische Darstellung von Seelenzuständen“ bezeichnen, und wir können ihn durchaus im Sinne unseres neuzeitlichen „Bewusstseins“ oder der gesamten Innenwelt einer Figur verstehen, also alles dessen, was der englische Begriff mind umfasst. Der Philosoph macht darauf aufmerksam, dass das Bewusstsein zwar an „zweiter Stelle“ der Tragödie steht, während die Handlung ihre „Grundlage und Seele“ bildet (Poetik 1450a), dass es aber in den Handlungen impliziert ist.
Der Mythos der Tragödie besteht nach Aristoteles aus drei „Teilen“ (μέρη): der „Peripetie“ (περιπέτεια), der „Wiedererkennung“ (ἀναγνώρισις) und dem „Leiden“ (πάθος). Für die nicht-tragödische Narration sind offensichtlich nur die ersten beiden Teile relevant. Beide bezeichnet Aristoteles als Formen des „Umschlags“ (μεταβολή). Die Peripetie ist der „Umschlag dessen, was gerade betrieben wird, in sein Gegenteil“, die Wiedererkennung der „Umschlag aus Unwissenheit in Erkennen“ (ἐξ ἀγνοίας ἐις γνῶσιν μεταβολή; Poetik 1452a). Mit dieser zweiten Form des Umschlags zielt Aristoteles auf die für die attische Tragödie spezifische Form mentaler Zustandsveränderung, das Wiedererkennen von Figuren. Das Musterbeispiel für diesen Umschlag gibt für Aristoteles das von ihm oft angeführte Drama des Sophokles König Ödipus ab, dessen Titelheld erkennen muss, dass er, ohne es zu wissen, seinen Vater erschlagen und seine Mutter geheiratet hat. Die Anagnorisis bezieht sich für Aristoteles nicht nur auf Figuren, sondern auch auf Nicht-Lebendiges und Sachverhalte. Das erhellt aus der lakonischen Bemerkung:
Es gibt auch andere Arten von Wiedererkennung. Sie kann vorkommen bei leblosen Gegenständen (ἄψυχα) und Zufälligem (τυχόντα), und man kann auch entdecken, ob jemand etwas gemacht oder nicht gemacht hat. (Poetik 1452a)
Bei Aristoteles finden wir auch schon den Gedanken angelegt, dass Handlung und Bewusstsein (ἦθος) der wechselseitigen Motivierung bedürfen.5 In der Sprache der Poetik, die das Verfahren der Motivierung mit den Begriffen von „Notwendigkeit“ und „Wahrscheinlichkeit“ umschreibt, wird das auf folgende Weise formuliert:
Man muss auch bei der Darstellung von Seelenzuständen (τὰ ἦθα) wie bei der Zusammensetzung der Geschehnisse sich um das Notwendige (τὸ ἀναγκαῖον) oder Wahrscheinliche (τὸ εἰκός) bemühen, so dass eine bestimmte Person mit Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes sagt oder tut und dass sich das eine aus dem andern mit Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit ergibt. (Poetik 1454a)
Seitdem die neuzeitliche Poetik im achtzehnten Jahrhundert den Roman zu reflektieren begann, spielte das Problem der wechselseitigen Motivierung von Handlung und Bewusstsein eine wesentliche Rolle. In Deutschland hat auf den Nexus zwischen Handeln und Bewusstsein am nachdrücklichsten Friedrich Blanckenburgs Versuch über den Roman (1774), die erste Poetik des psychologischen Romans, aufmerksam gemacht. In ihrem Zentrum steht die Wechselwirkung von „Handlungen und Empfindungen des Menschen“. Der Roman soll das „Werden“ des Menschen gestalten, „das ganze innere Sein der handelnden Personen mit all’ den sie in Bewegung setzenden Ursachen“ sichtbar machen und dabei den kausalen Nexus zwischen Begebenheiten und Empfindungen so veranschaulichen, dass das „Wie“ der Entwicklung erlebbar und verallgemeinerbar wird (vgl. Wahrenburg 1995).
Während im Erzählen des Dramas der Nexus zwischen Bewusstsein und Handlung seit der Renaissance äußerste Pflege erfährt, man denke nur an Shakespeares Dramen, beobachten wir an der Prosanarration erst seit der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts eine zunehmend sorgfältige Motivierung der Handlung durch das Bewusstsein. Jedes äußere Handeln wird seitdem mit inneren Vorgängen verbunden. Der Nexus von Handlung und Bewusstsein ist ein Grundprinzip des neueren Erzählens, und der wechselseitigen Motivierung der beiden Faktoren gilt die Sorge der um Glaubwürdigkeit bemühten Autoren.
Im Zentrum des vorliegenden Buchs steht ein besonderer Typus von Handlung oder Vorkommnis, eine Veränderung des Bewusstseinszustands der Figur, die als mentales Ereignis bezeichnet werden kann. Dabei verfolgt die Arbeit sowohl ein systematisches als auch ein historisches Interesse.
Dem systematischen Interesse dient die Klassifizierung der Formen der Darstellung von Bewusstsein in der Literatur und die Klärung, unter welchen Bedingungen man die Veränderung eines Bewusstseinszustands ein Ereignis nennen kann. Die historische Dimension kommt durch die Analyse von Werken verschiedener Kulturen und Epochen unter dem Aspekt ihrer mentalen Ereignisse zum Tragen. Es ist hier zunächst zu klären, von welchen Umschlägen der Bewusstseinsaktivität Werke erzählen. Dann ist die Frage zu stellen, in welchen der sechs zu unterscheidenden Schablonen das Bewusstsein der Figuren gestaltet wird und in welchem Maße die bedeutungsgebenden Instanzen Erzähler und Figur ins Spiel kommen. Schließlich ist der mentalitätsgeschichtliche Status der jeweiligen Ereignispoetik und Bewusstseinsphilosophie zu eruieren.
Die ausgewählten Werke erstrecken sich über einen Zeitraum von etwa 700 Jahren, von der Blütezeit der mittelalterlichen Epik bis zur Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts, und sie repräsentieren vier Nationalliteraturen. Ihre Auswahl bemisst sich nach ihrem exemplarischen Charakter für hohe Ereignishaftigkeit. Aber auch merkmalhaftes Fehlen von Bewusstseinsereignissen (Otto Ludwig), der systematische Verzicht auf Explikation innerer Entscheidungen, die in den Geschichten gleichwohl stattfinden (Aleksandr Puškin), und die Darstellung einer veränderungsunwilligen Mikrowelt (Jan Neruda) ist für einige Texte das Kriterium der Auswahl.
Der analytische Parcours setzt bei den mittelhochdeutschen Versepen Parzival und Tristan als Repräsentanten vorneuzeitlicher Narration ein, deren Gestaltung mentaler Ereignisse überraschend ‚moderne‘ Züge aufweist.6 Ausführlich behandelt werden die Brief(wechsel)romane Samuel Richardsons und die nichtdiegetischen (‚Er‘-)Romane Jane Austens, in denen die neuzeitliche Bewusstseinskunst ihren Anfang nimmt. Besonderes Augenmerk gilt den Romanen der russischen Realisten Dostoevskij und Tolstoj, in denen sich Sinnpositionen maximal ändern können und die insofern einen Höhepunkt des realistischen Ereignisoptimismus darstellen. Ihnen stehen die Erzählungen Anton Čechovs gegenüber, die die Skepsis der postrealistischen Moderne gegenüber der Ereignisfähigkeit der Welt und der Veränderungsfähigkeit des Menschen artikulieren. Der Gegensatz zwischen Realismus und Postrealismus zeigt, dass Epochenmentalitäten durch ihre Einstellung zur Möglichkeit tiefgreifender mentaler Ereignisse charakterisiert werden können.
Die Analyse konnte sich nicht auf einzelne herausragende Stellen mentaler Ereignishaftigkeit konzentrieren, sondern hatte jeweils ihre Situierung in der Sequenz des Textes und im gesamten Kontext des Werks zu beachten. Dies machte die Ausführlichkeit in der Vorstellung der Werke und ihrer Handlung erforderlich. Zudem war zu bedenken, dass nicht alle Leser mit den behandelten Werken der vier Nationalliteraturen gleichermaßen vertraut sein werden.
Englische und französische Zitate werden im...