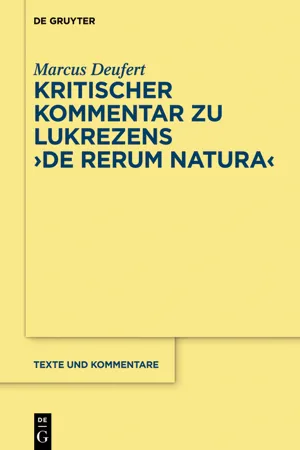
- 526 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Kritischer Kommentar zu Lukrezens "De rerum natura"
Über dieses Buch
Der kritische Kommentar rechtfertigt den Text der Neuausgabe des Lukrez in der Bibliotheca Teubneriana. Die vielen textkritisch umstrittenen Stellen des Gedichts werden eingehend geprüft; konkurrierende Deutungen und Konjekturen kritisch bewertet; neue Lösungen für die Textgestaltung begründet. Dabei erhellt der Kommentar fortwährend auch inhaltlich-philosophische und literarisch-stilistische Aspekte des Gedichts.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kritischer Kommentar zu Lukrezens "De rerum natura" von Marcus Deufert im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Antike & klassische Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Buch VI
11(Epicurus uidit) omnia iam ferme mortalibus esse parata, / et, proquam posset, uitam consistere tutam
In Vers 11 ist posset eine Konjektur Lachmanns für überliefertes possent, an dem viele neuere Herausgeber festhalten wollen. Dabei ist unbestreitbar, dass sich aus mortalibus in 10 nicht schwieriger ein Subjekt zu possent ergänzen lässt als aus uita in 11 zu posset. Aber es geht nicht nur um das Subjekt, sondern auch um das Prädikat, also den mit posset bzw. possent zu verbindenden Infinitiv. Bei Lachmanns Konjektur ist alles in Ordnung: proquam posset (uita tuta consistere), uitam consistere tutam, bei überliefertem possent jedoch weit und breit kein passendes Prädikat in Sicht. „With possent we may paraphrase uidit uitam tutam quem admodum homines possent eam tueri“ schreibt Merrill (1916) 108: Das gibt keinen guten Sinn und ist zudem weit hergeholt, weil der einzige Anhaltspunkt für ergänztes tueri das Attribut tutam ist. Dagegen ist die Ergänzung proquam uita tuta consistere posset nicht nur leicht, sondern auch dem Sinn nach sehr erwünscht: Die Beobachtung, dass in der Stadt Athen zu Zeiten Epikurs das Leben sicher war, soweit es dies sein konnte, bezieht sich in ihrer grundsätzlich positiven Seite auf die in 1–3 genannten Errungenschaften Athens, in ihrer Einschränkung auf unvorhersehbare Naturereignisse: Seuchen und dergleichen, wie sie die Menschen immer wieder ereilen können. Die schlimmste Katastrophe dieser Art, die Athen je heimgesucht hat, wird das Finale dieses Buches ausmachen; Epikurs Umgang mit derartigen Ereignissen beschreibt Lukrez am Ende des Proöms in den Versen 29–32.
14–16
nam cum uidit …
diuitiis homines et honore et laude potentis
affluere atque bona gnatorum excellere fama,
nec minus esse domi cuiquam tamen anxia corda ,
[15] atque animi ingratis uitam uexare sine ulla
pausa atque infestis cogi saeuire querelis
Die meisten Herausgeber drucken mit gutem Grund die Verse in dieser Fassung, die auf Munro zurückgeht. Dabei ist in 14 corda eine (wie mir M. Reeve freundlicherweise mitgeteilt hat) bereits in der Humanistenhandschrift Zaragoza, Biblioteca del Cabildo Metropolitano ms 11–36 überlieferte Konjektur für cordi, der Versschluss sine ulla Konjektur Munros für ein aus 16 antizipiertes querelis (-llis O). Zwar ist man gegen beide Konjekturen immer wieder angegangen (zuletzt Butterfield 2006/2007 p. 83f.), aber mit schlechten Argumenten. So hat Maas (1902) 538f. corda verworfen, weil es bei Lukrez sonst keinen Beleg für den erst von Cicero in seiner Arat-Übersetzung eingeführten poetischen Plural gebe, weshalb die von Lachmann angeführte Parallele Verg. Aen. 6, 49 (von der Sibylle) et rabie fera corda tument für Lukrez hinfällig sei. Aber selbst wenn wir nicht hinnehmen wollen, dass sich Lukrez einmal die Freiheit seines poetischen Vorbilds Cicero genommen hätte, so brauchen wir die Deutung von corda als einen poetischen Plural gar nicht zu bemühen. Denn es liegt eine constructio ad sensum vor. Wenn Lukrez sagt, dass dennoch keinem die Herzen weniger ängstlich waren, bedeutet das soviel wie, dass sie alle um keinen Deut weniger ängstliche Herzen hatten: Lukrez verwendet somit den Plural corda mit vollem Recht, nämlich in Beziehung auf mehrere Subjekte, mag er es auch grammatisch in der Form eines verneinten Singulars (durch nec minus … cuiquam) ausgedrückt haben. Den anxia corda an unserer Stelle entsprechen formal die Klausel acria corda in 3, 294 sowie die Wendung leuisomna … corda in 5, 864. – In 15f. ist dann das Nebeneinander von überliefertem querelis und pausa syntaktisch unmöglich und ohne Sinn. Bei der Behandlung dieses Problems hat Munro alles richtig gemacht, weil er an dem gut lukrezischen pausa (insgesamt sechs Belege) festgehalten und die Verderbnis in querelis angesiedelt hat, das als Schlusswort auch in Vers 16 steht, so dass ein Antizipationsfehler sehr naheliegt. Das Festhalten an pausa und das Verwerfen von querela am Ende von 15 führt aber fast mit Zwangsläufigkeit zu Munros Konjektur sine ulla. Butterfields Behauptung „sine pausa (with an adjective or without), which first occurs in the tractatus of Zeno of Verona (fr. 370 A. D.), seems at any rate needlessly prosaic“ ist nicht berechtigt: Vgl. nur 1, 1054 sine ullis / ictibus externis, 6, 207 umore sine ullo. Zu Beginn von Vers 15 heißt animi ingratis ‚gegen den Willen ihres animus, im Gegensatz zu dem, wonach sie eigentlich trachten’; es entspricht dem cogi in Vers 16. Die Bedeutung ‚gegen den Willen’ hat ingratis auch an den übrigen Belegstellen bei Lukrez, wo es absolut konstruiert ist; die Verbindung des Ablativs (ursprünglich ingratiis) mit einem Genetiv ist anstandslos und hat eine Parallele bei Plaut. Cas. 315f. uobis inuitis atque amborum ingratiis / una libella (‚für einen Groschen’) liber possum fieri. Subjektsakkusativ zu uexare und cogi (so Cippellarius zwingend richtig statt handschriftlichem coget) saeuire sind die homines (aus 12), was sich nach anxia corda in 14 zwanglos suppliert – nicht anders als in 29 der quid-Satz von exposuit in 26 abhängt, obwohl in 27 uiam monstrauit dazwischen steht. 15f. sind also folgendermaßen zu verstehen: ‚Menschen (und zwar solche, die anxia corda haben) verbringen ihr Leben ohne Unterlass unter Qualen gegen den Willen ihres animus (d. h. obwohl sie von der Seite ihres Denkens und Planens alles tun, um ein gutes Leben führen zu können) und werden gezwungen, unter feindlichen (sie weiter quälenden) Klagen zu toben’.
17
Zu ibi nach vorangegangenem Temporalsatz siehe oben zu 3, 213.
20partim quod fluxum pertusumque esse uidebat
Für fluxum, hier singulär als Attribut zu uas (einer Metapher für den animus) gesetzt, wollte Romanes (1935) 65 fissum schreiben und fand dafür nachdrücklichen Rückhalt bei Watt (1996) 253, der auf Colum. 1, 5, 10 (si summa pars cliui fundata propriam molem susceperit, quicquid ab inferiore mox adposueris fissum erit rimosumque) verwiesen hat. Aber nicht weniger singulär als hier auf uas ist das Adjektiv fluxus bei Tacitus auf muri bezogen (hist. 2, 22, 1): sparsa auxiliorum manus altiora murorum sagittis aut saxis incessere, neglecta aut aeuo fluxa comminus aggredi. Das lukrezische Seelengefäß und die taciteischen Wehrmauern haben gemeinsam, dass sie nicht mehr stabil sind, sondern brüchig, morsch und lose. Das Bild bei Lukrez passt somit vorzüglich und wird zudem durch das eindeutige pertusum genau in dem Sinn festgelegt, den ThLL VI 1, 983, 50 für unsere Stelle konstatiert: „i. q. laxum, rimosum“. Die Verbindung fluxum pertusumque ist schön erklärt von Barigazzi: „La sola differenza consiste nel fatto che in pertusum è la vera idea dell’esser forato, in fluxum quella dello scorrer via: cfr. III, 936–937“ et non omnia pertusum congesta quasi in uas / commoda perfluxere atque ingrata interiere.
28uiam monstrauit, tramite paruo / qua possemus ad id recto contendere cursu.
Merrill (1911) 140 hat an der Richtigkeit von recto (so Laktanz und O2; recta Ω) gezweifelt: „I know of no other example of rectus cursus“. Er wird widerlegt durch Hor. sat. 2, 5, 78 quam (scil. Penelopam) nequiere proci recto depellere cursu, Germ. 346 (Canis) non recto libera cursu, Avien. Arat. 137 rectior undoso cursus sulcatur in aestu. Auf den Spuren Epikurs verläuft der Weg zum summum bonum geradlinig (recto … cursu), nicht auf Abschweifen und langen Umwegen (longis ambagibus: vgl. 6, 919. 1081).
31quidue mali foret in rebus mortalibus passim, / quod fieret naturali uarieque uolaret / seu casu seu ui, quod sic natura parasset
In Deufert (1996) 60 habe ich mich an dem in 31 überlieferten quod gestoßen, „da der Kausalsatz quod sic natura parasset nach naturali … casu seu ui ohne jegliche Bedeutung ein tautologisches Anhängsel“ sei, und das mir von Michael Reeve vorgeschlagene cur (= quor) in den Text gesetzt. Die Frage nach den Ursachen des Übels, wie sie cur einleitet, ist gewiss angemessen (vgl. nur im weiteren Verlauf des Proöms Lukrezens Klage über die ignorantia causarum in 54), schließt sich außerdem gut an die Frage nach der Art des Übels an und geht nicht weniger passend der Frage voraus, wie man solches Übel bekämpfen kann. Dennoch denke ich jetzt, dass ein begründender Kausalsatz, wie ihn das überlieferte quod einleitet, berechtigt und nicht als tautologisches Anhängsel zu kritisieren ist. Vielmehr wird durch den quod-Satz der Gedanke, dass es naturgegebene Übel gibt, dadurch intensiviert, dass sich der Aspekt verlagert: Lag der Fokus in dem relativen quod-Satz auf der Alternative casus und uis, so liegt er jetzt auf der natura: Gleich ob Zufall oder Zwangsläufigkeit dahinter stehen mag, es gibt nun einmal Übel, die von der Natur gegeben und damit unvermeidbar sind. Das Insistieren auch auf dieser Art von Übel, die Epikur ebenfalls zu bekämpfen weiß, passt gut in ein Proöm, das als Gegenpart zu dem Pest-Finale geschrieben ist: Dort führt Lukrez genau solch ein naturgegebenes Übel vor Augen, welches den Menschen letzten Endes et casu et ui heimgesucht hat: Es war Zufall, dass der mortifer aestus / … aera permensus multum camposque natantis, / incubuit tandem populo Pandionis omni (1138–1142). Aber nachdem er sich nun einmal auf die Stadt des Kekrops gesenkt hat, wütet die Pest mit zwangsläufiger Unerbitterlichkeit, weil die Luft mit todbringenden Schadstoffen geschwängert ist (vgl. 6, 1095). Das Insistieren auf dem natürlichen Ursprung solcher Übel – in 5, 1233 spricht Lukrez angesichts eines vernichtenden Seesturms vom Wirken einer uis abdita – ist deshalb so wichtig, weil es einer anderen Erklärung des Übels entgegensteht, nämlich als einer göttlichen Handlung, was (wie Lukrez im weiteren Verlauf des Proöms ausführen wird: 50–55) noch weitaus schlimmeres Unheil zufügt.
33–42
Siehe oben zu 2, 54–61.
44. 46. 47. 48. 49
et quoniam docui mundi mortalia templa
esse <ac > natiuo consistere corpore caelum,
[45] et quaecumque ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Conspectus siglorum
- Buch I
- Buch II
- Buch III
- Buch IV
- Buch V
- Buch VI
- Literaturverzeichnis
- Register
- Corrigenda zu den ‚Prolegomena‘ (UaLG 124)