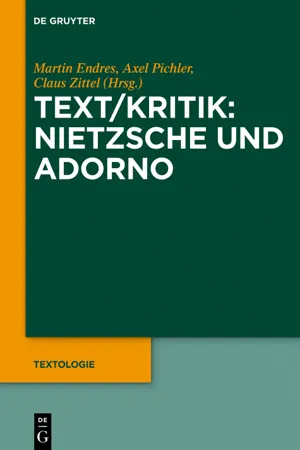
eBook - ePub
Text/Kritik: Nietzsche und Adorno
- 310 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Text/Kritik: Nietzsche und Adorno
Über dieses Buch
Philosophen, Philologen und Editionswissenschaftlern widmen sich der Frage, inwieweit die in den Texten Friedrich Nietzsches und Theodor W. Adornos realisierte "Ästhetisierung des Denkens" als ein zentrales Charakteristikum philosophischer Argumentation erachtet werden muss. Ziel ist eine Neubestimmung philosophischer Lektüre und die Erarbeitung einer Methodik, die sich an der individuellen Verfasstheit und Materialität des Textes bemisst.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Beat Röllin und René Stockmar
Nietzsche lesen mit KGW IX
Zum Beispiel Arbeitsheft W II 1, Seite 1
1. Friedrich Nietzsches Aufforderung, ihn so zu lesen, wie die Philologie »gut lesen [lehrt], das heisst langsam, tief, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Thüren, mit zarten Fingern und Augen lesen …« (M Vorrede 5, KSA 3, S. 17), stellt eine große Herausforderung dar für alle, die sich mit ihm beschäftigen. Es ist eigentlich selbstverständlich: Nietzsche gut zu lesen, muss zuerst und zunächst einmal heißen, gut zu lesen, was Nietzsche zu lesen gab oder zu lesen geben wollte, so, wie er es zu lesen gab oder zu lesen geben wollte – seine Bücher, die druckfertig hinterlassenen Schriften, kurz das autorisierte Werk. Was er gewiss nicht zu lesen geben wollte, sind seine nachgelassenen Aufzeichnungen: philosophische Notizen, Exzerpte, Pläne, Dispositionen, Verzeichnisse, Entwürfe und Reinschriften, daneben auch Briefkonzepte und Gelegenheitsnotizen (Adressen, Besorgungslisten, Berechnungen usw.), überliefert in Notizbüchern und Arbeitsheften sowie auf losen Blättern (herausgetrennte Heftseiten, Folioblätter, Briefpapier usw.). Aber gerade der Nachlass zog von Anfang an großes Interesse auf sich.3 Insbesondere Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche, die Leiterin des Nietzsche-Archivs, das mit der Großoktav-Ausgabe von Nietzsche’s Werke (GA) die erste Werkausgabe herausgab, wollte darin jenes vermeintlich unvollendet hinterlassene Hauptwerk ausfindig machen können, das Nietzsche selbst, ein erstes Mal auf der Umschlagrückseite von JGB (1886), als »[i]n Vorbereitung« befindlich angekündigt hatte: »D e r Will e z u r Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe. In vier Büchern.« (vgl. KGW VI/2, S. 256a) Das editorische Interesse galt folglich vor allem Nietzsches spätem Nachlass, den nachgelassenen Aufzeichnungen ab Frühjahr 1885 (Beendigung von Za IV) bis Anfang Januar 1889 (Zusammenbruch in Turin).4
Nietzsches später Nachlass umfasst vier Notizhefte (N VII 1–4), sechzehn Arbeitshefte (W I 3–8, W II 1–10), vereinzelte Aufzeichnungen in diversen früheren Heften und rund dreihundert in Mappen (Mp XIV–XVIII) gesammelte lose Blätter.5 Aus diesem späten Nachlass veröffentlichte das Nietzsche-Archiv in der Großoktav-Ausgabe eine größere Auswahl von Aufzeichnungen in oft fragwürdiger Textkonstitution. In GA XIII–XIV (1903/04) erschien thematisch-sachlich geordnet Unveröffentlichtes aus der Umwerthungszeit, in GA XV–XVI (1911) die Nachlass-Kompilation Der Wille zur Macht: Versuch einer Umwerthung aller Werthe, die in angeblich werkrekonstruierender Anordnung Nietzsches vermeintliches philosophisches Hauptwerk doch noch zum Vorschein bringen wollte. Die erste Ausgabe von Der Wille zur Macht (WM1) wurde bereits 1901 in GA XV(1901) herausgegeben. Die kanonisch gewordene zweite, »völlig neu gestaltete und vermehrte« Ausgabe (WM2) erschien 1906 zunächst in der Taschen-Ausgabe von Nietzsche’s Werke (TA 9–10) und wurde dann 1911, mit textkritischen Anmerkungen versehen, auch in die Großoktav-Ausgabe als GA XV(1911)–XVI aufgenommen. Die grundlegende Kritik an dieser offenkundigen Werkfälschung, die von Anfang an als solche erkannt werden konnte und auch kritisiert wurde (vgl. Lamm 1906, Horneffer 1907), aber trotzdem über lange Zeit hinweg die Nachlassrezeption bestimmte, findet sich bei Schlechta 1956 und Montinari 1982 (vgl. auch KSA 14, S. 383–400). Doch auch noch in der Schlechta-Ausgabe (SA, 1954–56) erfolgte die vom Ansatz her chronologische Edition »Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre« auf der philologisch völlig unzuverlässigen Textgrundlage von WM2.
Eine von Grund auf neue und kritische Textedition boten erst die von Giorgio Colli und Mazzino Montinari in streng chronologischer Anordnung herausgegebenen »Nachgelassenen Fragmente« vom Nachlass 1885–1889, die in KGW VII/3 (1974) und KGW VIII/1–3 (1970–74), dann in KSA 11–13 (1980, 21988) erschienen sind. Von den ergänzenden philologischen Apparatbänden, die das Verhältnis der edierten Texte zum Manuskriptbefund klären und alle nicht als »Fragmente« in die Textbände aufgenommenen Nachlassaufzeichnungen nachträglich verzeichnen sollten, konnte Montinari jedoch nur den Nachbericht zur VII. Abteilung, KGW VII/4, 1–2 (1984/86), selber realisieren; der Nachweis sämtlicher »Varianten« zu den »Nachgelassenen Fragmenten« ab Herbst 1885 in einem Nachbericht zur VIII. Abteilung und die Mitteilung aller sogenannten »Vorstufen« zu den späten Werken in einem Nachbericht zu JGB bis NW blieben ausstehend.
Anstelle des ursprünglich geplanten Nachberichts zur Nachlassedition in der VIII. Abteilung erscheint seit 2001 in der neu eingerichteten IX. Abteilung (KGW IX) eine Manuskriptedition des Nachlasses ab Frühjahr 1885. Über die Gründe, die zu dieser Neuedition geführt haben, berichten Groddeck 1991b, Kohlenbach/Groddeck 1995 und Röllin/Stockmar 2007. Mit KGW IX wird somit Nietzsches später Nachlass ein drittes Mal philologisch erschlossen, und erstmals integral, manuskriptgetreu und nach einem topologischen Editionsprinzip dokumentiert.
Die editionsgeschichtliche Bedeutung von KGW IX liegt in der Auflösung der von Editorenhand aus Nietzsches Nachlass kreierten Phantom-Texte, die seit dem Erscheinen von Der Wille zur Macht in den Ausgaben herumgeistern und das Bild Nietzsches wesentlich geprägt haben. Zwar haben Colli und Montinari die von Nietzsches Schwester zum »philosophisch-theoretischen Hauptwerk[]« (TA 9, S. XXII) verklärte Nachlass-Kompilation mit der Veröffentlichung der »Nachgelassenen Fragmente« in KGW VII und VIII editorisch als Werkfälschung entlarvt. Doch auch die einem chronologisch-textgenetischen Mischprinzip folgende Edition der »Nachgelassenen Fragmente« beförderte noch die Wahrnehmung des Nachlasses als eines separaten Bestandes zusätzlicher, problemlos zitier- und interpretierbarer Nietzsche-Texte, die sich vom autorisierten Werk nur graduell zu unterscheiden schienen. Denn aus der erneuten Konstituierung geglätteter Lesetexte (»Fragmente«), die nur durch die Ausgliederung aller »Varianten« in einen nachträglich zu erstellenden philologischen Apparat zustande kommen konnten, resultierte in allzu vielen Fällen ein falsch-eindeutiger Text, der so nirgends in den überlieferten Aufzeichnungen steht. Und die systematische Aussortierung von Aufzeichnungen (»Vorstufen«), die eine bestimmte Textnähe zu Nietzsches Werktexten aufweisen und deren Mitteilung deshalb einem Nachbericht zu den späten Werken vorbehalten war, hatte die Zerstörung der ursprünglichen Kontexte der Niederschriften zur Folge (vgl. Groddeck 1991b).
Im Bestreben, Montinaris ursprünglichen Anspruch zu erfüllen, dass »der handschriftliche Nachlaß Nietzsches in seiner authentischen Gestalt bekannt werden [soll]« (Montinari 1982, S. 118), eröffnet KGW IX mit der Faksimilierung und der differenzierten Transkription der Manuskripte einen neuen, unverstellten Zugang zu den nachgelassenen Aufzeichnungen und ihrem typischen Notatcharakter. Die Manuskriptedition erschließt den späten Nachlass in seiner Gesamtheit gemäß der topologischen Anordnung der Aufzeichnungen, ohne nach typologischen Kriterien Textmaterial (Vorstufen, Varianten, Briefentwürfe, Gelegenheitsnotizen) auszusondern. Durch die Wiedergabe aller Korrekturvorgänge, Streichungen, Überarbeitungen usw. gewährt sie Einblick in Nietzsches Schreibwerkstatt und veranschaulicht den Schreibprozess und die Textgenese.
Die diplomatische Umschrift von KGW IX unterscheidet als »differenzierte Transkription« vermittels typographischer Auszeichnungen Nietzsches verschiedene Schreibschriften, Schreibmittel und Schreibvorgänge (vgl. Haase/Kohlenbach 2001, S. XVII).6 Das die Transkription enthaltende, grau hinterlegte Transkriptionsfeld entspricht in seinen Maßen 1:1 dem Manuskript. Die Schriftverteilung auf einer Seite der Transkription folgt – im Rahmen der typographischen Darstellbarkeit – der Schriftverteilung im Manuskript. In der Marginalspalte und dem Fußnotenapparat finden sich editorische Anmerkungen zu Manuskriptbefund und Transkription. In einem Nachbericht zu KGW IX sind weitere Informationen mitgeteilt.7
Sinn und Zweck des editorischen Ensembles von integraler Wiedergabe der Manuskripte nach topologischem Prinzip, differenzierter Transkription, Faksimilierung und Nachbericht ist eine möglichst vollständige, genaue und detaillierte Dokumentation des späten Nachlasses in textkritischer Absicht. Die Textgrundlage der bisherigen Texteditionen in GA und KGW wird offengelegt, das Material für einen neuen, textkritischen Umgang mit dem Nachlass zur Verfügung gestellt.
Am Beispiel der Seite 1 aus dem Arbeitsheft W II 1 lassen sich die Möglichkeiten und die Grenzen der Nachlassdokumentation exemplarisch ausloten.







2. Im Arbeitsheft W II 1, einem 142-seitigen Quartheft in schwarzem Einband, das Nietzsche hauptsächlich im Herbst 1887 in Gebrauch hatte, ist der vordere Innendeckel mit einer liniierten Seite kaschiert, die ebenfalls Aufzeichnungen von Nietzsches Hand enthält und darum, obgleich eine linke Seite, als S. 1 gilt. Die Beschriftung dieser Seite in einer schwarzen und zwei braunen Tinten sowie am unteren Rand mit Bleistift erscheint auf den ersten Blick chaotisch, doch mithilfe der Transkription in KGW IX/6 und ein bisschen Geduld wird man als erste Niederschriften vier kurze Aufzeichnungen (A–D) in schwarzer Tinte ausmachen können, die Nietzsche, sich bei der Erstbeschriftung noch an die vorgegebene Liniierung der Heftseite haltend, durch Leerzeilen voneinander abhob und deren Beginn er jeweils durch einen Einzug der Anfangszeilen (KGW IX/6, W II 1, S. 1, Z. 16, Z. 28, Z. 32, Z. 40)8 markierte:
A

B

C

D

Eine fünfte Aufzeichnung (E), die allem Anschein nach zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt wurde, stellt die Bleistiftnotiz dar, die Nietzsche schräg am unteren Rand...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- Verzeichnis der Siglen
- Nietzsche lesen mit KGW IX. Zum Beispiel Arbeitsheft W II 1, Seite 1
- »all seine Konstruktionen sind aporetische Begriffe«. Eine Adornosche Perspektive auf Nietzsches ›Perspektivismus‹
- Was und wozu ist Adornos Ästhetische Theorie? Von der Schwierigkeit, den Anspruch der Ästhetischen Theorie zu verstehen
- Revisionen. Wiederaufnahme und Fortschreibung einer Lektüre von Adornos Ästhetischer Theorie
- Dichtung und dialektische Bilder in den Kierkegaard-Büchern Adornos
- »›eine antimetaphysische aber artistische‹ Philosophie«. Adornos Inanspruchnahme Nietzsches und anderer Quellen in einer Einfügung zur Ästhetischen Theorie
- Zu Begriff und Verfahren des Kommentars bei Nietzsche und Adorno
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Text/Kritik: Nietzsche und Adorno von Martin Endres, Axel Pichler, Claus Zittel, Martin Endres,Axel Pichler,Claus Zittel im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & German Literary Criticism. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.