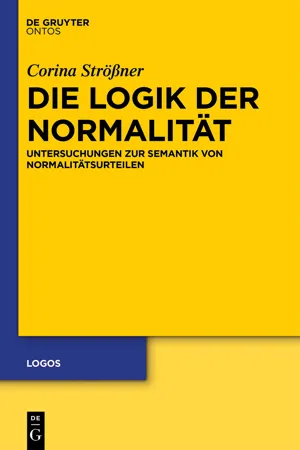
eBook - ePub
Die Logik der Normalität
Untersuchungen zur Semantik von Normalitätsurteilen
- 206 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Normalerweise ist es im Sommer warm. Doch was heißt eigentlich "normalerweise"? Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich die Autorin dieses Buches. Dabei unterscheidet sie statistische von nicht-statistischen Deutungen. Im Lichte dieser Unterscheidung wird die Frage nach der Bedeutung von Normalität aus der philosophisch-logischen Sicht beleuchtet und ein Beitrag zur interdisziplinären Diskussion um die Thematik geleistet.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Logik der Normalität von Corina Strößner im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Logik in der Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Bei den Erscheinungsformen des Edlen und Gerechten, die den Gegenstand der Staatswissenschaft bilden, gibt es so viele Unterschiede und Schwankungen, daß die Ansicht aufkommen konnte, sie beruhten nur auf Konvention, nicht aber auf natürlicher Notwendigkeit. Ähnliches Schwanken herrscht aber auch bei den Lebensgütern, weil schon so manchem Schaden daraus erwachsen ist: es ist schon vorgekommen, daß der eine durch Reichtum, der andere durch Tapferkeit zugrunde ging.
Man muß sich also damit bescheiden, bei einem solchen Thema und bei solchen Prämissen die Wahrheit nur grob und umrißhaft anzudeuten sowie bei Gegenständen und Prämissen, die nur im großen und ganzen [im Original: hos epi to poly - Anm. Verf.] feststehen, in der Diskussion eben auch nur zu entsprechenden Schlüssen zu kommen. Im selben Sinne nun muß auch der Hörer die Einzelheiten der Darstellung entgegennehmen: der logisch geschulte Hörer wird nur insoweit Genauigkeit auf dem einzelnen Gebiet verlangen, als es die Natur des Gegenstands zuläßt. Es ist nämlich genau so ungereimt, vom Mathematiker Wahrscheinlichkeiten entgegenzunehmen wie vom Rhetor denknotwendige Beweise zu fordern.1
Diese Worte lässt Aristoteles in der Nikomachischen Ethik seiner praktischen Philosophie vorangehen. Schon zu Beginn stimmt er seinen Hörer oder Leser darauf ein, dass es dabei anders als in der Logik „so viele Unterschiede und Schwankungen” gebe, dass nicht mit allgültigen Aussagen gerechnet werden dürfe. Aristoteles will Thesen vortragen, von denen er selbst glaubt, dass sie nicht immer und in allen Situationen, aber doch in den meisten Fällen, zutreffen. Es handelt sich also eher um Normalitätsaussagen als um universelle Aussagen.
Nicht nur im Staatswesen und in der Ethik gelten Gesetze und Betrachtungen eingeschränkt. Einige Wissenschaftsphilosophen lehren, dass auch naturwissenschaftliche Erklärungen nur als Normalitätsaussagen verstanden werden können. So weist vor allem Nancy Cartwright immer wieder darauf hin, dass
physikalische Gesetze nur als ceteris paribus Behauptungen zu verstehen seien, die sehr einschränkende und darüber hinaus künstliche Bedingungen voraussetzen: „Most scientific explanations use ceteris paribus laws. These laws, read literally as descriptive statements, are false, not only false but deemed false even in the context of use. This is no suprise: we want laws that unify; but what happens may well be varied and diverse”.2 Beschränkt man ein Gesetz allerdings nur auf die als normal betrachteten Fälle, verliert es an Relevanz in der Anwendung: „Once the ceteris paribus modifier has been attached, the law of gravity is irrelevant to the more complex and interesting situations”.3
Sowohl Aristoteles’ hos epi to poly als auch ceteris paribus in Cartwrights Sinne verweisen auf das Konzept der Normalität: im ersten Fall durch Häufigkeit, im zweiten durch methodische Vereinfachung. Was aber ist Normalität? Was bedeuten die Ausdrücke „normal” und „normalerweise”? Wo und wann ist es gerechtfertigt, sie zu gebrauchen? Gibt es typische Sprachspiele der Normalität? Wie weit hängt die Bedeutung des Wortes vom jeweiligen Kontext ab? Gibt es überhaupt ein einheitliches Konzept der Normalität und eine logische Deutung dafür?
Mit der Theorie der Wahrscheinlichkeit und zahlreichen nicht-klassischen Logiken haben das Unbestimmte und die Vagheit längst ihren Platz in den exakten Wissenschaften gefunden. Anders als für Aristoteles ist es für uns heute nicht abwegig, „vom Mathematiker Wahrscheinlichkeiten entgegenzunehmen”. Das heißt nicht, dass wir auf Beweise und methodische Genauigkeit verzichten würden, aber als Thema sind unscharfe Konzepte für die formalen Wissenschaften alles andere als ungereimt. Eine analytisch-philosophische Beschäftigung mit Normalität wird durch diese Entwicklungen unterstützt.
Die Frage nach der Bedeutung von Normalität stellt uns vor einige Probleme. Ist es zum Beispiel plausibel, Normalitätssätze lediglich als Ausdruck subjektiver Einstellungen oder intersubjektiver Prägungen zu verstehen oder sind sie nicht auch objektiv? Nicht minder groß sind die Unklarheiten in Bezug auf die Normativität oder Deskriptivität. Dem Wort „normal” nach möchte man meinen, dass eine enge Verbindung zwischen Normalität und Norm besteht. Andererseits wird selbst von einigen unmoralischem Handlungsweisen, soweit sie weit verbreitet sind, gesagt, sie seien normal.
dp n="11" folio="3" ?
Obwohl es scheint, als gäbe es kein einheitliches Normalitätsverständnis, entstehen im Gebrauch selten sprachliche Missverständnisse, wenn „normal” oder „normalerweise” benutzt wird. Dementsprechend setzt diese Untersuchung nicht dabei an, alle in Frage kommenden semantischen Eigenarten von „Normalität” aufzulisten und gegeneinander abzuwägen. Diese Arbeit sucht sich stattdessen einen pragmatisch-logischen Ausgangspunkt: Was tut jemand, wenn er von Normalität spricht? Wozu tut er es? Welche Konsequenzen hat das für seine Argumentation? Die grundlegende Arbeitshypothese soll dabei die folgende sein: Normalität ist eine logische Kategorie, die sich dadurch auszeichnet, im Einzelfall Prognosen zu bedingen, die solange gerechtfertigt sind, bis neue Evidenzen zur Verfügung stehen. Grundlage der Prognose sind die Normalitätsannahmen, die sich sprachlich als Normalitätsaussagen ausdrücken. Insofern sie mit einem solchen Satz äquivalent sind, sind auch generische Sätze Normalitätsaussagen. Zum Beispiel ist „Vögel können fliegen” eine Normalitätsaussage, wenn damit dasselbe wie mit „Vögel können normalerweise fliegen” gemeint ist.
Es sind mehrere Arten von Normalitätsaussagen zu unterscheiden:
- Gattungsbezogene Normalitätsaussagen: Sie beziehen sich auf einen Subjektbegriff. So kann zum Beispiel die Physiologie der Menschen beschrieben werden, wobei von dem Menschen im Allgemeinen die Rede ist. Subjekt ist dabei ein genereller Term beziehungsweise, in der Begrifflichkeit moderner Logik, ein Prädikat.
- Modale Normalitätsaussagen: Sie handeln von einem Individuum in einer Art von Situationen. Als modale Normalitätsaussagen sollen hier nur Sätze mit einem singulären Ausdruck als Subjekt verstanden werden. Ein Beispiel ist die Beschreibung von Lebensgewohnheiten eines einzelnen Menschen.
- Gemischte Normalitätsaussagen: Nicht immer ist beides klar zu trennen. Prädikats- und Situationsbezug können in einem Satz gemeinsam auftreten. Die Aussage „Menschen schlafen normalerweise nachts” ist gattungsbezogen, insofern von Menschen die Rede ist, aber modal, da von einer Art von Situationen, nämlich den Nächten, gesprochen wird.
Zu einer Prognose tragen Normalitätsaussagen bei, wenn sie für eine Entität beziehungsweise für ein Ereignis relevant sind. Die einzelnen Normalitätsannahmen und die prognostischen Aussagen, die sie im Einzelfall erlauben, sind in Tabelle 1.1 dargestellt.
dp n="12" folio="4" ?
| RELEVANTE NORMALITÄTSAUSSAGE | PROGNOSE | |
|---|---|---|
| S sind normalerweise P. | x ist S. | x ist vermutlich P. |
| Bei E ist x normalerweise P. | E liegt vor. | x ist vermutlich P. |
| Bei E sind S normalerweise P. | x ist S. E liegt vor. | x ist vermutlich P. |
Tabelle 1.1: Normalität und Prognose
Damit sind wesentliche Formen von Normalitätsaussagen und ihr prognostischer Sinn vorgestellt. Der Ausdruck „vermutlich” in den Folgerungen verdeutlicht, dass sie mit weiteren Prämissen widerlegt werden können. Schließen aufgrund von Normalität ist nicht monoton. Insbesondere wenn man erfährt, dass x eine Ausnahme und nicht P ist, und dies als weitere Prämisse anerkennt, sind diese Schlüsse nicht mehr gerechtfertigt.
Was liegt aber diesen Normalitätsaussagen zugrunde? Die Aussage „S sind normalerweise P” kann so verstanden werden, dass sie „Die meisten S sind P” bedeutet. Dementsprechend ist „Bei Ereignis E ist x normalerweise P” zu „Meistens, wenn E vorliegt, ist x P” oder, um die quantitative Komponente zu unterstreichen, zu „In den meisten E-Fällen ist x P” umformulierbar. Die stärksten denkbaren Normalitätssätze sind dabei universelle Aussagen. Diese sind Spezialfälle von quantitativer Normalität. Dass dies zunächst seltsam anmutet, liegt daran, dass Normalitätsaussagen bei Universalität untertrieben sind. Aber deswegen sind sie nicht falsch. Menschen sind normalerweise sterblich, auch wenn alle Menschen sterblich sind. Schwieriger ist es, die untere Grenze der Quantität für Normalität festzulegen. Damit etwas quantitativ als normal gelten kann, würden wir einen sehr hohen statistischen Wert erwarten. Wo ist aber die Grenze zu setzen? Im Prinzip kann jeder Wert in Erwägung gezogen werden, der größer als 50 Prozent ist. Jeder dieser Werte stellt sicher, dass eine Prognose, die aus einer entsprechenden Aussage gezogen wird, zumindest mit größerer Wahrscheinlichkeit zutrifft als scheitert. Eine wichtige Entscheidung ist jedoch, ob dieser Grenzwert vage bleibt oder ob er fest ist.4
Dem kurz umrissenen quantitativen Verständnis ist eines gegenüber zu stellen, welches sich auf typische Eigenschaften oder Vereinfachungen stützt. Nach diesem qualitativen Konzept ist die Aussage „S ist normalerweise P” als „Ein typisches S ist P” oder „Vereinfacht betrachtet ist S P” zu verstehen. Es ist dabei nicht notwendig, dass besonders viele S P sind. Auch hier begünstigt Normalität
Prognosen, denn zunächst nehmen wir an, dass Dinge und Ereignisse normal sein werden.
Das logische Wesen verschiedener Normalitätskonzeptionen ist Thema dieser Abhandlung, die unter der Frage steht, mit welcher Logik wir Normalitätsaussagen unterlegen sollten. Im folgenden Kapitel setzen wir uns mit quantitativer Normalität auseinander. Dabei soll eine formale Theorie entwickelt werden, die Ansätze aus der klassischen Prädikatenlogik, der Theorie der generalisierten Quantoren und der Wahrscheinlichkeitstheorie zu einer quantitativen Logik der Normalität vereint. Daraufhin werden einige bekannte qualitative Theorien der Normalität vorgestellt und mit der quantitativen Logik der Normalität verglichen.5
Wir widmen uns dabei zum einen solchen Logiken und Interpretationen, in denen es um eine übergreifende Plausibilitätsordnung geht, und zum anderen solchen, die typische Eigenschaften bestimmter Individuen oder Situationen thematisieren.6 Sowohl die globale als auch die lokale Variante der qualitativen Normalität setzt keinen Zusammenhang mit Mehrheiten voraus. Die Frage, inwiefern dieser Verzicht auf Rechtfertigung von Normalität durch Majorität philosophisch akzeptabel ist, wird im letzten Kapitel diskutiert. Wir werden dabei sehen, dass Normalitätsaussagen, soweit sie einen deskriptiven Anspruch haben, einen starken logischen Zusammenhang zu entsprechenden statistischen Urteilen aufweisen. Dennoch bemerken wir, dass Normalität nicht auf quantitative Aussagen zu reduzieren ist.
2 Quantitative Normalität
Die Interpretation von Normalität durch Quantität ist insofern statistisch, als...
Inhaltsverzeichnis
- Die Logik der Normalität
- Logos
- Titel
- Impressum
- Dank
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Quantitative Normalität
- 3 Qualitative Normalität
- 4 Normalität zwischen Quantität undQualität
- Literatur
- Personenregister
- Sachregister