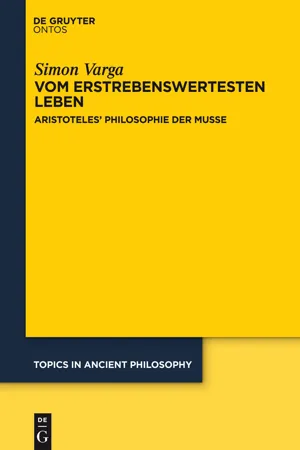![]()
Teil A: Vom erstrebenswertesten Leben
dp n="18" folio="8" ? dp n="19" folio="9" ? ![]()
1 Die Politik und die Frage der Lebensform
Im Zentrum dieser Studie steht eine Auseinandersetzung mit der scholê bei Aristoteles – primär, aber nicht ausschließlich – anhand von Politik VII und VIII. Da es sich bei diesen beiden letzten Büchern der Schrift um eine eigenständige Abhandlung handelt, müssen wir die anderen Themen die darin angesprochen werden mit berücksichtigen und dabei fragen, in welches Gesamtkonzept Aristoteles sein scholê-Verständnis eingefügt hat. Dafür bietet bereits der erste Satz aus Politik VII einen wichtigen Anfang:
»Wer über die beste Verfassung die Untersuchung in sachgemäßer Weise anstellen will, der muss notwendig zuerst bestimmen, welches das wünschenswerteste Leben ist« (Pol. VII 1, 1323a14ff).
Zwei Themen werden hier deutlich angesprochen, die in den darauffolgenden Überlegungen Gegenstand der philosophischen Erörterungen sein werden und die bereits an dieser Stelle ein großes und dichtes Programm ankündigen. Zum einen fragt Aristoteles nach einer Untersuchung der besten Verfassung einer Polis, der sogenannten aristê politeia, im Grunde genommen ein klassisches Motiv – nicht ausschließlich aber insbesondere – der antiken politischen Philosophie. Zum anderen führt er an dieser Stelle an, dass eine Untersuchung der besten Verfassung aus seiner Perspektive nur dann in sachgemäßer Art und Weise erfolgen kann, wenn zuerst eine Bestimmung darüber getroffen wird, welches Leben das wünschenswerteste, der hairetôtatos bios, ist.
Hiermit wird bei Aristoteles offensichtlich ein gegenseitiger Bezug zwischen diesen beiden Themenbereichen angedeutet, der heute auf einen ersten Blick vielleicht verwundern mag. Was hat das „wünschenswerteste Leben“ des einzelnen Menschen mit einer Untersuchung der „besten (staatlichen) Verfassung“ einer (politischen) Gemeinschaft zu tun? Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum es für Aristoteles überhaupt wichtig erscheint, vor einer Untersuchung bzw. Darstellung seiner aristê politeia über den hairetôtatos bios zu sprechen und zusätzlich auch noch gleich einleitend dazu zu behaupten, dass eine Klärung des letzteren Bereichs für eine sachgemäße Auseinandersetzung mit dem ersteren vorab notwendig erscheint? Hinzu kommt die für diese Studie wichtigste Frage, nämlich mit welcher Absicht Aristoteles die scholê in diese philosophische Abhandlung eingebaut hat?
dp n="20" folio="10" ? Diesen und anderen, weiterführenden Fragen rund um die scholê soll in dieser Studie anhand dger aristotelischen Ausführungen sowie ihrer gegenwärtigen Auslegungen in der Forschung nachgegangen werden. Dabei möchte ich zeigen, dass die Interpretationen sowohl des hairetôtatos bios als auch jene der aristê politeia erstens divergieren und zweitens einige kleinere, aber nicht unbedeutende Details dieser beiden Bereiche zumeist unzureichend ausgelegt und gelegentlich in einen zumindest fragwürdigen Kontext gestellt werden. Hinzuzufügen ist dabei gleich vorweg, dass das Thema der aristotelischen Bestimmungen zum hairetôtatos bios im Kontext mit Politik VII und VIII über die aristê politeia in der Aristoteles-Forschung der vergangenen Jahrzehnte kaum eine Rolle gespielt hat, umso weniger noch in Bezug auf die aristotelische politische Philosophie im Gesamten.
Meine These ist, dass zum einen die klare Frage nach dem wünschenswertesten Leben und zum anderen die Frage nach der besten Verfassung nur zusammen nachvollzogen und ausschließlich im gemeinsamen Wechselbezug aufeinander beantwortet und so auch umfassend verstanden werden können. Hinzu kommt, dass innerhalb dieser philosophischen Erörterungen der scholê ein wichtiger Wert zugesprochen wird und sie eine tragende Rolle innerhalb der Konzeption in Politik VII und VIII einnimmt. In der Aristoteles-Forschung findet die scholê allerdings wenig bis gar keine Beachtung. Meiner Ansicht nach lässt sich jedoch anhand dieser Überlegungen deutlich machen, wie eng die hier genannten Themen miteinander verknüpft sind und dass sie den eigentlichen Kern dieser beiden Bücher ausmachen, der sich ohne die scholê nicht gänzlich fassen lässt. Zumal sie eines der besten Beispiele dafür ist, wie Aristoteles innerhalb seiner politischen Philosophie die Verknüpfung von Politik im weiteren Sinne auf der einen Seite und der Glückseligkeit des einzelnen Menschen auf der anderen Seite gedacht hat. Hinzu kommt, dass die scholê, insbesondere in Bezug auf Politik VII und VIII, innerhalb der Aristoteles-Forschung heute zwar ein Schattendasein führt, jedoch ein reiches geistesgeschichtliches Erbe darstellt, dessen Wiederentdeckung sich durchaus lohnt.
Doch bevor wir uns einer solchen Untersuchung der angesprochenen Themen zuwenden, also dem hairetôtatos bios, der aristê politeia und später insbesondere dem Hauptbegriff dieser Studie, der scholê, ist es um der Orientierung willen erforderlich, sich vorab Gedanken darüber zu machen, wo wir uns mit solch einem Vorhaben in dem umfangreichen aristotelischen Kanon befinden und in welchen Teilbereichen seiner (politischen) Philosophie wir uns bewegen werden. Erstens werde ich dafür auf Wirkung und Spezifika der aristotelischen Politik im Gesamten anhand einiger ausgewählter Ergebnisse der heutigen Forschung hinweisen (vgl. Kap. 1.1). Zweitens wird in den Bereich der sogenannten „Philosophie der menschlichen Angelegenheiten“ eingeführt, den Aristoteles in seiner Politik, aber auch in seiner Nikomachischen Ethik (EN) entwickelt hat, und im Zuge dessen wird ebenso die Systematik seiner Argumentation innerhalb dieses Bereiches angesprochen (vgl. Kap. 1.2).
1.1 Zur Rezeptionsgeschichte der Politik
Die aristotelische praktische Philosophie, wie sie uns vor allem in den beiden großen Werken, der Politik sowie der Nikomachischen Ethik, überliefert wird, bildet „einen der wichtigsten Ausgangspunkte für die westliche Tradition politischen Denkens“ (Horn/Neschke-Hentschke: 2008, VII). In der Antike wurde sie umfassend aufgearbeitet und in der Stoa bereits teilweise kritisch rezipiert, im Hoch- und Spätmittelalter sehr geschätzt und vielfach kommentiert (so z.B. bei Thomas von Aquin), in der Neuzeit gelegentlich gerne als Ausgangspunkt und Reibefläche für die Entwicklung neuer politischer Theorien verwendet (unter anderen bei Thomas Hobbes); in der Gegenwart immer wieder Bezugspunkt unterschiedlicher philosophischer Fachdiskurse und aktueller Theorien, wie z.B. bei Hannah Arendt, Joachim Ritter, Otfried Höffe, John Rawls oder Martha Nussbaum. Die Rezeptionsgeschichte der aristotelischen praktischen Philosophie ist zwar nicht konfliktfrei und nicht ohne Bruchstellen, aber dennoch eindrucksvoll und nachhaltig.
Insbesondere die Politik gilt als Meisterwerk der praktischen Philosophie. Sie gehört seit der Antike zu den Standardwerken und hat fachübergreifend Anklang gefunden. Höffe weist darauf hin, dass die Politik nicht ausschließlich von Philosophen, klassischen Philologen oder Althistorikern studiert und ausgelegt, sondern auch von Rechts- und Verfassungstheoretikern, von Politologen sowie von einigen empirisch ausgerichteten Sozialwissenschaftern interpretiert wird und dabei heute noch als anregender Bezugspunkt dient (vgl. Höffe: 2006a, 238). Speziell die gegenwärtige politische Philosophie und ihre unzähligen Diskurse wären in dieser Art und Weise ohne das aristotelische Erbe in diesen Angelegenheiten nur schwer vorstellbar, da sein Denken in der Politik als auch in der Nikomachischen Ethik dieses Feld maßgeblich geprägt hat. Auf diese Tatsache weist unter anderen auch Bien pointiert hin. Die Politik hat also über die Zeiten hinweg einen starken Nachhall gefunden. Grund dafür ist jedoch nicht nur der philosophische Inhalt, sondern auch die Charakteristik als Werk. Dabei sticht vor allem die Möglichkeit hervor – welche nicht ausschließlich als Problem, sondern ebenso als Chance verstanden werden kann –, die Politik unterschiedlich zu lesen und auszulegen. Die beeindruckende Nachwirkung ist also auch auf das Faktum zurückzuführen, dass die Politik dem aufmerksamen Leser verschiedene Lesearten möglich macht. Hinzu kommt, dass die Politik ein „stark inhomogener Text“ ist, der „keine kohärente Theorie anbietet, sondern divergierende Teilprojekte enthält, die aller Wahrscheinlichkeit verschiedenen Werk- und Reflexionsphasen des Aristoteles entspringen“ (Horn/Neschke-Hentschke: 2008, VIII). Bei einem Umgang mit dem gesamten Text sowie auch mit vereinzelten Passagen quer durch die Bücher der Politik erscheint es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass sie als Ganzes betrachtet kein ausgeglichenes, in allen Bereichen in sich geschlossenes Werk darstellt (vgl. Mesk: 1973, 19). Es handelt sich vielmehr um einen antiken Text, der verschiedene philosophische Ansätze und Ausführungen des aristotelischen politischen Denkens zu den unterschiedlichsten Themen enthält. Die Politik ist demnach also „kein Werk aus einem Guss“ (Höffe: 2006a, 239).
Ein Grund für die angesprochene Möglichkeit unterschiedlicher Interpretationsarten der Politik, liegt mit Sicherheit in der Ausdruckskraft der altgriechischen Sprache und dem damit verbundenen Problem der Übersetzung. Der akademische Diskurs zu Aristoteles im 20. Jahrhundert hat unter anderem auch aufgrund dessen eine Vielzahl an philologisch geprägten Forschungen und Debatten in den Vordergrund gestellt. Dem Bereich der klassischen Philologie und den Altertumswissenschaften kommt daher an der Erneuerung der aristotelischen praktischen Philosophie im 20. Jahrhundert ein großer Anteil zu. Ziel der philologischen Forschung war es, innerhalb des aristotelischen Sprachgebrauchs eine spezifische Entwicklungsgeschichte herauszuarbeiten und nachvollziehbar zu machen. Diskutiert wurden dabei zum einen die Authentizität und zum anderen die Kohärenz der Werke. Keine andere Studie war dabei so prägend wie jene von Jaeger, die er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erstellt hatte und die im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte intensiv diskutiert wurde. Das Ziel seiner Untersuchungen war es, das aristotelische Gesamtwerk als das Ergebnis eines dynamischen Lebensprozesses dieses antiken Philosophen darzustellen, der seine Werke immer wieder ergänzt sowie seine Themen stets weiterbehandelt und sich dabei Schritt für Schritt von der Philosophie seines Lehrers Platon entfernt hat. Diesen philosophisch-dynamischen Lebensprozess bezog Jaeger aber nicht nur auf die Texte der Politik, sondern vor allem auf jene der Metaphysik (Met.), die ähnlich wie die Politik kein gänzlich in sich geschlossenes Werk darstellt, sondern vielmehr den Aufzeichnungen selbstständiger Einzelabhandlungen gleicht (vgl. Höffe: 2006a, 145).
In Bezug auf die Politik unternahm Jaeger den Versuch, die unterschiedlichen Bücher in von ihm zuvor datierte Lebensabschnitte des Aristoteles zu gliedern. Dabei stützte er sich auf philologisch und quellenkritisch angelegte Studien. Jaeger definiert eine „Urpolitik“, also einen Kern an Texten aus der Politik, die als erste entstanden sein sollen, nämlich die Bücher II, III, VII sowie VIII, und ordnet deren Entstehung in die zweite Lebensphase des Aristoteles, den von Jaeger sogenannten „Wanderjahren“, zu. Die Bücher IV, V und VI bezeichnet er als „empirische Bücher“ und ordnet ihre Entstehung in die „Meisterjahre“, also in die dritte Lebensphase des Aristoteles während seiner Zeit am Lykeum in Athen, ein. Das I. Buch der Politik, so Jaeger, sei zu einem späteren Zeitpunkt als eine Art Einleitung zu den anderen Büchern hinzugekommen (vgl. Jaeger: 1955, 271ff). Mit dieser Theorie wurde eine Debatte ausgelöst, die lange Zeit die Aristoteles-Rezeption in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt und die sich primär an diesen philologischen Untersuchungen orientiert hat, auch wenn sich diverse Buchfolgedebatten im Grunde genommen bis ins Mittelalter hinein zurückverfolgen lassen (vgl. Frank: 1999, 32). Vor allem in Bezug auf die Politik und ihre möglichen bzw. überaus wahrscheinlichen unterschiedlichen Entstehungsschichten, auf die wir zuvor schon mit Blick auf Horn und Neschke-Hentschke hingewiesen haben, wurde viel debattiert, was auch Keyt und Miller betonen....