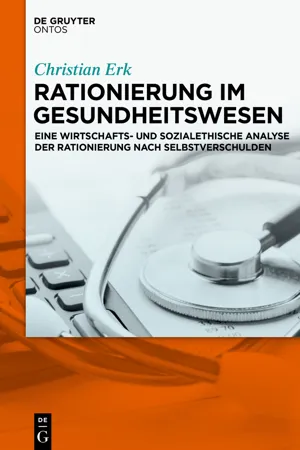
eBook - ePub
Rationierung im Gesundheitswesen
Eine wirtschafts- und sozialethische Analyse der Rationierung nach Selbstverschulden
- 440 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Rationierung im Gesundheitswesen
Eine wirtschafts- und sozialethische Analyse der Rationierung nach Selbstverschulden
Über dieses Buch
Diese Publikation befasst sich mit einer umstrittenen Handlungsstrategie zum Umgang mit dem chronischen Finanzierungsdefizit unserer Gesundheitswesen: der Rationierung anhand des Kriteriums Selbstverschulden.
Wie argumentiert wird, ist die Rationierung nach Selbstverschulden grundsätzlich moralisch zulässig, jedoch nur in einer sehr begrenzten Anzahl von Fällen möglich. Deswegen sollte vom Einsatz dieses Rationierungskriteriums abgesehen werden.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Rationierung im Gesundheitswesen von Christian Erk im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophy & Ethics & Moral Philosophy. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Fußnoten
I Einleitung: Sinn, Ziel und Aufbau dieser Arbeit
| 1 | Wenn im Folgenden von „unseren Gesundheitswesen“ die Rede ist, so sind damit vorallem die Gesundheitswesen Deutschlands, der Schweiz und Österreichs gemeint. Viele der diese betreffenden Aussagen lassen sich jedoch über den deutschen Sprachraum hinaus verallgemeinern. Unter einem Gesundheitswesen wird im Rahmen dieser Arbeit die Gesamtheit aller Menschen, Handlungen, Institutionen, Normen, Sachmittel, Geldmittel und Berufe verstanden, deren Ziel und Zweck darin besteht, den Gesundheitszustand und die Gesundheitshaltung der ein Gesundheitswesen (mit‐) konstituierenden lebendigen Menschen zu erhalten (Krankheitsverhütung), zu verbessern/ fördern (Gesundheits förderung) und/ oder (wieder‐)herzustellen (Therapie/ Intervention/ Kuratm bzw. Behandlung und Heilung von Krankheit) (vgl. hierzu auch Kapitel III.4.3). |
II Rationierung als Mittel zur Bekämpfung des chronischen Finanzierungsdefizits unserer Gesundheitswesen
| 2 | So wird Gesundheit von einer Reihe von Autoren als „konditionales Gut“ (vgl. Wils & Baumann-Hölzle, 2013: 36; Groß, 2007: 339; Gosepath, 2007a: 20; Kersting, 1999:152) „Ermöglichungsgut“ (vgl. Zimmermann-Acklin, 2006:3) bzw. „transzendentales Gut“ (vgl. Kersting, 2002:42; Kersting, 2000: 481– 490; Kersting, 1999:152; Höffe, 2002: 231; Honnefelder, 2007: 23; Gosepath, 2007a: 20; Marckmann, 2008: 888) bezeichnet, also als ein Gut, dessen Besitz die Grundlage zur Verwirklichung anderer Güter bildet bzw. „das alle Menschen benötigen, egal welche Ziele und Pläne sie verwirklichenmöchten“ (Marckmann, 2010a: 6; 2007): „Vonderartigen Gütern giltallgemein, dass sie nicht alles sind, alles aber ohne sie nichts ist. Sie besitzen einen Ermöglichungscharakter; ihr Besitz muss vorausgesetzt werden, damit die Individuen ihre Lebensprojekte überhaupt mit einer Aussicht auf Minimalerfolg angehen, verfolgen und ausbauen können.“ (Kersting, 1999:152) In ähnlicher Weise beschrieb bereits für Descartes (2011: Sixième partie (sechster Abschnitt)) Gesundheit als „sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie“. Der Sichtweise, nach der Gesundheit zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit alles nichts ist, und die Gesundheit zum höchsten Gut stilisiert, sollte allerdings mit Skepsis begegnet werden, da sie Ausdruck eines „irrationalen Gesundheitskults“ (Maio, 2010:95) ist; ohne Gesundheit ist noch lange nicht alles nichts, genauswowenig wie sie die in jedem Fall notwendige Voraussetzung für ein gutes Leben ist. Wäre Gesundheit das höchste Gut, dann würde sie darüber hinaus auch das höchste Opfer rechtfertigen. Ähnlich sieht es auch Bohrmann (2005: 229): „Gesundheit ist ein fundamentales Gut‘, ohne das die autonome Führung eines gelingenden Lebens und die gesellschaftliche Partizipation erschwert werden. Allerdings darf man Gesundheit nicht als das höchste Gut verstehen.“ Zudem ist auch zu bedenken: „Wenn ohne Gesundheit tatsächlich alles nichts ist, dann impliziert dieser moderne Trend, dass damit das Leben all derjenigen, die nicht mehr gesund sind oder nie gesund waren, dass ihr Leben im Grunde „nichts ist“. Wenn ohne Gesundheit alles nichts ist, dann ist für die chronisch Kranken, für die behinderten Menschen, für die alten Menschen jede Chance vertan, überhaupt noch ein gelingendes Leben zu führen.“ (Maio, 2010: 96) |
| 3 | In Blankart (2012: 202; vgl. auch Blankart, Fasten & Schwintowski, 2009:18) findet sich eine Aufstellung, aus der hervorgeht, dass z.B. in Deutschland seit 1977 nicht weniger als 14 Gesundheitssystemreformgesetze verabschiedet worden sind. Für eine Übersicht über die Gesund-heits-und Strukturreformen in Deutschland in den Jahren zwischen 1989 und 2008 siehe Böhm & Müller (2009:12f). |
| 4 | Die Gesundheitspolitik – und damit die Entscheidungen zur Ausgestaltung und Reform unserer Gesundheitswesen – wird nicht nur durch Lobbyisten (vgl. Bartsch, 2010; Fischer, 2010), sondern darüber hinaus durch eine Vielzahl von teilweise als „veto players“ (Tsebelis, 2002:19) fungierenden Personen und Gruppen beeinflusst. Die Wirkung von unter solchen Bedingungen ausgehandelten Reformen – auch wenn sie zu einem geringeren Defizit oder für eine gewisse Zeit gar zu einer Kostendeckung im Gesundheitswesen führen – ist tendenziell kurzfristiger und wenig weitreichender Natur, da durch sie, wie Blankart (2012: 212) anmerkt, „nicht notwendigerweise Ineffizienzen (beseitigt werden), sondern […] die Präferenzen jener Gruppen beschnitten (werden), die sich am wenigsten wehren können“. |
| 5 | Wie Wils & Baumann-Hölzle (2013:14) anmerken, ist dies „aber hauptsächlich auf die häufigen Gesetzesänderungen, auf unterschiedliche IT-Systeme, auf das Überangebot an Produkten und Dienstleistungen und auf die immer noch wachsende Komplexität des Gesundheitssystems insgesamt zurückzuführen“. Auch Candidus beklagt die „unnötige und unproduktive Ausweitung der Bürokratie“ (Candidus, 2009: 231), die zur Folge hat, dass „immer mehr qualifizierte Mitarbeiter der Medizin, der Therapie oder der Pflege […] nicht mehr in der Lage (sind), sich dem Versicherten und Patienten ausreichend qualifiziert zu widmen, da sie am Schreibtisch Dokumentationen für Dritte erledigen müssen.“ (Candidus, 2009: 231) |
| 6 | Dass die Klagen über Missstände im Gesundheitswesen nicht unbedingt neu sind, zeigt folgende Aussage von Johannes Messner aus dem Jahr 1956: „Die Klagen hinsichtlich der Sozialversicherung für den Krankheitsfall kommen von allen Seiten. Die Patienten sehen sich einer ständig wachsenden Bürokratie mit allen Gefahren eines bürokrak tischen Absolutismus gegenüber, darunter der Tendenz zur Überausdehnung des Verwaltungsapparates mit der gleichzeitigen Tendenz zur Beschränkung der Leistungen. Die Gesunden sehen sich zu Beitragsleistungen an eine Versicherung verpflichtet, in der das Versicherungsprinzip alle Geltung verloren hat. Die Sparwilligen sehen sich zur Preisgabe von Einkommensteilen gezwungen, die Eingriffe in ihr Eigentumsrecht und ihre Sparmöglichkeiten darstellen. Die Ärzte sehen sich Gewissenskonflikten gegenüber, weil ihnen die Krankenkassen, hinsichtlich Therapien, Medikamenten und Krankmeldung weitgehende Beschränkungen auferlegen; außerdem weiß sich eine Großzahl der nicht als Krankenkassenärzte zugelassenen Arzte in ihrer Berufsausübung, im ‚Recht zur Arbeit‘, geschädigt, und die Ärzteschaft im allgemeinen sieht in dem Behandlungsbetrieb der überbeanspruchten Kassenärzte mit dem drohenden Mangel an Zeit für den einzelnen Patienten eine unverantwortliche Erscheinung. Die Krankenanstalten sehen sich in einen ständigen Kampf mit den Krankenkassen um gerechtere Pflegesätze verwickelt. Die Apotheker sehen sich mancherorts vor Bestrebungen der Krankenkassen zur Errichtung kasseneigener Apotheken, was eine schwere Schädigung ihrer wirtschaftlichen Existenz zur Folge haben müßte. Der Volkswirt sieht eine Quelle ungeheurer Verschwendung nicht nur irrfolge des Bezuges gar nicht verwendeter Medikamente und des nicht gerechtfertigten Bezuges von Versicherungsleistungen, sondern auch der schweren Beeinträchtigung der Eigenverantwortung und des Eigensparens.“ (Messner, 1956: 629) |
| 7 | Von dem erwähnten strategischen Problem grenzen Oberender & Zerth ein „taktisches Problem“ ab, nämlich die „bestmögliche Verwendung dieser knappen Ressourcen der Gesundheitsversorgung“ (Oberender & Zerth, 2007:102). |
| 8 | Wenn von Gesundheits(dienst)leistungen die Rede ist, dann ist hierin sowohl die Erbringung von der Gesundheit dienlichen Dienstleistungen als auch die Herstellung/ Produktion von der Gesundheit dienlichen Gütern eingeschlossen. |
| 9 | Anstelle des Ausdrucks „kollektiv“ findet sich auch der den gleichen Sachverhalt bezeichnende Ausdruck „öffentlich“ oder „sozial“. |
| 10 | Anstelle von individueller Finanzierung wird nicht selten auch von „privater“ oder „eigenverantwortlicher“ Finanzierung gesprochen. |
| 11 | Widmer (2011:179) bezeichnet diese Finanzierungsform auch als „Zwangsfinanzierung“. In Deutschland wird für „obligatorisch“ auch der Ausdruck „gesetzlich“ verwendet, um so den verpflichtenden Charakter dieser Finanzierungsform zum Ausdruck zu bringen. |
| 12 | Für den Zeitraum zwischen 2000 und 2008 hat Widmer (2011: 138; 141) folgende Wachstumsraten errechnet: „Während die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung zwischen 2000 und 2008 um 46 Prozent gestiegen sind, war das Wachstum der eigenverantwortlich getätigten Out-of-pocket-Ausgaben mit 23 Prozent nur etwa halb so gross! Die privat finanzierten Out- of-pocket-Ausgaben sind zwischen 2000 und 2008 sogar deutlich weniger stark gewachsen als das BIP (29 Prozent).“ |
| 13 | Um genau zu sein: Unseren Gesundheitswesen liegt nicht (mehr) dieses Maximalversprechen zugrunde, sondern das Versprechen der Finanzierung der Inanspruchnahme derjenigen Ge- sundheits(dienst)leistungen, die in einem mehr oder weniger umfangreich definierten Leistungskatalog (Grundversorgung) festgeschrieben sind. |
| 14 | In diesem Zusammenhang könnte man auch anstelle von Gesundheitskosten bzw. Gesundheitsausgaben von Krankheitskosten bzw. Krankheitsausgaben sprechen. GA stellt aber auch den Umsatz der Gesundheits(dienst)leistungserbringer dar. |
| 15 | Da es hier, wie im vorangegangen Kapitel erläutert, um den kollektiv zwangsfinanzierten Teil des Gesundheitswesens geht, müßte der Genauigkeit halber anstelle von GE von GE öffentlich, also dem kollektiv zwangsfinanzierten Teil von GE, die Rede sein. |
| 16 | Für den Fall, dass GE * GA und GE > GA, entsteht ein Finanzierungsüberschuss. |
| 17 | Für eine Analyse der Entwicklung der Kosten der Gesundheitswesen von Deutschland, Österreich und der Schweiz für den Zeitraum zwischen 1960 und 2011 siehe Kapitel 1 des Anhangs. |
| 18 | Diese Aufzählung ist keinesfalls als abschließend zu verstehen. Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, die die Finanzierbarkeit unserer Gesundheitswesen negativ beeinflussen. Bei den erwähnten Faktoren handelt es sich jedoch um die wesentlichen und in praktisch jeder Publikation zur Zukunft des Gesundheitswesen als kausal zum Finanzierungsdefizit beitragend genannten. Als ausgabensteigernd wird immer wieder auch das Vorliegen von Informationsasymmetrien und der sich theoretisch aus diesen ergebenden Phänomene der adversen Selektion und des ex ante sowie ex post Moral Hazard erwähnt. Da aber der effektive Einfluss dieser Phänomene auf das Wachstum der Kosten des Gesundheitswesens – so logisch er auch in der Theorie ist – empirisch nicht eindeutig belegbar ist, sind sie in die Aufzählung nicht eingeschlossen. Was weitere d... |
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title Page
- Copyright Page
- Table of Contents
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- I Einleitung: Sinn, Ziel und Aufbau dieser Arbeit
- II Rationierung als Mittel zur Bekämpfung des chronischen Finanzierungsdefizits unserer Gesundheitswesen
- III Verantwortung
- IV Moralische Pflichten und Rechte
- V Personalität: Was und wer ist eine Person?
- VI Die moralischen Pflichten und Rechte der zu einem Gesundheitswesen zusammengeschlossenen Personen
- VII Ist Rationierung nach Gesundheitsverhalten moralisch zulässig?
- VIII Schlussgedanken: Von der Zuschreibung retrospektiver zur Stärkung prospektiver Verantwortung
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Namensregister
- Sachregister
- Fußnoten