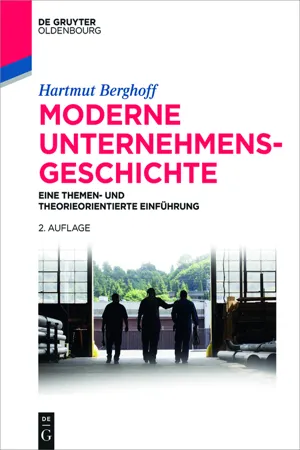![]()
1Vom Sinn und Nutzen der Unternehmensgeschichte
1.1Für Ökonomen und Praktiker in Unternehmen
Einer der erfolgreichsten Unternehmer des 20. Jahrhunderts, Henry Ford (siehe Abbildung 1.1), soll einmal gesagt haben: „History is bunk.“ – zu Deutsch: „Geschichte ist Quatsch.“ Der Pionier der Massenmotorisierung erhöhte durch den Einsatz des Fließbands die Produktivität so sehr, dass Autos billig genug für den Massenmarkt wurden und nicht mehr länger nur den Reichen vorbehalten blieben. Er hat die Welt verändert, ohne sich um Geschichte zu kümmern.
Abb. 1.1: Henry Ford und sein legendäres Modell T (1921).
Gleichwohl ist Fords Geringschätzung der Geschichte zu widersprechen. Ford selbst hat – geblendet vom phänomenalen Erfolg seiner Innovation – übersehen, dass der Wandel eine Grundtatsache des Wirtschaftslebens ist, und an dem einmal eingeschlagenen Kurs festgehalten. Seine statische Geschäftspolitik hätte sein Unternehmen fast ruiniert. Allgemein ausgedrückt schult die Beschäftigung mit der Geschichte das Auge für die Ursachen und Folgen von Veränderung. Sie demonstriert daneben eindringlich, dass sich das Tempo des Wandels im Laufe der Geschichte beschleunigt hat. Wer das ignoriert, ist nicht gut auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet, die Unternehmen in immer kürzeren Intervallen zum „management of change“ zwingen. Im Einzelnen besitzt historisches Wissen für Ökonomen in Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichen Institutionen fünf Funktionen:
1.1.1Orientierungsfunktion
Die historische Bedingtheit der Gegenwart ist unbestreitbar. Alle Menschen sind das Produkt ihrer Geschichte. Niemand fängt bei Null an. Wir werden schon in bestimmte Konstellationen hineingeboren. Jeder Mensch hat eine individuelle Lebensgeschichte hinter sich, die für seine Zukunft wichtig ist, ohne dass damit alles vorherbestimmt wäre. Wer Pläne für die Zukunft macht, bezieht immer bewusst oder unbewusst Erfahrungen der Vergangenheit mit ein. Niemand käme auf die Idee, seine Vergangenheit vollständig vergessen zu wollen. Ganz im Gegenteil. Wir pflegen sie durch Andenken, Fotoalben, Tagebücher usw. Die Auseinandersetzung mit ihr dient der Bestimmung des eigenen Standorts.
Was für Individuen gilt, lässt sich auch auf Organisationen und ganze Gesellschaften übertragen. Sie sind ebenfalls das Produkt ihrer Geschichte. Wenn man diese Geschichte ignoriert, erschwert man sich die Orientierung. Man braucht länger, um die aktuelle Konstellation zu verstehen. Viele Zustände haben nur eine einzige Ursache, nämlich das Gewicht der Tradition. Das erfährt jeder, der neu in eine Organisation eintritt. Vieles ist nicht zu verstehen ohne einen Blick in die jeweilige Geschichte, etwa die vielen ungeschriebenen Regeln. Das soll nicht heißen, dass man „heilige Kühe“ nicht schlachten soll, aber man muss wissen, warum sie heilig sind, um rational über ihre künftige Existenzberechtigung urteilen zu können.
Wer sich nicht für die historischen Wurzeln seines aktuellen Handelns interessiert, schneidet sich von führungsrelevantem Wissen ab und erschwert sich die Bestimmung seines aktuellen Standpunkts. Die meisten Fusionen scheitern bekanntlich. Die Angehörigen der zusammengeführten Firmen haben keine gemeinsame Vergangenheit und schaffen es daher oft nicht, sich auf eine gemeinsame Zukunft zu einigen. Sie denken in anderen Kategorien und handeln unbewusst in anderen Routinen, die sich nicht per Fusionsvertrag einander angleichen lassen. Der „clash of cultures“ ist vorprogrammiert. Unternehmenskulturen sind in besonderer Weise ein Produkt der Geschichte und eben daher auch kaum kurzfristig zu verändern. Es bedarf großer Anstrengungen, historisch geprägte Trägheitsmomente zu überwinden. Viele Manager haben diese Zusammenhänge ignoriert und dadurch große Schäden verursacht.
Die Wirkungsmacht der Wirtschaftsgeschichte tritt uns auch in sogenannten Pfadabhängigkeiten entgegen. Vor allem bei der Technologie werden wir dauernd mit Fakten konfrontiert, die aus der Vergangenheit stammen und schon längst nicht mehr technisch optimal sind oder es nie waren, aber unsere gegenwärtigen Handlungsspielräume einengen. Technische Standards sind das Paradebeispiel. Einmal gesetzt, werden sie von Generation zu Generation weitergeschleppt. Sie sind nur sehr schwer und unter hohen Kosten zu verändern.
Die ersten fünf Buchstaben unserer Computertastatur sind QWERT. Warum lauten sie nicht ABCDE? Das wäre übersichtlicher. Die Ursache liegt bei der mechanischen Schreibmaschine des 19. Jahrhunderts. Bestimmte Buchstaben, die in der Sprache häufig unmittelbar aufeinander folgten, durften auf der Tastatur nicht nebeneinander liegen, weil sie sich sonst ineinander verhakten. Daher müssen die Finger heute auf den Computertastaturen bei fast jedem Wort hin- und herspringen. Eine Umstellung würde alle Nutzer verwirren. Daher bleibt man auf dem vor über 100 Jahren eingeschlagenen Pfad. Die Computertechnik bietet ein gutes Beispiel für Pfadabhängigkeiten. Die durch Microsoft-Betriebssysteme gesetzten Standards haben lange die gesamte Softwareentwicklung dieser Welt geprägt.
Frühere Weichenstellungen zeitigen immense Konsequenzen für die Gegenwart. Die meisten Bahntrassen wurden unter den Bedingungen des 19. Jahrhunderts angelegt und sind für moderne Schnellzüge zu kurvenreich. Vielfach orientieren sie sich auch noch an heute bedeutungslosen politischen Grenzen. Die Standardspurbreite von 1,435 Metern geht auf pferdebetriebene Bergwerksbahnen vor fast 200 Jahren zurück, und doch müssen heutige Hochgeschwindigkeitszüge in diesen Gleisen bleiben. Eine Verbreiterung sämtlicher Tunnel und Trassen wäre zu teuer. Investitionen mit hohen „versunkenen Kosten“ sind faktisch irreversibel. Sie führen zum Ausschluss besserer Alternativen. Die Geschichte hat Fakten geschaffen, mit denen wir leben müssen. Ökonomische Akteure operieren unter Handlungsbeschränkungen, die historische Ursachen haben.
1.1.2Identitätsstiftung und -sicherung
Nur wer weiß, woher er kommt, kann ein eigenes Profil entwickeln und die Zukunft bewusst gestalten. „Zukunft braucht Herkunft“ (Odo Marquard). Gerade in einer sich rasch verändernden Welt ist die Identitätswahrung ein großes Problem. Austauschbare, gesichtslose Unternehmen tun sich schwer damit, Kunden und Mitarbeiter an sich zu binden. Ohne ein aus dem Wissen um die eigene Identität erwachsendes starkes Selbstbewusstsein können weder klare Ziele noch die dazu passenden Strukturen und Stile ausgeprägt werden. Wofür ein Unternehmen steht, was es von anderen unterscheidet und was seine spezifischen Stärken sind, ergibt sich u. a. aus seiner Geschichte.
Viele Unternehmen geben mittlerweile beträchtliche Summen für die Pflege ihrer Geschichte aus. Sie stellen Archivare und Historiker ein und beauftragen Forscherteams mit der professionellen Aufarbeitung ihrer Geschichte. Der Blick auf die Geschichte dient auch der Pflege der Corporate Identity, durch die Mitarbeiter und Kunden an das Unternehmen gebunden werden und eine Standortbestimmung mit Blick auf künftige Aufgaben möglich wird.
Leistungen früherer Zeiten bieten zwar keine Garantie für künftigen Erfolg, aber doch Anreize, es den Vorgängern gleichzutun oder diese zu überbieten. In einer Zeit, in der die Fluktuation der Beschäftigten zunimmt, kann eine spezifische, historisch gewachsene Unternehmenskultur den Mitarbeitern ein Wirgefühl vermitteln und die Botschaft transportieren, dass es etwas Besonderes ist, für eben dieses Unternehmen zu arbeiten. Geschichte enthält also Motivationsressourcen nach innen.
Nach außen unterstützt sie ein bestimmtes Image. Viele aktuelle Leistungspotenziale sind ja historisch gewachsen. Aus Patenten und Marken, eingespielten Beziehungen zu Lieferanten und Stammkunden, langfristig gereiften Qualifikationsprofilen und der Reputation ergeben sich Wettbewerbsvorteile. Der Goodwill, d. h. der über materielle Vermögensposten wie Maschinen und Immobilien hinausgehende Wert eines Unternehmens, ist v. a. das Produkt seiner Geschichte. Daher spielt diese auch in der Kommunikationspolitik vieler Branchen eine zentrale Rolle. Das gilt besonders für qualitativ hochwertige, teure Produkte, für die ein langfristig aufgebautes Image ein kardinales Verkaufsargument ist.
„History sells“
„Nur noch wenigen Traditionsunternehmen ist es vergönnt, am Ursprungsort ihres Erfolges zu wirken – in einem historischen Gebäude, in dem man sich gern alter Werte besinnt. Die typischen Merkmale Langescher Uhrmacherkunst gehen zurück auf Ferdinand Adolph Lange, der 1845 seine privilegierte Stellung als königlich-sächsischer Hofuhrmacher aufgab, um im Erzgebirge die deutsche Feinuhrmacherei zu begründen. In Glashütte bildete er junge Burschen zu kunstfertigen Uhrmachern aus und erfand wegweisende Konstruktionen und Fertigungsmethoden.“
(Werbeanzeige des Herstellers handgefertigter Uhren A. Lange & Söhne, in: Der Spiegel, 11/2002, S. 126f.)
Unternehmensgeschichte im Dienst der Identitätsstiftung und Imagepflege steht allerdings nicht selten im Gegensatz zum wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse, wahre und überprüfbare Aussagen zu treffen. Mythen und Legenden haben sich in der Praxis durchaus als Mittel der Identitätsstiftung bewährt. Solange sie Sinn ergeben, können sie eine hohe Funktionalität entfalten. Es gibt aber auch viele Fälle, in denen der Mythos des Firmengründers und seine angeblich ewig gültigen Erfolgsrezepte die Entwicklung gelähmt haben. Ein kritischer Blick in die Geschichte hätte die Legende zerstört und ein differenziertes Bild mit vielfältigeren Gestaltungsmöglichkeiten entworfen.
Oft folgt aus der unmittelbaren Instrumentalisierung der Historie für geschäftliche Zwecke eine selektive Sichtweise. Bestimmte Fakten, die nicht in das gewünschte Bild passen, werden ausgeblendet. Andere Aspekte dagegen erhalten ein zu großes Gewicht. Wenn die Deutsche Bank ihre Kompetenzen im Geschäftsfeld „Mergers & Acquisitions“ herausstellen will, spricht sie nicht über ihre Mitwirkung an der „Arisierung“ jüdischer Unternehmen im Nationalsozialismus oder über die von ihr betreuten, dann aber gescheiterten Fusionen. Volkswagen verkauft seine Autos nicht mit dem Hinweis darauf, dass ausländische Zwangsarbeiter das heutige Werk vor 1945 unter z. T. menschenunwürdigen Bedingungen aufgebaut haben. Unternehmensberatungen schweigen sich über die Zahl ihrer Klienten aus, die den Gang zum Konkursrichter antreten mussten. Misserfolge und Fehler, politisches und ethisches Versagen sind nicht der Stoff, aus dem Festschriften gemacht werden.
Die Wissenschaft hat dagegen eine kritische Aufgabe und ist zuerst der Suche nach Wahrheit verpflichtet. Sie darf sich nicht den Selbstdarstellungsinteressen der Unternehmen unterordnen. Es gehört zu den positiven Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, dass sich die Polarisierung zwischen akademischer und unternehmensnaher Geschichtsschreibung abgeschwächt hat und viele Firmen auf wissenschaftlich fundierte Festschriften Wert legen. Die Deutsche Bank, VW, Allianz u. a. haben aus Sorge um ihre Reputation und nicht zuletzt auf Druck der ausländischen Öffentlichkeit unabhängige, international anerkannte Historiker mit der Aufarbeitung ihrer Geschichte beauftragt – trotz und wohl gerade wegen erheblicher Belastungen im „Dritten Reich“. Die kommunikationspolitische Botschaft lautet: „Wir sind ein modernes, weltoffenes Unternehmen, das sich seiner Vergangenheit ohne Vorbehalte stellt. Mehr können wir als Nachgeborene nicht tun, auch wenn wir die Geschichte gern ungeschehen machen würden.“ In viel Fällen hat sich diese Strategie bewährt, auch geschäftlich. Anstatt in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt zu werden, wurden die Bemühungen um eine ehrliche Aufarbeitung auch der Schattenseiten der eigenen Geschichte allgemein anerkannt. Eine emotionale, lange von Ideologie und Vorurteilen geprägte Diskussion wurde versachlicht.
Allerdings sind nach wie vor viele Unternehmen nicht bereit, ihre Archive unabhängigen Forschern zu öffnen. Sie bleiben der unguten Tradition treu, Festschriften von ihren PR-Abteilungen oder willfährigen Autoren schreiben zu lassen. Halbwahrheiten, Auslassungen und Klischees werden mit historischen Tatsachen zu einem farbenfrohen, auf Hochglanzpapier gebannten Potpourri zusammengefügt. Wer solche „Hofgeschichtsschreibung“ gegen den Strich liest, erfährt im Einzelfall immer noch manch instruktive Tatsache. Ein weiterführender Beitrag zur Identitätsbildung des Unternehmens steht allerdings nicht zu erwarten. In der Regel scheuen gerade die Unternehmen die ehrliche Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte, die auch sonst die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben und offene Diskussionen vermeiden.
1.1.3Lehrfunktion
Die Denkfigur der Geschichte als Lehrmeisterin der Gegenwart ist ebenso verbreitet wie hochproblematisch. Die Hoffnung trügt, mit Hilfe der Geschichte universell anwendbare Erfolgsrezepte zu gewinnen, denn sie wiederholt sich niemals, sondern erzeugt permanent Neues. Trotzdem strebten die ersten Unternehmenshistoriker an, durch Fallstudien erfolgreicher Firmen die zentralen, gleichsam „ewigen“ Geheimnisse des Geschäftslebens entdecken zu können.
In der frühen Militärgeschichte existierten ähnlich naive Vorstellungen. Man brauche bloß vergangene Kriege zu studieren, um die Strategien für künftige Schlachten zu perfektionieren. Dabei übersah man, dass sich die Militärtechnologie laufend veränderte. Was für Reiter mit Säbeln galt, konnte für Panzerfahrer und MG-Schützen keine Geltung mehr beanspruchen und schon gar nicht für Computerspezialisten, die aus Bunkern heraus Hightechkriege führen. Analog dazu kann man heute keinem Unternehmer empfehlen, eine in der Vergangenheit erfolgreiche Strategie einfach fortzuschreiben oder zu kopieren. Die Umweltbedingungen ändern sich zu dynamisch, um allgemeingültige Modelle aus der Vergangenheit abzuleiten. Die Geschichte kann die gegenwärtige Generation nicht aus ihrer Verantwortung für ihr Handeln entlassen. Der Manager, der die Geschichte seines Unternehmens und seines Marktes gut kennt, ist gegenüber weniger gebildeten Konkurrenten im Vorteil, muss aber am Ende doch seine eigene Entscheidung unter Bedingungen großer Unsicherheit treffen.
Der Historiker Jacob Burckhardt schrieb einmal, dass die Beschäftigung mit Geschichte nicht „klug für heute“, sondern „weise für immer macht“. Mit dieser etwas pathosbeladenen Formulierung meinte er das, was wir heute Bildung nennen. Wer einmal in der Börsengeschichte den relativ beständigen Wechsel von überschießenden Erwartungen und schockartiger Ernüchterung kennengelernt hat, dürfte wohl kaum vom Zusammenbruch des Neuen Marktes im Jahr 2000/01 und der Finanzkrise des Jahres 2008 überrascht worden sein. Wer sich mit den Konsequenzen des Eisenbahnbaus oder der Weltkriege auf das Wirtschaftswachstum beschäftigt hat, ist gegen simple ökonomische Modelle mit einigen wenigen Variablen gefeit. Er hat nämlich die Komplexität und Vielschichtigkeit der empirischen Realität kennengelernt und ist in der Lage, genau danach auch in seiner Gegenwart zu suchen und die „Widerspenstigkeit der Realität“ (Hans-Ulrich Wehler) gegenüber einfachen Erklärungen zu erkennen. Es geht also um Kritikfähigkeit und Distanz, um Denken in langfristigen Perspektiven.
Praktiker, aber zunehmend auch prominente Wirtschaftswissenschaftler beklagen, dass ein enges, hoch spezialisiertes und stark theoretisiertes Studium an den Hochschulen die Ausbildung dieser intellektuellen Fähigkeiten erschwert. Maurice Allais, der 1988 den Nobelpreis für Ökonomie erhielt, spricht sich daher für die Einbeziehung der angrenzenden Sozialwissenschaften, insbesondere der Geschichte aus, um eine Rückbindung der Ökonomie an die reale Welt sicherzustellen.
Plädoyer für eine ganzheitliche Ökonomie: Maurice Allais
Die Ökonomie ist „heute so weit fortgeschritten und in verschiedenste Bereiche der Analyse hineingedrungen, daß sie immer mehr zur Spezialisierung in verschiedene Richtungen neigt. [...] Diese Spezialisierung ist notwendig. [...] Dennoch ist es von äußerster Bedeutung, die Bemühungen um eine Synthese aufrechtzuerhalten. Fortschritt in jedem der Einzelbereiche setzt einen breitangelegten Gesamtüberblick voraus. [...] Die Anwendungsmöglichkeiten der Volkswirtschaft finden natürlich unweigerlich ihren Niederschlag in der Politik, so daß der Wirtschaftswissenschaftler auch weitreichende Kenntnisse auf den Gebieten von Soziologie, Politik und Geschichte haben muß.
Die Geschichte der Wissenschaften läßt erkennen, daß der Fortschritt immer dann am schnellsten war, wenn zwischen verschiedenen Disziplinen Brücken geschlagen wurden. [...] Seit der Zeit von Walras und Pareto ist es gang und gäbe, die starke gegenseitige Abhängigkeit zwischen verschiedenen Phänomenen herauszustellen, die das Leben der Gesell...