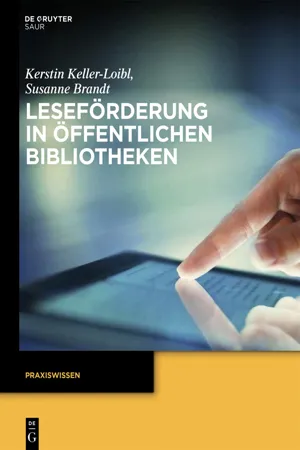
- 211 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken
Über dieses Buch
Dieser Band stellt theoretische Grundlagen der Leseforschung und Literaturvermittlung praxisbezogen dar und bietet eine Hilfestellung für die Planung und Durchführung von Projekten und Programmen zur Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken für verschiedene Zielgruppen und Lebensphasen. Die Themenvielfalt reicht von der frühkindlichen Förderung mit Sprache und Schrift über medienintegrative Methoden der Leseförderung für Jugendliche bis hin zu musikgestützten Vermittlungswegen bei Hochbetagten. Pädagogisch-didaktisches Grundwissen und ein Potpourri an Vermittlungsmethoden regen dazu an, die vorgestellten Ideen und Konzepte umzusetzen oder eigene Leseförderungsaktivitäten zu entwickeln.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken von Kerstin Keller-Loibl,Susanne Brandt im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Bibliotheks- & Informationswissenschaft. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Leseförderung gehört auch und gerade im Zuge einer wachsenden Berücksichtigung der Medienvielfalt zu den Kernaufgaben Öffentlicher Bibliotheken. Anregungen und inspirierende Impulse zur Lesemotivation sowie die Entwicklung von differenzierten Leseinteressen und ausgeprägten Lesegewohnheiten im Alltag sind längst nicht mehr nur an das Buch gebunden, sondern sie bilden die Grundlage für die kritische und gezielte Nutzung aller Medien mit ihren spezifischen Eigenschaften und Nutzungsformen. Dabei gehören Öffentliche Büchereien zu den wenigen Institutionen, die diesen Prozess bei Menschen von der ersten Sprachentwicklung an bis ins hohe Alter begleiten, und die Bildungsinteressen ebenso im Blick haben wie Freizeitbedürfnisse und soziale Belange.
Mit der wachsenden Medienvielfalt in Bibliotheken weitet sich das Verständnis von Lesekompetenz und Leseförderung, das in seiner Komplexität erkannt werden muss, wenn es auch in der Praxis nicht immer in allen seinen Aspekten vertieft werden kann. Bewusst gesetzte Akzente und Beschränkungen auf ausgewählte Schwerpunkte in der bibliothekarischen Praxis vor Ort sind gut zu überlegen und begründet zu vertreten.
Zu bedenken ist dabei, dass Sinnkonstruktion und Kommunikation im Umgang mit Medien von vielfältigen Wahrnehmungen geprägt sind und beispielsweise das Lesen von Bildern wie überhaupt eine zunehmende Multimodalität untrennbar mit jeder Mediennutzung verbunden ist.
Ebenso ist zu berücksichtigen, dass literale Erfahrungen in enger Beziehung zur sozialen Identität stehen. So gehört bei Jugendlichen das Lesen und Schreiben mit elektronischen Medien, das Verarbeiten von Bildern oder Rezipieren von Musik über Medien so selbstverständlich zum täglichen Handeln wie die elementaren mündlichen oder körpersprachlichen Ausdrucksweisen. Soziale Interaktion und die Bedeutung von Begleit- oder Anschlusskommunikation bei vielfältigen medialen Leseerlebnissen tragen also erheblich zur Lesemotivation bei.
Gleichzeitig wird in der Schule das Lesen und Schreiben in erster Linie zum Zweck des gezielten Lernens vermittelt. Literarische Bildung und schulisches Lesetraining, das auf unterschiedlichen Stufen der Leseentwicklung die Fertigkeiten im Umgang mit Texten schult, werden noch zu wenig von lesefördernden Maßnahmen begleitet, die die alltäglichen Lesegewohnheiten von Kindern und Jugendlichen wahr- und ernstnehmen.
Hier ergibt sich für Bibliotheken als außerschulische Institutionen eine wichtige Frage der Positionierung: Stellen sie sich mit ihrem Leseförderkonzept als Bildungspartner an die Seite von Schulen, auch wenn diese das Lesen weniger von den alltäglichen Lesegewohnheiten der Kinder und Jugendlichen her definieren und fördern? Sehen sie ihren Schwerpunkt eher bei einer Unterstützung des Lesens in einem weiteren Sinne, die vor allem die Eigenaktivitäten, sozialen Varianten und kommunikativen Chancen bei der kulturellen Teilhabe von Jugendlichen im Blick hat? Oder gelingt den Bibliotheken der Spagat, beides miteinander zu verbinden und in einem eigenständigen Leseförderkonzept angemessen zu integrieren?
Daraus ergibt sich ein außerordentlich breites Anforderungsprofil für Sie als Mitarbeitende in Bibliotheken, die einerseits umfangreiche Kenntnisse und Methoden parat haben müssen, um den verschiedenen Zielgruppen in der Leseförderung gerecht werden zu können, und die andererseits im Arbeitsalltag oft nur wenig Zeit haben, um sich über den aktuellen Stand der Leseforschung zu informieren und sich dazu passende Angebote und Methoden anzueignen oder diese neu zu entwickeln.
dp n="12" folio="2" ?
So entstand dieser Praxisratgeber mit dem Anliegen, Ihnen genau für diese Situation fundierte theoretische Grundlagen der Leseforschung praxisbezogen zu vermitteln, und auf dieser Basis eine umfassende Hilfestellung für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zur Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken zu bieten.
Das Buch zeichnet sich durch seine bibliotheksspezifische Ausrichtung aus: Veranstaltungsformate und Projekte, die sich für die bibliothekarische Praxis eignen, werden ausführlich vorgestellt, unter anderem mit detaillierten Konzeptideen, Ablaufplänen, konkreten Tipps für die Umsetzung und wichtigem Hintergrundwissen zur Zielgruppe. Pädagogisch-didaktisches Grundwissen und ein Potpourri an Vermittlungsmethoden ergänzen die Darstellung und regen dazu an, die vorgestellten Ideen und Konzepte umzusetzen oder eigene Leseförderungsaktivitäten zu entwickeln.
Mit einem reichen Schatz langjähriger Erfahrungen aus der Bibliothekspraxis wie aus der beruflichen Weiterbildung, Forschung und Lehre möchten wir hier erstmals versuchen, den Bogen weit über alle Zielgruppen zu spannen. Denn in den letzten Jahren hat sich das klassische Feld der Leseförderung in verschiedene Richtungen deutlich ausgedehnt: Vor dem Kindergartenalter sind erste Begegnungen mit Schrift und Zeichen bei Kindern unter drei Jahren viel stärker in den Blick gerückt, und am Ende des Lebens stellt sich die Frage, wie Medien bei Hochbetagten mit eingeschränkter Alterskompetenz zu Orientierung und Wohlbefinden beitragen können. In einer Lebenslage, die möglicherweise von einem krankheits- oder altersbedingten Abbau oder Verlust der Lesefähigkeit gekennzeichnet ist, meint Leseförderung nicht den Versuch, die Lesefähigkeit zurückzugewinnen. Vielmehr geht es darum, wahrzunehmen, wie die Biografie und die Empfindungen eines Menschen bis ins hohen Alter geprägt sind von den Lese- und Medienerfahrungen eines langen Lebens. Hier gilt es, individuelle biografische Anknüpfungspunkte zu finden und Medien zum Einsatz zu bringen, die die Identität eines Menschen stärken und eine kulturelle Teilhabe in geeigneter Weise ermöglichen.
Bei allem zu berücksichtigen ist das große Spektrum von Angeboten im Medienverbund, die neue Ansätze in der Leseförderung möglich und nötig machen. Hinzu kommen aktuelle Veränderungen im Bildungs- und Freizeitbereich, die zu neuen Strategien in der Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen herausfordern.
Die Themenvielfalt dieses Buches reicht daher von der frühkindlichen Sprachförderung über jugendspezifische Leseförderungsaktionen wie Book Slams® und Literaturevents bis hin zu sinnlichen Kommunikationsformen, bild- und musikgestützten Vermittlungswegen für alle Generationen in unterschiedlichen Lebenslagen. Interkulturelle Aspekte sind dabei exemplarisch in den verschiedenen Kapiteln mit eingearbeitet, weil sie in allen Generationen und Lebenslagen eine Rolle spielen können.
Mit dieser Vielfalt wendet sich der Praxisratgeber nicht allein an Kinder- und Jugendbibliothekare, sondern an alle Mitarbeitende in Öffentlichen Büchereien, die vor der Aufgabe stehen, ihr Angebot kompetent auf verschiedene Zielgruppen auszurichten. Dabei haben wir versucht, die Beispiele so konkret wie möglich für die Bibliothekspraxis aufzubereiten.
Auch Studierende erhalten mit diesem Buch eine umfassende und fundierte Einführung in das Forschungs- und Praxisfeld der Leseförderung. Umfangreiche Literaturhinweise und weiterführende Linktipps ergänzen und bereichern diesen Band.
2 Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken
2.1 Vom Sinn des Lesens
Eva Heller sei Dank: Keine schweißtreibenden Leibesübungen mehr, um dem Schönheitsideal der Boulevardpresse zu entsprechen! Es gibt eine neue Wunderdiät: das Lesen. „Wie man allseits beliebt wird, glücklich und schlank, oder: Vom Sinn des Lesens“ lautet der mit (manchmal allzu offensichtlichem) Augenzwinkern geschriebene Roman von Eva Heller, der 2001 im Gerstenberg Verlag erschien. Der Verlag empfiehlt den Roman für Kinder ab neun Jahren und – nicht ohne Grund – für Erwachsene, die – wie im Klappentext vorsichtig formuliert wird – „mitlesen dürfen“. Eigentlich sollten alle Eltern dieses Buch spätestens zur Einschulung ihres Kindes als Pflichtlektüre erhalten, zusammen mit einem Anmeldeschein für die örtliche Bibliothek.
Worum geht es in diesem Roman und weshalb sollten ihn Erwachsene lesen? Erzählt wird die Erfolgsgeschichte des Mädchens Melitta. Sie ist faul, dick und ungeliebt und soll endlich etwas dagegen tun. Doch anstatt einer der schicken Sportarten nachzugehen, die ihre Eltern ihr empfehlen, widmet sie sich dem Training der Fantasie. Sie verbringt fortan ihre Zeit mit einem Märchenbuch und dem Austausch darüber mit einem lesenden Professor. Und weil Lesen spannender ist als Fernsehen, muss sie dabei auch nicht ständig naschen und verliert prompt einige Pfunde. Aber damit nicht genug: Melitta erzählt anderen Kindern selbst erfundene oder umgedichtete Märchen und wird eine beliebte „Märchentante“. Am Ende erlangt sie auch noch Ruhm, weil ihre Geschichten in der Tageszeitung abgedruckt werden. Erst jetzt begreifen ihre Eltern, die so gar keinen Bezug zu Büchern haben, dass Lesen doch von Vorteil ist und man es damit im Leben „zu etwas bringen kann“.
Was ist der Sinn des Lesens? Es gibt viele gute Gründe für das Lesen, nicht nur lehrreiche Diäten, Ruhm und Geld: Lesen ist in unserer schriftbasierten Informationsgesellschaft die Schlüsselqualifikation für die gesamte schulische und berufliche Entwicklung. Es ist zudem für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen von grundlegender Bedeutung. Als positive Wirkungen des Lesens werden in der Leseforschung die Entwicklung des Vorstellungsvermögens, des komplexen Denkens und der Sprachkompetenz genannt (Dahrendorf, 1995, S.34). Lesen fördert Fähigkeiten zu Kommunikation, zu politischer Meinungsbildung, zu kognitiver Orientierung und stärkt die Empathie- und Moralentwicklung, die ästhetische Sensibilität und die Reflexion (Garbe, 2010, S. 18). Lesen erweitert den Horizont. Wer liest und schreibt, entwickelt Fantasie und Kreativität.
Bücher helfen Kindern, sich die Welt zu erklären und Antworten auf Fragen zu finden. Kinder können sich mit Figuren in Büchern identifizieren, gemeinsam Geschichten erleben, Gedanken und Gefühle kennenlernen und eigene Probleme verarbeiten. „Lesen lernen heißt Leben lernen“, hat die Kinderbuchautorin Mirjam Pressler formuliert und damit den Sinn des Lesens treffend beschrieben.
Kindern, die keine Lesevorbilder haben, kann die faszinierende Welt des Lesens verborgen bleiben. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Defizite nicht durch andere Instanzen der Leseförderung ausgeglichen werden. Leseförderung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und erfordert das Zusammenwirken verschiedener Institutionen und Einrichtungen, insbesondere der Kindertagesstätten, Schulen und Bibliotheken.
Auch in der Geschichte von Melitta, die aus einer Familie stammt, in der das Fernsehen die liebste und fast einzige Freizeitbeschäftigung ist, war ein Einfluss von außen erforderlich, damit sie sich zu einer Leserin entwickeln konnte. Ihre Eltern hätten lieber viel Geld für Sportclubs ausgegeben als für Bücher. Dass es Melitta am Ende sogar noch gelingt, ihre Eltern vom Wert des Bücherlesens zu überzeugen, gehört zur Erfolgsstory des Buches und ist im realen Leben leider nicht immer so.
2.2 Warum muss das Lesen gefördert werden?
Als Leser wird man nicht geboren! Lesen ist eine zentrale Kulturtechnik, die in einer schriftbasierten Gesellschaft eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzuhaben. Aber das Lesen muss erlernt werden. Das menschliche Gehirn besitzt keine Region, die speziell für die Kompetenz zum Lesen ausgebildet ist – ganz im Gegensatz zur Fähigkeit des Hörens, Sehens und Sprechens. Die Eignung für das Lesen ist aber angelegt, wir benutzen hierfür Hirnregionen, die ursprünglich für andere Zwecke entwickelt worden waren. Man nimmt an, dass diese Hirnregionen früher für das Spurenlesen verwendet wurden.
Sprechen und Lesenlernen sind aktive und dialogische Prozesse. Keines der elektronischen Medien kann den Spracherwerb durch menschliche Kommunikation ersetzen. Die Unterstützung des Spracherwerbs ist die erste Voraussetzung für einen erfolgreichen Leselernprozess.
Dass die Sprache der Schlüssel zu Kommunikation und Bildung ist, belegen auch neurowissenschaftliche Untersuchungen. Diese Studien wiesen nach, dass sich der Erwerb von Sprachkompetenz im ersten Lebensjahrzehnt vollzieht. In der Entwicklung des Menschen gibt es sogenannte „sensible Phasen“, biologische „Entwicklungsfenster“. Es wird vermutet, dass sich das Fehlen von notwendigen Erfahrungen innerhalb dieser Phasen ungünstig auf die weitere Entwicklung auswirken kann. Eine besonders sprachsensible Phase ist die Zeit von der Geburt bis zum Schuleintritt. In diesem Zeitfenster ist das Gehirn des Kindes besonders empfänglich für sprachliche Informationen. Spätestens im Alter von 13 Jahren ist die Sprachentwicklung nahezu vollständig abgeschlossen (Brandl, 2010, S. 10). Das bedeutet, dass vor allem in der frühen Kindheit der Grundstock für den Spracherwerb und somit auch für das Lesen gelegt werden muss.
Häufig wird der Begriff „Literacy“ für die sprachliche Bildung im Elementarbereich verwendet, der kindliche Erfahrungen mit dem Buch und der Erzähl-, Reim- und Schriftkultur umfasst. Dazu gehören das Interesse an Schrift, das Symbolverständnis, der Umgang mit Büchern und die Lesefreude – Erfahrungen also, die Kinder vor dem Eintritt in die Schule mit Schrift und Zeichen machen. Diese frühen Literacy-Erfahrungen tragen langfristig dazu bei, dass bessere Sprac...
Inhaltsverzeichnis
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Übersicht der Zeichnungen
- Verwendete Marginalien
- 1 Einleitung
- 2 Leseförderung in Öffentlichen Bibliotheken
- 3 Frühkindliche Leseförderung
- 4 Kindergarten- und Grundschulalter
- 5 Kinder ab elf/zwölf Jahren und Jugendliche
- 6 Verschiedene Lebens- und Interessenlagen bei Erwachsenen
- 7 Vermittlungsförderung
- 8 Ausgewählte Kampagnen und Aktionen
- Literaturverzeichnis
- Über die Autorinnen



