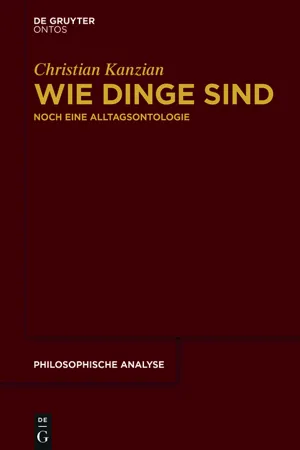![]()
III Modi im Eigenschafts-Themenfeld
In der Einleitung (Teil 0) dieser Monographie habe ich versucht, das berechtigte Unbehagen der LeserIn über meine Fokussierung des Themas Wie Dinge sind auf Modi dadurch zu mildern, dass ich in Aussicht gestellt habe, in einem dritten Hauptteil daranzugehen, standardmäßige Fragen aus dem Eigenschafts-Themenfeld zu behandeln. Das soll nunmehr geschehen. Bevor ich mich an diese Aufgabe mache, möchte ich allerdings kurz Auskunft darüber geben, was ich mit „Eigenschafts-Themenfeld“ meine.
Zunächst eine terminologische Klarstellung: Ich verwende vor dem Hintergrund meiner Theorienbildung in den ersten beiden Hauptteilen „Eigenschaft“ natürlich weiter in einem nicht-technischen Sinne. Das heißt, ich schwenke in der Terminologie meiner Theorie über Die Weise, wie Dinge sind nicht darauf um, nun doch diese Weisen als Entitäten der ‚Kategorie‘ Eigenschaften zu benennen. „Eigenschaft“ bzw. „Eigenschafts-Themenfeld“ verwende ich in diesem Hauptteil, um bestimmte Fragen und Themen zu umreißen, die in der aktuellen Literatur diskutiert werden, um anhand dieser Fragen die Relevanz von Modi zu erproben.
Unter „Eigenschafts-Themenfeld“ verstehe ich nun jenes Kompendium von Fragen, die a) mit den Grundlagen einer Ontologie von Eigenschaften zusammenhängen, sowie b) mit Unterscheidungen im Bereich der Eigenschaften. Dass es hier standardmäßige Fragen gibt, ergibt sich daraus, dass sich in der Forschungsliteratur gewisse Brennpunkte der Diskussion festmachen lassen. Was aber wären solche Fragen bzw. Themen?
Bzgl. a) wurde schon in den vorhergehenden Abschnitten einiges gesagt. Ich erinnere nur an die Grundthesen bzgl. basaler Fakten im Abschnitt I – 3.1, aber auch an die Überlegungen zum Status von Modi als partikularen Entitäten in II – 1. Eine Grundsatzfrage, die stets in der Diskussion des Eigenschafts-Themas gestellt wird, wurde allerdings noch nicht behandelt: Wie kann man das Verhältnis zwischen Prädikaten und Eigenschaften verstehen? Es geht hier um den Zusammenhang von sprachlicher und ontologischer Ebene. Entspricht jedem Prädikat eine Eigenschaft oder nur manchen? Wenn das Letztere behauptet wird, welche Prädikate sind gemeint und warum? Wie deuten wir die Prädikate, denen keine Eigenschaft entspricht? Was ist mit den „abundant properties“, um einen Lewis’schen Terminus aufzugreifen, bzw. den „uneigentlichen“ Eigenschaften? Diesem Themen- bzw. Fragenkomplex möchte ich die ersten drei Abschnitte dieses dritten Hauptteiles (III – 1 bis III – 3) widmen und die in den ersten beiden Hauptteilen skizzierte Ontologie der Modi in ihrer Klärungskompetenz dafür erproben.
Bzgl. b) lassen sich ebenfalls leicht standardmäßige Diskussionen festmachen. Welche Unterscheidungen erörtert man im Hinblick auf Eigenschaften?
Da ist zunächst jene zwischen qualitativen oder kategorikalen Eigenschaften und den dispositionalen. Was man, vor dem Hintergrund der Annahme von Modi, dazu sagen kann, habe ich bereits darzulegen versucht, und zwar im Abschnitt II – 3, insbesondere in II – 3.1. Diese Distinktion ist aber nicht die einzige vielfach erörterte. Dazu gehört sicherlich auch die Unterscheidung zwischen ein- und zweistelligen Eigenschaften, m.a.W. die Frage nach Relationen. Hierauf habe ich mich in vorhergehenden Abschnitten schon teilweise eingelassen. Im dritten Hauptteil soll dies nochmals aufgegriffen und systematisch vertieft werden (III – 4). Noch gar nicht bzw. praktisch nicht behandelt wurden die Unterscheidungen zwischen sogenannten essentiellen und akzidentellen Eigenschaften bzw. die Distinktionen zwischen extrinsischen und intrinsischen, sowie zwischen extensionalen und intensionalen Eigenschaften. In den Abschnitten III – 5, 6, und 7 versuche ich, diese Distinktionen in Anwendung einer Modiontologie zu rekonstruieren und systematisch auszuwerten.
Mit diesen Fragestellungen nehme ich eine Auswahl des Eigenschafts-Themenfeldes vor. Ich kann somit nicht beanspruchen, eine vollständige Abarbeitung dieses faszinierenden ontologischen Betätigungsfeldes anzubieten. Ich glaube allerdings, dass dies jeden (sinnvollen) Rahmen eines Buchprojekts sprengen würde und mache mich an die Bearbeitung meiner bescheidenen Parzellen des besagten Feldes.
![]()
1 Prädikate und Entitäten
(1) Unsere Alltagssprache ist in der Verwendung von Prädikaten praktisch unbegrenzt tolerant. Wir reden nicht nur davon, dass etwas eine bestimmte Größe, eine gewisse Gestalt, eine Farbe hat; nicht nur davon, dass Dinge, insbesondere Lebewesen, artspezifische Vermögen besitzen. Ohne Bedenken sprechen wir genauso auch davon, dass etwas räumliche bzw. zeitliche Merkmale oder Charakterisierungen aufweist. „Die Kugel ist rund und 10 cm vor mir“, ist prima facie vollkommen unverdächtig. „An einem Ort zu sein“ scheint qua Prädikat genauso zu funktionieren wie „grün zu sein“ bzw. „5 Jahre alt zu sein“. Aber nicht nur das. Mitunter sagen wir auch von Dingen aus, dass sie sich von anderen unterscheiden, ja auch, bevorzugt wenn wir zu theoretisieren beginnen, dass sie mit sich selbst identisch sind. „Sich von anderen unterscheiden“ bzw. „identisch zu sein“ wird gleichsam als Prädikat aufgefasst. Wohl nicht mehr im Alltag, sondern in speziellen ontologischen Kontexten, wird dann u.a. von Dingen auch ausgesagt, sie seien individuell oder gehörten dieser und jener Kategorie an, ja auch, dass Dinge Träger von Eigenschaften seien. Hier wird „Individuell-Sein“, „einer Kategorie-Angehören“, ja „Träger-von-Eigenschaften-Sein“ als Prädikat verwendet, das strukturell analog zu sein scheint zu den eingangs erwähnten. „Die Kugel ist Träger von Eigenschaften und grün“ z.B. wäre dann eine wohlgeformte Bemerkung.
Wenn wir uns nochmals der Alltagssprache zuwenden, können wir auch Redeweisen wie folgende feststellen: „Diese Kugel ist, im Unterschied zu den weiteren Kugeln am Tisch, nicht blau. Sie hat eine andere Farbe“. Das nicht blau Sein kann in diesem Aussagekontext durchaus aufgefasst werden als ein Nicht-blau-Sein, also quasi als ein negatives Prädikat. Wir wollen ja manchmal genau das Nicht-F-Sein von etwas pointiert behaupten. Analoges zu Negationen können wir bzgl. Konjunktionen und Disjunktionen feststellen. „Warm-undblau“ in „Diese Kugel ist warm und blau“ bzw. „grün-oder-blau“ in „Die nächste Kugel wird entweder grün oder blau sein“ kann als jeweils ein Prädikat ausgesagt werden. Warum auch nicht? Es ist informativ, Konjunktionen und Disjunktionen zu behaupten.
Die Frage ist allerdings, wie wir als OntologInnen mit derlei Aussageformen umgehen? Sind, entsprechend zur grammatikalischen Analogie zwischen qualitativen und räumlichen bzw. zeitlichen Prädikaten, räumliche bzw. zeitliche Merkmale genauso Eigenschaften wie Qualitäten? Ist selbst Identität oder Mit-sich-identisch-Sein eine Eigenschaft, bzw. Individuell-Sein oder Ein-Individuum-Sein?239 Sogar Träger von Eigenschaften zu sein wird ja mancherorts (mit beträchtlichen Folgen!) zur Eigenschaft stilisiert.240 Gibt es darüber hinaus negative, disjunkte bzw. konjunkte Eigenschaften?
Eine Möglichkeit wäre es, angesichts dieser unleugbaren Bedrohung durch Unübersichtlichkeit, reflexartig jede ontologische Relevanz aussagend gebrauchter Ausdrücke zu negieren. Jede Prädikation ist ein Aussagen von rein Sprachlichem. Ausgesagte Ausdrücke aber verpflichten nicht ontologisch. Also können wir uns die eben aufgelisteten Fragen und die damit verbundenen Probleme sparen.241 Das andere Extrem bestünde darin, dass wir jeder Redeweise, sprich jedem syntaktisch wohl geformten Prädikat eine Eigenschaft, sprich eine Entität zuweisen.242 Ersteres wäre reiner Nominalismus, Letzteres eine schier unüberschaubare Ontologie.
Die Fragen, die ich mir im Folgenden stellen möchte, sind, ob es zwischen diesen Extremen nicht einen nachvollziehbaren Mittelweg gibt, bzw. was (m)eine Ontologie der Modi dazu beitragen kann, diesen Mittelweg systematisch zu beschreiten. Beginnen möchte ich mit weiteren Grundsatzbemerkungen zum Thema „Prädikate und Entitäten“ (in den nun folgenden Abschnitten (2)–(4)). Dann mache ich Vorschläge zur Einteilung von Prädikaten, von denen ich meine, dass durch ihr Ausgesagt-Werden von einem Träger nicht das Zukommen einer Entität zu diesem Träger behauptet wird (III – 2). Es folgen Überlegungen zu uneigentlichen Eigenschaften, um (ich schicke es voraus) auch rein räumliche, zeitliche und kausale Merkmale oder Charakterisierungen ins Auge zu fassen (III – 3).
(2) Bezüglich unseres Themas „Prädikate und Entitäten“ muss ich nicht bei null beginnen, sondern darf auf einschlägige Überlegungen aus dem Abschnitt II – 1.2.1 (3) rekurrieren, wo ich einige prädikationstheoretische Bemerkungen in Anschlag brachte. Grundlegend dabei ist die Unterscheidung zwischen dem Enthalten-Sein-in bzw. Bestimmt-Sein-durch und einem Ausgesagt-Werden-von bzw. Unter-etwas-Fallen-von. Ersteres besagt ein (basales) Verhältnis zwischen (partikularen) Entitäten. Letzteres ist das Verhältnis von etwas Allgemeinem, einem Allgemeinbegriff, und (wieder partikularen) Entitäten. Damit heben wir nicht nur Bestimmt-Sein und Unter-etwas-Fallen voneinander ab, sondern unterscheiden auch zwischen dem ausgesagten Ausdruck als einem sprachlichen Mittel, einem Prädikat, und dem durch das Ausgesagte Behauptete, also einem ontologischen Faktum. Im Hinblick auf Modi haben wir gesehen, dass beispielsweise „rot“ bzw. „ist rot“ in „Die Kugel ist rot“ als Prädikat verstanden werden kann, das Behauptete aber darin besteht, dass die Kugel durch den Modus Rot bestimmt ist.
Die grundsätzliche Unterscheidung aber zwischen aussagend gebrauchten sprachlichen Ausdrücken, also Prädikaten, und ontologischen Fakten spielt auch im Kontext dieses Abschnittes eine entscheidende Rolle. Ich möchte diese Unterscheidung dahingehend weiterentwickeln, dass es zwischen ausgesagten sprachlichen Ausdrücken und den behaupteten ontologischen Fakten nicht in jedem Fall strukturelle Analogie gibt. Mit dieser Weiterentwicklung stelle ich mich gegen den nominalistischen Weg, dass Prädikate gar keine ontologische Relevanz hätten. Ich grenze mich aber auch gegen Auffassungen ab, denen zufolge man das behauptete ontologische Faktum rein aus einer Analyse des Prädikats ersehen bzw. aus der grammatikalischen Struktur eines Prädikats bereits ontologische Strukturen ableiten könnte, ebenso dagegen, dass jedes Prädikat gleichsam ein ‚Bild‘ einer Entität der ‚Kategorie‘ der Eigenschaften wäre.
Mit den Thesen von der Unterscheidbarkeit von Prädikaten und jenen ontologischen Gegebenheiten, für welche die Prädikate stehen, bzw. von der möglichen strukturellen Disanalogie von Prädikaten und diesen Gegebenheiten befinde ich mich im Grunde im Mainstream der Theorienbildungen in diesem Bereich. „Eigenschaften … sind etwas anderes als Prädikate“243, stellt beispielsweise Frank Hofmann lapidar fest und bringt damit bzgl. der besagten grundsätzlichen Unterscheidung diese (Mehrheits-) Meinung auf den Punkt.244
Selbst NominalistInnen hätten wohl gegen den Hofmannschen Punkt als solchen nichts einzuwenden. Natürlich können wir zwischen Entitäten, für welche Prädikate stehen, und den Prädikaten selbst unterscheiden. Die Ersteren gibt es nicht, die Letzteren können wir grammatikalisch und semantisch analysieren. Auch OntologInnen, die einer sehr reichhaltigen Ontologie von Eigenschaften das Wort reden, begründen diese Reichhaltigkeit nicht damit, dass sich ihre Ontologie in einfacher Umlegung einer grammatikalischen Analyse von Prädikaten ergibt, schon gar nicht damit, dass Prädikate (Bilder von) Eigenschaften seien.245 Also können wohl auch sie die besagten Distinktionen vertreten.
Soweit zum Konsensuellen. In der Begründung der Unterscheidung zwischen Prädikaten und Eigenschaften, v.a. (worauf ich mein Hauptaugenmerk lege) der Disanalogie zwischen manchen Prädikaten und jenen ontologischen Gegebenheiten, für welche diese Prädikate stehen, finden wir aber verschiedene Ansätze. Ich möchte mich im Folgenden v.a. auf einschlägige Überlegungen John Heils beziehen. Sie führen zu jenem Punkt hin, auf den es mir in diesem Abschnitt besonders ankommt.
(3) Heil tritt in dieser Frage sehr resolut auf. Er sieht in jedem Versuch, eine Semantik zu ‚ontologisieren‘, ein Grundübel, das zu einer „myriad of philosophical puzzles“246 führt. Insbesondere die Behauptung einer allgemeinen Strukturanalogie zwischen Prädikaten und Eigenschaften sei Ausdruck einer solchen üblen Ontologisierung sprachlicher Zusammenhänge. Er nennt die Behauptung einer solchen Strukturanalogie in loser Anlehnung an Wittgenstein auch „picture-theory“.247 Diese Theorie gründet in einem (Korrespondenz-)Prinzip, er nennt es „Φ“, das Heil so formuliert: „When a predicate applies truly to an object, it does so in virtue of designating a property possessed by that object and by every object to which the predicate truly applies (or would apply).“248 Ohne jetzt die wahrheitstheoretischen Implikationen von Φ erörtern zu können, möchte ich festhalten, dass dieses Prinzip jedenfalls eine strikte Korrespondenz von Prädikaten und Eigenschaften besagt. Φ umfasst dabei die Behauptung, dass jedes wohlgeformte Prädikat für eine Eigenschaft steht und jene, dass sich die Struktur der Eigenschaft an der Struktur des Prädikats ablesen lässt. Heils Motiv, eine solche strikte Korrespondenz abzulehnen, ist, dass sich so, relativ zu den verschiedenen Stufen von Prädikaten, eine Hierarchie von Eigenschaften, folglich verschiedene Schichten der Realität ergeben. Φ impliziert ein VielSchichten-Modell der Wirklichkeit. Die Erklärung des Zusammenhangs und der Abhängigkeit der Schichten voneinander führe in die besagte „myriad“ von Problemen.249
Ich möchte mich nicht in die Details der Heil-Exegese begeben. Vor dem Hintergrund des eben Gesagten scheint mir Φ zudem einen Dammbruch in Richtung jenes Extrems zu ermöglichen, das eine abundante und schier unüberschaubare Ontologie von Eigenschaften impliziert. Lässt man auf der sprachlichen Ebene z.B. beliebig komplexe konjunkte und disjunkte Prädikate zu, was durchaus seinen Sinn hat, muss man nach diesem Korrespondenzprinzip wohl auch beliebig komplexe konjunkte und disjunkte Eigenschaften zulassen. Ähnliches ist bezüglich jener aussagend gebrauchten Ausdrücke zu sagen, welche beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer Kategorie besagen. Dann wäre eine Substanz zu sein eine Eigenschaft ebenso wie, um das Beispiel nochmals aufzugreifen, Träger von Eigenschaften zu sein.
Φ bedeutet als allgemeines Prinzip (und so ist es formuliert) jedenfalls, dass jedes Prädikat so zu deuten ist, dass eine ihm korrespondierende Entität jenem Objekt zukommt, von dem es ausgesagt wird. Es gibt nach Φ keinen anderen Weg, die ontologische Relevanz von Prädikaten zu interpretieren als durch Verweis auf Entitäten, Heil spricht von Eigenschaften. Stimmt, wofür John Heil argumentiert und die Dramatik von Dammbrüchen spricht, Φ jedoch nicht, steht es einem frei, die ontologische Relevanz von Prädikaten nicht in allen Fällen so zu deuten...