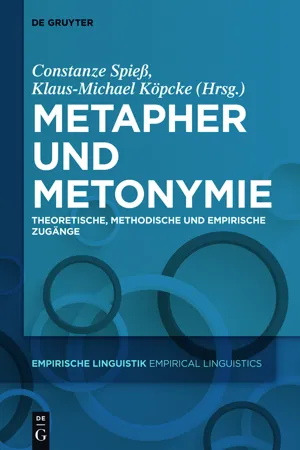Zur Bedeutung der expliziten Reflexion von Symbolen und Phantasien in Lernprozessen
1 Einleitung: Symbolisierungen und Phantasien in der Schule?
Symbolisierungen und Phantasien haben im Alltag, in der Kunst, in mußevollen oder auch kritischen Situationen des Lebens eine ausgesprochen produktive Rolle. Die Kunst – Literatur, Theater, Malerei, Musik – zeichnet sich geradezu dadurch aus, dass sie die Wirklichkeit nicht nur reproduziert, sondern transzendiert. Damit können tiefere und auch utopische Momente der Wirklichkeit erschlossen werden. Symbolisierungen und Phantasien spielen dabei eine zentrale Rolle. In diesem Aufsatz geht es nun um die Frage, ob das, was in der Kunst so produktiv sein kann, auch bei rationalen Denk- und Lernprozessen eine Rolle spielt. Das ist zugleich die Frage, ob und inwiefern Symbolisierungen und Phantasien in einem vergleichsweise zielorientierten Unternehmen wie Unterricht ihre produktive Potenz entfalten können.
Richard Rorty (1994: 24) fordert in seinen bildungstheoretischen Überlegungen über das „bildende Gespräch“, man solle „das Streben nach Gewissheit“ durch die „Forderung nach Phantasie ersetzen“. Diese „Forderung nach Phantasie“ versuche ich im Folgenden theoretisch zu unterfüttern, indem ich Lernprozesse als Sinnkonstituierungsprozesse begründe. Außerdem versuche ich die „Forderung nach Phantasie“ durch den didaktischen Ansatz der Alltagsphantasien zu konkretisieren. Meine zentrale These dabei ist, dass durch die Berücksichtigung und Reflexion von Phantasien und Symbolen in gegenstandsorientierten Lernprozessen Sinn konstituiert werden kann. Genauer: die Subjekte konstituieren im Zusammenspiel von subjektivierenden Phantasien und den objektivierenden Fakten des Gegenstandsbereichs ihren jeweils eigenen Sinn (Combe/Gebhard 2012). Die pädagogische bzw. didaktische Annahme ist, dass Lernprozesse dann erfolgreicher und sinnvoller sind, wenn der symbolisierende, subjektivierende, intuitive Zugang zu den Phänomenen im Unterricht nicht nur geduldet, sondern zum Gegenstand expliziter Reflexion und des sozialen Austausches gemacht wird. Denn: „In der gebührenden Anerkennung der Phantasietätigkeit […] haben wir das einzige Mittel, um mechanischen Methoden des Unterrichts zu entgehen“ (Dewey 1916).
2 Lernprozesse und Sinnkonstituierung
Die Metapher von der „Lesbarkeit der Welt“ transportiert den menschlichen Wunsch, „die Welt möge sich in anderer Weise als der bloßen Wahrnehmung und sogar der exakten Vorhersagbarkeit ihrer Erscheinungen zugänglich erweisen: im Aggregatzustand der ‚Lesbarkeit‘ als ein Ganzes von Natur, Leben und Geschichte sinnspendend sich erschließen“ (Blumenberg 1981: 10). Dieser Wunsch als Inbegriff des „Sinnverlangens an die Realität“ ist Grundlage und Motor für Religion, Kultur und aufgeklärte Wissenschaft. Hans Blumenberg verfolgt diesen Wunsch vom biblischen Weltverständnis und der griechischen Kosmogonie, über Goethes Naturauffassung bis hin zur modernen Biologie, dem genetischen Code. Die Lesbarkeit der Welt erweist sich dabei als eine Konkretisierung des menschlichen Bedürfnisses, die Welt mit Bedeutung und Sinn zu versehen bzw. sie als eine sinnvolle zu interpretieren.
Dass sich die Welt als lesbar und damit sinnhaft erweist, liegt möglicherweise auch an der Welt. Dies will ich allerdings hier nicht diskutieren, auch wenn diese metaphysische Dimension mit der Metapher der Lesbarkeit der Welt anklingt, wodurch auch Fragen von Transzendenz und Religion berührt werden. Die Lesbarkeit verstehe ich im Folgenden weniger als Ausdruck eines prästabilisierten und vorfindlichen Sinns – diese Frage lasse ich offen –, sondern ich akzentuiere eher das Lesen, das Lesenwollen bzw. Lesenmüssen des Menschen als Ausdruck eines geradezu anthropologisch fundierten Sinnverlangens.
Diese Perspektive betont den subjektiven Akt der Sinnkonstitution; sie macht eher Aussagen zur Sinnbedürftigkeit der Subjekte und weniger Aussagen über die Sinnhaftigkeit der Welt. Ich werde zu zeigen versuchen, dass diese Perspektive, die den Menschen als sinnerzeugendes, geradezu sinnbedürftiges Wesen begreift, für pädagogisch-didaktische Überlegungen grundlegend sein müsste und dass dabei Symbole und Phantasien eine wichtige Rolle spielen.
Die Sinnfrage zu stellen, berührt auch stets grundlegende Fragen nach dem Wert, dem Zweck oder dem Ziel menschlichen Lebens und ist zugleich auch als ein Anzeichen eines grundsätzlichen Zweifels zu bewerten. Das Leben ist eben nicht fraglos sinnvoll, hat nicht ein selbstverständliches Ziel, sondern muss mit Sinn und Bedeutung aufgeladen werden. In der Philosophie besteht eine relativ große Einigkeit darüber, dass Sinn nur ein subjektiv konstituierter sein kann. Gegebenen oder geoffenbarten Sinn gibt es nur in religiös fundierten Systemen. Da freilich auch diese nicht gegen den bereits genannten Zweifel gefeit sind, ist Sinn nur zu haben in der unablässigen Suche, der immer wieder neuen Konstruktion, um so die Sinnfrage zwar nicht zu beantworten, aber ihr auch nicht zu erliegen. A. Camus (1942) spricht geradezu vom „Widerstand gegen die Absurdität des Daseins“.
So schafft das besagte „Sinnverlangen an die Realität“ es natürlich nicht, den Sinn der Realität, der Welt, des Lebens gewissermaßen abschließend zu finden, aber das nachhaltige Verlangen nach Sinn kann als stete Anstrengung der Sinnkonstitution zu einem subjektiv als sinnvoll verstandenem Leben führen, auch wenn die Frage nach dem Sinn letztlich nicht beantwortet werden kann. Schon die explizite Frage ist für Wittgenstein (1921) verdächtig: „Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems. (Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand?“ Und Adorno (1966): „Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach; vor der Frage flüchtete es.“ So hat die Sinnkategorie immer auch etwas zu tun mit einem Widerstand: gerade, weil der Sinn nicht fraglos sich ergibt, wir also Widerständiges erleben, sind wir angehalten und motiviert, uns auf den Weg zu machen, und auch dabei spielt das Phantasieren, das „Sinnieren“, eben das Symbolisieren eine wichtige Rolle.
Das besagte Sinnverlangen an die Realität hat gute Chancen realisiert zu werden, wenn wir bei der Aneignung von Lerngegenständen objektivierende und subjektivierende Perspektiven gleichermaßen kultivieren. Das bedeutet, neben der gewissermaßen faktischen Bedeutung auch die symbolische, oft latente Bedeutung der Phänomene zu erschließen, das heißt, diese zum Gegenstand expliziter Reflexion zu machen.
3 Subjektivierung und Objektivierung
Objektivierung und Subjektivierung stellen die jeweilige Art der Beziehung dar, die das Individuum (Subjekt) zu einem Gegenstand (Objekt) hat. Unter Objektivierung verstehe ich in Anlehnung an den Kulturpsychologen Boesch (1980) die „objektive“, systematisierte Wahrnehmung, Beschreibung und Erklärung der Realität. Bei der Subjektivierung dagegen handelt es sich um die symbolischen Bedeutungen der Dinge, die in subjektiven Vorstellungen, Phantasien und Konnotationen zum Ausdruck kommen. Derartige Symbolisierungen sind als ein fester und weitgehend unverzichtbarer Teil unserer Alltagssprache anzusehen. Nicht ästhetische oder rhetorische Effekte sind dabei in unserem Zusammenhang wichtig, sondern die Funktion der „Symbole als Ausdruck elementarer kognitiver Prozesse und Instrumente des menschlichen Verstandes“ (Baldauf 1997: 11).
Ernst Boesch benennt die beiden Weltbezüge der Objektivierung und Subjektivierung, um die zwei prinzipiellen menschlichen Haltungen gegenüber den Dingen der Welt zu akzentuieren und entwickelt am Beispiel des (siamesischen) Hausbaus seine Begrifflichkeit:
Das Haus, vom Blätterdach des Buschmanns über den Iglu des Eskimos bis zum klimatisierten Bungalow des Amerikaners erfüllt immer dieselbe Funktion: es stabilisiert die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, es schützt vor Wind und Regen. Dadurch entlastet es den Organismus und gewährt die Perioden der Ruhe und Erholung, die er benötigt. [ ...] Das Haus ist im Grunde einfach eine Klimakammer, die zusätzlich auch noch gewisse soziale Schutzfunktionen zu übernehmen vermag. (Boesch 1980: 51)
Die Handlung „Haus bauen“ erfordert eine Vielzahl instrumenteller Fähigkeiten: systematische Beobachtungen der äußeren Realität, technische Einflussnahme auf diese Realität, handwerkliches Geschick und vieles mehr. Das Hausbauen – also die instrumentelle Veränderung der Realität im Sinne des Menschen – wird um so effektvoller sein, je zutreffender, in gewisser Weise je „objektiver“ die systematisierte Wahrnehmung dieser Realität ist. Diese Art von Weltbezug, die gleichsam die Anpassung des Menschen an seine Umwelt ermöglicht, nennt Boesch „Objektivierung“.
Dieselbe Handlung, deren instrumentelle Bedeutung außer Frage steht, hat zusätzlich und notwendig noch eine subjektive Bedeutung. Dazu gehört die Funktionslust, über äußere Situationen instrumentell, naturwissenschaftlich-technisch verfügen zu können, und – mehr noch – die symbolischen Bedeutungen, die menschliche Handlungen und die Dinge, mit denen wir umgehen, annehmen können. Mit der Handlung „Haus bauen“ verknüpfen sich somit notwendig symbolische Bedeutungszuschreibungen, die über die objektivierende Dimension hinausgehen, diese jedoch nicht etwa in Frage stellen oder gar in einem Widerspruch zu ihr stehen. Werte, Phantasien, Mythenbildungungen, Ästhetisierungen heften sich symbolisch an Handlungen und Wahrnehmungen und verbinden sich untrennbar mit der instrumentellen Funktion bzw. der objektivierenden Bedeutung. Diese Art von Weltbezug nennt Boesch Subjektivierung.
Die Dinge der Welt sind vor diesem Hintergrund nie nur Objekte – als solche blieben sie uns fremd. Zugleich sind sie oder besser symbolisieren sie projizierte Aspekte des eigenen Ichs – auf diese Weise erscheint die Umwelt vertraut und mit persönlicher Bedeutung versehen. Ein Haus ist eben nicht nur eine „Klimakammer“, sondern zugleich auch ein „Zuhause“. Der Architekt beschreibt das Haus anders als derjenige, der in ihm wohnt. Allerdings:
Sobald der Architekt im Hause wohnt, füllt es sich auch für ihn mit Inhalten und Bedeutungen, die in seinen objektiven Plänen nirgends erscheinen – obwohl sie, und das ist vielleicht nicht unwichtig, gerade daraufhin konzipiert worden sind. (Boesch 1980: 62)
In unsere objektivierende Pläne eingewoben sind also unsere subjektivierenden Bedeutungszuschreibungen; beide Weltbezüge sind zwar analytisch trennbar, jedoch in unseren Handlungen und Wahrnehmungen stets vereint, wobei Boesch zufolge die Subjektivierung gleichsam die Richtung angibt:
Der Mensch ist nicht zunächst Architekt, ein kühl-sachlicher Planer, um dann anschließend zum Träumer zu werden, sondern er ist vor allem Träumer, der sich dann zum Architekten entwickeln kann, wenn die Versachlichung genügend fortschreitet, jene Objektivierung, die Piaget so schön beschrieben hat. (Boesch 1980: 62)
In gewisser Weise sind diese Weltbezüge auch in den Piaget’schen Begriffen der Akkomodation und der Assimilation enthalten. Wichtig jedoch ist der Aspekt, dass die assimilierende Subjektivierung nicht nur eine entwicklungspsychologisch frühe Stufe ist (bei Piaget der frühkindliche Egozenztrismus, in der Psychoanalyse der primäre Narzissmus), sondern ein nicht hintergehbarer Weltbezug. Boesch unterscheidet in diesem Zusammenhang die primäre kindliche Subjektivierung von der sozusagen erwachsenen, sekundären Subjektivierung:
Welches ist nun die Beziehung zwischen diesen beiden Arten subjektiver Objektwahrnehmung? Die erste, die des kindlichen Egozentrismus, vermengt das Innen mit dem Außen, Kausalität mit Intentionalität, organische Genese mit künstlicher Herstellung, Vorstellungen mit Ereignissen. Der zweite, der sekundäre Subjektivismus, ist subtiler, schwerer einzusehen. Er besteht nicht in Verkennungen der Wirklichkeit, sondern in Symbolisierungen. (Boesch 1980: 66)
Im Unterschied zu Boesch glaube ich allerdings, dass die strikte Unterscheidung in kindliche, die Realität verkennende und damit in gewisser Weise falsche Subjektivierung einerseits und erwachsene, symbolisierende Subjektivierung andererseits nicht haltbar ist. Zumindest bleiben die kindlichen Subjektivierungen gewissermaßen als affektive Unterfütterung auch des erwachsenen Weltbildes ein Leben lang wirksam. Beide Subjektivierungen versehen die Realität mit Bedeutung, sind Symbolisierungsprozesse und zeigen das „Sinnverlangen an die Realität“ (Blumenberg) an. Symbolisierungen vermengen auch nicht das Innen mit dem Außen, sondern bringen Innen und Außen in Verbindung.
Neben der gewissermaßen tatsächlichen Bedeutung der Umwelt hat die Umwelt noch eine symbolische Bedeutung, heften sich an besondere Ausschnitte der Umwelt „Umwelt-Phantasmen“ und Konnotationen. Ein Apfelbaum beispielsweise kann neben der faktischen Bedeutung, die in Kategorien der Biologie, der Gärtnerei, der Ernährung usw. beschreibbar sind, ganz andere Phantasien und Konnotationen an sich binden. Er kann Merkzeichen für die Fähigkeit des Kletterns sein, erinnert vielleicht an den Garten der Kindheit oder an soziale Erfahrungen des Apfelklauens. Solche persönlichen Assoziationen können sich zusätzlich mit kulturell vermittelten Symbolsystemen verbinden, beim Apfelbaum z.B. mit der Paradiesgeschichte oder mit Schneewittchen.
Subjektivierung und Objektivierung erweisen sich dabei keineswegs als alternative Zugänge zu den Dingen der Welt, sondern stets als gleichzeitig bzw. komplementär, wobei der Schwerpunkt je nach Tätigkeit jeweils verschoben sein kann. Der Künstler und der Wissenschaftler setzen selbstverständlich andere Akzente in der Gestaltung ihres Weltbezugs – eine Erfahrung, die den Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil folgendes Dilemma formulieren lässt: „Ein Mann, der die Wahrheit will, wird Gelehrter; ein Mann, der seine Subjektivität spielen lassen will, wird vielleicht Schriftsteller, aber was soll ein Mann tun, der etwas will, das dazwischen liegt?“