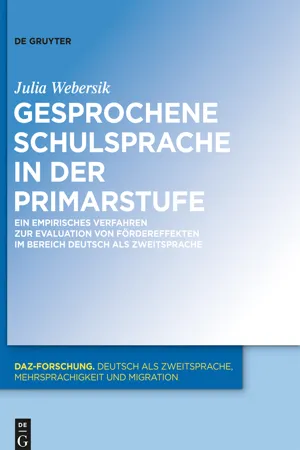![]()
1 Einleitung und Zielsetzung
Wie effektiv ist Sprachförderung? Auf diese Frage lässt sich zum gegenwärtigen Stand der Forschung trotz der zahlreichen Bemühungen, Kinder und Jugendliche beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache (DaZ) zu unterstützen, kaum eine Antwort geben.
Seit dem sogenannten PISA-Schock, im Zuge dessen auch die große Bildungsbenachteiligung von Schülern mit Deutsch als Zweitsprache deutlich wurde, werden in allen Bundesländern diverse Maßnahmen zur Sprachförderung eingesetzt, wobei sich ein Großteil auf den Elementarbereich bzw. das Jahr vor der Einschulung konzentriert. Im Primarbereich scheinen derzeit vor allem sogenannte Feriencamps erfolgreich zu sein (vgl. z.B. Rösch 2008; Ballis & Spinner 2008). Sehr verbreitet sind außerdem DaZ-Vorbereitungs- oder -Lernklassen, Förderstunden und integrative DaZ-Förderung innerhalb des Regelunterrichts (vgl. Rösch 2005a).
Bei vielen dieser Fördermaßnahmen und -programme ist jedoch weitgehend unklar, auf welchem didaktischen Konzept die Förderung basiert bzw. basieren sollte, weil die DaZ-Didaktik in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen steckt (Schmölzer-Eibinger 2007: 140; Lütke 2011b: 105). Darüber hinaus mangelt es vor allem an einer methodisch fundierten Evaluierung der jeweiligen Maßnahmen (Stanat & Müller 2005: 23–24; Stanat, Baumert & Müller 2005: 857; Reich & Roth 2002: 21; Söhn 2005: 65–67; Riemer 2008: 9), was sicher auch auf methodische Schwierigkeiten wie z.B. die Kontrolle von Drittvariablen zurückzuführen ist (vgl. Kaltenbacher 2011: 163). Hopf fasst zusammen:
In der BRD gibt es seit den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts eine zwischen und innerhalb der Bundesländer bestehende große Vielfalt der (sprachlichen […]) Beschulung der Schüler mit Migrationshintergrund, ohne dass eine wissenschaftlich verlässliche Evaluierung der Auswirkungen auch nur einer einzigen Form dieses Unterrichts durchgeführt worden wäre. Dagegen gibt es eine Reihe von Begleituntersuchungen sowie eine fast schon unüberschaubare Literatur, in welcher die Diskussion um die Sprachen- und Leistungsfrage teils mit klugen und plausiblen Argumenten, teils mit emotional aufgeladener Schärfe geführt wird. Befürwortung oder Ablehnung des einen oder anderen Modells basieren dabei einerseits auf allgemeinen Überlegungen, andererseits auf einem bunten Strauß von mehr oder weniger einschlägigen wissenschaftlichen Untersuchungen. In aller Regel wird deren wissenschaftliche Tragfähigkeit jedoch nicht ernsthaft geprüft. Aufgrund der Versäumnisse der Forschung befinden wir uns somit noch heute in einer Situation, in der die Schulpolitik und -Verwaltung, aber auch die Lehrer nicht auf Befunde zurückgreifen können, die es erlauben, bestimmte Unterrichtsarrangements unter Verweis auf ihre wissenschaftlich verlässlich nachgewiesenen Vorzüge einzuführen, andere dagegen begründet abzulehnen. (Hopf 2005: 239)
Zu demselben Ergebnis kommen auch Limbird & Stanat in ihrer zusammenfassenden Darstellung zu Sprachförderprogrammen und ihrer Wirksamkeit:
Über die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen der Sprachförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die in Deutschland zur Anwendung kommen, ist wenig bekannt. Kaum eine Studie hat systematisch untersucht, wie sich die Leistungen der Kinder und Jugendlichen, die an den jeweiligen Programmen teilnehmen, entwickeln. (Limbird & Stanat 2006: 261)
Auch außerhalb groß angelegter Programme „sind die Auswirkungen von Sprachunterricht auf den DaZ-Erwerb noch kaum erforscht und auch der DaZ-Unterricht noch weitgehend empirisch unerforscht“ (Ahrenholz 2003a: 298).
Dieser Befund hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert, so dass es laut Lütke (2010a: 69) keine abschließenden empirischen Beweise gibt, die klären, ob die Sprachaneignung durch unterrichtliche Instruktion gefördert werden kann. Auch Kaltenbacher (2011: 175) kommt zu demselben Schluss: „Welche Maßnahmen […] für bestimmte Altersgruppen die besten Ergebnisse erbringen, ist weit von einer wissenschaftlichen Klärung entfernt“, und Redder et al. (2011) fordern ausdrücklich:
Die Professionalisierung von Förderung setzt voraus, dass Förderkonzepte auf empirischer Forschung basieren und systematisch reflektiert werden. Evidenzbasierung lässt sich durch die kritische Entwicklung von Diagnoseverfahren, die Weiterentwicklung und Evaluation bestehender Förderkonzepte und durch Erkenntnisgewinnung aus sorgfältig geplanten, durchgeführten und in ihren Wirkungen empirisch überprüften Interventionsstudien im Feld gewinnen. (Redder et al. 2011: 11)
Ein Beispiel für eine methodisch fundierte Evaluation eines Sprachförderprogramms stellt das Jacobs-Sommercamp Projekt dar, bei dem in einer experimentellen Feldstudie die Effekte verschiedener DaZ-Sprachförderansätze untersucht wurden.
dp n="19" folio="3" ? In den Folgestudien BeFo I unter der Leitung von Prof. Dr. Petra Stanat und Prof. Dr. Heidi Rösch und BeFo II unter der Leitung von Prof. Dr. Petra Stanat soll eine längerfristige und in den Schulkontext eingebundene Förderung evaluiert werden (Stanat, Baumert & Müller: 24). Anknüpfend an die Ergebnisse der Jacobs-Sommercamp Studie wird in BeFo die Wirksamkeit zweier didaktischer Ansätze der Zweitsprachförderung – Focus on Form (FoF) und Focus on Meaning (FoM) – in Form einer experimentellen Feldstudie mit Prä-Post-Design überprüft.
Die BeFo-Stichprobe umfasst 362 Drittklässler mit Deutsch als Zweitsprache aus 15 Berliner Grundschulen, von denen 252 Schüler mit sprachlichem Förderbedarf über einen Zeitraum von einem Schuljahr (2010/11) nachmittags Förderunterricht erhielten. Dabei wurden sie zufällig auf die Treatmentgruppen (FoF und FoM) und eine Wartekontrollgruppe aufgeteilt. Während „es im FoF-Ansatz primär um Sprachbewusstheit und eine formalsprachlich angemessene Sprachproduktion geht, [fokussiert] der FoM-Ansatz das Verstehen von komplexen fachlichen Inhalten und das Kommunizieren über diese Inhalte“ (Rösch & Stanat 2011: 156). Beide Ansätze verfolgen dabei das übergeordnete Ziel, vor allem solche sprachlichen Kompetenzen zu fördern, die als grundlegend für schul- oder bildungssprachliche Kommunikation angesehen werden (Rösch & Stanat 2011: 156).
Eine wesentliche Voraussetzung für die systematische Evaluierung von Förderprogrammen wie dem BeFo-Projekt sind geeignete Instrumente, mit denen die Lernerfolge gemessen werden können (vgl. Kaltenbacher 2011). Solche validierten Instrumente liegen derzeit nur für einige sprachliche Teilbereiche vor. In vielen Förderprogrammen wird der Erfolg oder Misserfolg der Förderung deshalb durch eigens entwickelte Analyseverfahren ermittelt, über deren Güte meist wenig bekannt ist. Oder es wird auf externe Effekte wie z.B. eine Zunahme an Gymnasialempfehlungen verwiesen (z.B. Benholz 2004), wobei der kausale Zusammenhang zur Förderung nicht empirisch nachgewiesen wird. Aus Mangel an Alternativen werden Testinstrumente z.T. auch für Untersuchungsgegenstände eingesetzt, für die sie nicht konzipiert und deshalb auch nicht oder nur eingeschränkt valide sind (Kaltenbacher 2011: 167–168; Ehlich 2007: 53).
dp n="20" folio="4" ? Gerade für DaZ-Förderung im Schulalter gibt es bisher so gut wie keine validierten Instrumente zur Evaluation der Fördereffekte (vgl. Kap. 4). So liegt bislang auch kein validiertes Verfahren vor, durch das Lernfortschritte in Bezug auf bildungssprachliche Fähigkeiten, denen im Kontext Schule eine Schlüsselfunktion zugesprochen wird und die vielen DaZ-Schülern Schwierigkeiten bereiten, verlässlich erfasst werden könnten. Solche Instrumente sind jedoch angesichts der immer lauter werdenden Forderung nach „durchgängiger Sprachbildung“ (Gogolin & Lange 2011) und Sprachförderung über die Elementarstufe hinaus von großer Bedeutung. Denn neben pädagogisch-didaktischen Ergebnissen sind empirisch verlässliche Erkenntnissen zur Effektivität von Förderansätzen gerade für bildungspolitische Entscheidungen eine notwendige Grundlage (Redder et al. 2011: 11).
Aus den genannten Gründen hat man sich im Rahmen des BeFo-Projekts zur Evaluation der Effektivität der Förderintervention neben dem Einsatz einiger veröffentlichter Tests wie z.B. ELFE 1–6 (Lenhard 2006) oder WWT 6–10 (Glück 2011) für die zusätzliche Entwicklung und Validierung eigener Instrumente entschieden.
In diesem Kontext war es die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, ein Instrument zu entwickeln und zu evaluieren, das Fördereffekte in Bezug auf die gesprochene Schulsprache erfasst (vgl. Kap. 5). Das Verfahren setzt sich aus den Bausteinen Elizitierung, Transkription und Kodierung zusammen (vgl. Kap. 6.3-6. 5). Ziel des Elizitierungsverfahrens ist es, durch eine weitgehend dekontextualisierte Kommunikationssituation einen möglichst authentischen Rahmen zur Produktion gesprochener Schulsprache zu schaffen. Die auf diese Weise elizitierten Sprachproben werden transkribiert und anschließend hinsichtlich ausgewählter Merkmale gesprochener Schulsprache kodiert und ausgewertet. Im Vordergrund stehen dabei lexikalische und morpho-syntaktische Mittel, deren Erwerb im Gegensatz zu anderen sprachlichen Bereichen relativ gut untersucht ist (Landua, Maier-Lohmann & Reich 2008: 171), so dass sich aus den vorliegenden Arbeiten Indikatoren für Erwerbs- bzw. Lernfortschritte ableiten ließen (vgl. Kap. 2). Durch den wiederholten Einsatz des Instruments vor und nach der Förderintervention lässt sich mittels statistischer Verfahren wie dem t-Test oder der Varianzanalyse überprüfen, ob signifikante Unterschiede zwischen den Prä- und Post-Ergebnissen vorliegen, die sich entsprechend als Fördereffekte interpretieren lassen.
Grundlage für die Entwicklung eines solchen Instruments ist die theoretische Modellierung und Beschreibung des zu erfassenden Merkmals, d.h. der produktiven, medial mündlichen schulsprachlichen Kompetenz von Primarschülern mit Deutsch als Zweitsprache. Da bislang keine Konzeptualisierung dieses Merkmals bzw. des entsprechendes Registers vorliegt, werden nach einer zusammenfassenden Darstellung der Relevanz schulsprachlicher Fähigkeiten (vgl. Kap. 2.1) zunächst die Ergebnisse der bestehenden Arbeiten zu den Merkmalen von Schulsprache vorgestellt (vgl. Kap. 2.2).
Eine Besonderheit gesprochener Schulsprache besteht in der Kombination aus medialer Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit. Deshalb werden im weiteren Verlauf der Arbeit Modellierungen zu Mündlichkeit und Schriftlichkeit der Gesprochene-Sprache-Forschung mit Blick auf eine mögliche Verortung gesprochener Schulsprache reflektiert...