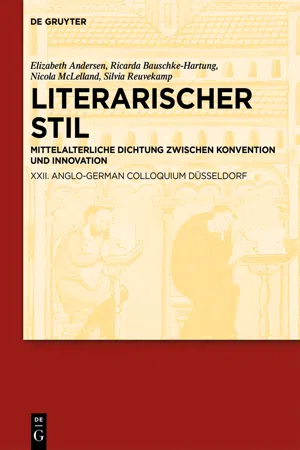
Literarischer Stil
Mittelalterliche Dichtung zwischen Konvention und Innovation. XXII. Anglo-German Colloquium Düsseldorf
- 535 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Literarischer Stil
Mittelalterliche Dichtung zwischen Konvention und Innovation. XXII. Anglo-German Colloquium Düsseldorf
Über dieses Buch
In der derzeit intensiv geführten Debatte um eine historische Poetik der volkssprachigen Literatur des Mittelalters spielt die Kategorie 'Stil' eine untergeordnete Rolle, obwohl sich doch in der Gestaltung und Formgebung der sprachlichen Oberfläche literarisches Selbstverständnis sowie zeitgenössische Auffassungen von Ästhetik und Artifizialität zuallererst konkretisieren. Die Beiträge des Bandes versuchen diese Lücke in ersten Ansätzen zu schließen, indem sie Phänomene sprachlicher Gestaltung oder Formgebung als eigene Ebene poetischer und poetologischer Sinnbildung untersuchen, die begrifflichen Implikationen des Konzepts 'Stil' genauer auszuloten und neue Ansätze zu einer literaturwissenschaftlichen Operationalisierung dieser Kategorie machen. Perspektivisch blickt der Band damit auf eine methodisch neu ausgerichtete Stilforschung innerhalb der germanistischen Mediävistik, die Phänomene sprachlicher Gestaltung konsequent im Schnittfeld von Gattungsdispositionen, text? oder autorspezifischen Schreibweisen, funktionalen Registern und zeit? bzw. epochentypologischen Konfigurationen in den Blick nimmt.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Fußnoten
| 1 | Die Bedingungen der Historisierung eines Begriffes des Ästhetischen im Kontext theologischer Konzeptualisierung des Schönen, lateinischer Poetik und Rhetorik sowie den Beschreibungsmodellen der idealistischen Kunstphilosophie reflektiert MANUEL BRAUN: Kristallworte, Würfelworte. Probleme und Perspektiven eines Projekts ‚Ästhetik mittelalterlicher Literatur‘. In: Das fremde Schöne. Dimensionen des Ästhetischen in der Literatur des Mittelalters. Hrsg. von MANUEL BRAUN/CHRISTOPHER YOUNG, Berlin, New York 2007 (Trends in Medieval Philology 12), S. 1–40. Eine Diskussion des methodischen Ansatzes bietet BENT GEBERT in seiner Rezension des Bandes. In: Arbitrium 28 (2010), S. 25–32. |
| 2 | WALTER HAUG: Literaturtheorie im deutschen Mittelalter von den Anfängen bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Darmstadt 1985, 21992. |
| 3 | Vgl. mit einer einführenden Sondierung des Forschungsfeldes: Im Wortfeld des Textes. Worthistorische Beiträge zu den Bezeichnungen von Rede und Schrift im Mittelalter. Hrsg. von GERD DICKE/ MANFRED EIKELMANN/BURKHARD HASEBRINK, Berlin, New York 2006 (Trends in Medieval Philology 10). |
| 4 | Vgl. insbesondere HAIKO WANDHOFF: Ekphrasis. Kunstbeschreibungen und virtuelle Räume in der Literatur des Mittelalters, Berlin, New York 2003 (Trends in Medieval Philology 3); SUSANNE BÜRKLE:‚Kunst‘-Reflexion aus dem Geiste der descriptio. Enites Pferd und der Diskurs artistischer meisterschaft. In: Das fremde Schöne (Anm. 1), S. 143–170; BRITTA BUSSMANN: Wiedererzählen, Weitererzählen und Beschreiben. Der Jüngere Titurel als ekphrastischer Roman, Heidelberg 2011 (Studien zur historischen Poetik 6). |
| 5 | Vgl. Interartifizialität. Die Diskussion der Künste in der mittelalterlichen Literatur. Hrsg. von SUSANNE BÜRKLE/URSULA PETERS. ZfdPh 128 (2009), Sonderheft. |
| 6 | Vgl. Immersion im Mittelalter. Hrsg. von HARTMUT BLEUMER unter Mitarbeit von SUSANNE KAPLAN. In: LiLi 167 (2012). |
| 7 | GERD DICKE/MANFRED EIKELMANN/BURKHARD HASEBRINK: Historische Semantik der deutschen Schriftkultur. Eine Einleitung. In: Im Wortfeld des Textes (Anm. 3), S. 1–12, hier insbesondere S. 5 f. und S. 12; SUSANNE BÜRKLE: Einleitung. In: Interartifizialität (Anm. 5), S. 1–16, hier insbesondere S. 5; HARTMUT BLEUMER: Immersion im Mittelalter: Zur Einführung. In: Immersion im Mittelalter (Anm. 6),S. 1–15, hier insbesondere S. 6 und S. 14 f. |
| 8 | Vgl. SUSANNE BÜRKLE (Anm. 7), S. 15; CHRISTIAN KIENING: Ästhetik des Liebestods. Am Beispiel von Tristan und Herzmaere. In: Das fremde Schöne (Anm. 1), S. 171–193, hier S. 175. |
| 9 | Eine erste definitorische, begriffsund forschungsgeschichtliche Annäherung bietet HANS ULRICH GUMBRECHT: Stil. In: RLW 3 (2003), S. 509–513, der Stil als gesamtkulturelles Phänomen der „Manifestation von rekurrenten Formen menschlichen Verhaltens in den verschiedensten Materialien und Medien, insbesondere in den Künsten“ (S. 509) versteht. |
| 10 | Eine Ausnahme bildet der 2011 erschienene Beitrag von JENS HAUSTEIN (Mediävistische Stilforschung und die Präsenzkultur des Mittelalters. Mit einem Ausblick auf Gottfried von Straßburg und Konrad von Würzburg. In: Textprofile stilistisch. Beiträge zur literarischen Evolution. Hrsg. von ULRICH BREUER/BERNHARD SPIES, Bielefeld 2011 [Mainzer historische Kulturwissenschaften 8],S. 43–60), der allerdings die Beobachtung von Stilphänomenen für besonders geeignet hält, das Streben der Texte nach einer zweckfreien äußeren Schönheit, die allein darauf zielt, ein besonderes Maß an Gegenwärtigkeit des ästhetischen Objekts zu evozieren, beschreibbar zu machen und damit eine mögliche Neuorientierung mediävistischer Stilforschung relativ einseitig an die rekurrenten Alteritätsparadigmen geschuldete Prämisse einer von gelehrt-lateinischen Schrifttraditionen weitgehend abgekoppelten Präsenzkultur des Laienadels anbindet. |
| 11 | Einen nach Texttypen organisierten Überblick über das in der Forschung bereits Geleistete und noch offene Arbeitsfelder bietet Gert HÜBNER: Rhetorische und stilistische Praxis des deutschen Mittelalters / Applied rhetoric and stylistics in the German Middle Ages. In: Rhetorik und Stilistik / Rhetoric and Stylistics. Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung / An International Handbook of Historical and Systematic Research. Hrsg. von ULLA FIX/ANDREAS GARDT/ JOACHIM KNAPE, 2 Bde, Berlin, New York 2008 und 2009 (Handbücher zur Sprachund Kommunikationswissenschaft 31,1–2), Bd. 1 (2008), S. 348–369. |
| 12 | In eine ähnliche Richtung zielt z. B. BRUNO QUAST, wenn er für eine stärkere Berücksichtigung des Materialen der Literatur plädiert. Vgl.: Gottfried von Straßburg und das Nichthermeneutische. Über Wortzauber als literarästhetisches Differenzkriterium. In: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 51 (2004), S. 250–260. Gerade die aktuelle Forschungsdiskussion um die Sprachästhetik von Gottfrieds Tristan zeigt allerdings, dass es das Verhältnis von sprachlicher Materialität und dem, was man als das ‚Nicht-Hermeneutische‘, ‚Asemantische‘ oder ‚Ornamentale‘ bezeichnen könnte, erst noch genauer zu erfassen gelte und klarere Kriterien für die Beschreibung einer solchen Dimension des Ästhetischen zu entwickeln wären. Dahinter stünde die Frage, ob für literarische T... |
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- Silvia Reuvekamp: Perspektiven mediävistischer Stilforschung. Eine Einleitung
- Stilbegriff und Stilkonzept
- Stilpraxis und Stilideal
- Stil und Klang
- Intertextualität und Traditionalität
- Stil und Hybridität
- Materialität und Stil
- Footnotes
- Abkürzungsverzeichnis
- Register