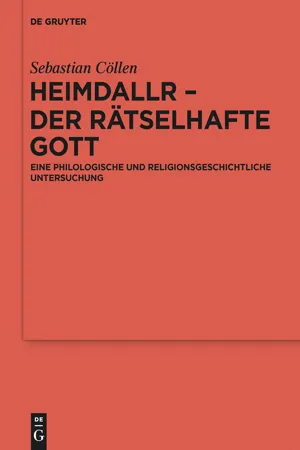![]()
1Einführung
Heimdall ist eine rätselhafte Gestalt. Was von ihm überliefert ist, klingt märchenhaft. Das Dunkel, das über ihm schwebt, war bisher noch nicht befriedigend zu lichten.7
1.1„Der rätselhafte Gott“. Zur Forschungslage
Der Gott Heimdallr (Heimdalr)8 gehört zu den bekanntesten und gleichzeitig auch zu den unbekanntesten der Götter der altwestnordischen Mythologie. Bekannt ist er, weil man bei der Lektüre der Lieder-Edda zumindest bei der Hälfte der Götterlieder auf Heimdallr stößt und weil die Snorra-Edda ihn in den Listen über die Götter als einen der ersten erwähnt9 und ihm in der Schilderung der Mythologie einen entsprechenden Platz einräumt. Unbekannt bleibt er dennoch, weil es der Forschung bis heute nicht gelungen ist, seine verschiedenen Charakterzüge in ein überzeugendes Verhältnis zueinander zu setzen und so aus den schwer greifbaren Andeutungen der Überlieferung eine Gestalt „Heimdallr“ zu formen. Die frühere Forschung hat, wie in den Forschungsübersichten bemerkt wird10, keine übergreifende Kategorie und keine einheitliche Funktion finden können, die die fragmentarischen Angaben zu diesem Gott sinnvoll miteinander verbunden hätte, ohne jeweils einige Seiten von ihm zu vernachlässigen.
Aus mehreren Quellen kennen wir Heimdallr vor allem als vǫrðr goða. Die Bezeichnung war in der Forschung Gegenstand kontroverser Interpretationen; geleitet vom Bild Heimdalls, wie es die Snorra-Edda zeichnet, wurde sie aber häufig in der Bedeutung ‚Wächter der Götter‘ übersetzt. Diese Übersetzung ist jedoch nicht unbestreitbar; in der altnordischen Literatur ist auch eine Bedeutung von vǫrðr im Sinn von ‚Beschützer, Verteidiger‘ belegt, und auch andere, weiter hergeholte Deutungen sind vorgeschlagen worden. Die Bezeichnung vǫrðr goða bildet deshalb keinen sicheren Ausgangspunkt für das Verstehen von Heimdalls Wesen, und wie sie genau zu übersetzen ist, soll in der vorliegenden Arbeit zunächst offengehalten werden.
Auch wenn die traditionelle Deutung von vǫrðr goða im Sinn von ‚Wächter der Götter‘ (und damit auch Snorris Auffassung von Heimdallr) gutgeheißen wird, wird Heimdalls Charakter nicht viel verständlicher. Das Material scheint zu zeigen, dass Heimdallr in jedem Fall nicht nur ein „Wächter“ war. So werden in der ersten Strophe der Lieder-Edda (Vǫluspá 1) die gedachten Zuhörer – seien es nun Menschen oder Götter – die „Söhne Heimdalls“ (megir Heimdallar) genannt. Diese zumindest der Anzahl nach nicht gerade unbeträchtliche Nachkommenschaft und das sich daraus ergebende Motiv Heimdalls als Vaterfigur konnten die Forscher nur schwer mit der angeblichen Wächterrolle in Einklang bringen. Zu diesen beiden Eigenschaften kommen aber noch weitere, nicht weniger undurchsichtige: Snorri Sturluson schreibt, Heimdallr habe Zähne aus Gold, und verknüpft seinen Namen mit Bezeichnungen, die auch für den Widder verwendet werden konnten. Weiterhin soll Heimdallr der Sohn von nicht weniger als neun Müttern sein. Als solcher wird er unter anderem in der zweiten Strophe von Úlfr Uggasons Gedicht Húsdrápa bezeichnet. Diese Strophe ist im Übrigen inhaltlich wenig klar, scheint aber einen Kampf des Gottes mit Loki zu schildern. Der Gegenstand, um den sie kämpfen, ist verschieden gedeutet worden: als ein Schmuck, als die Erde, als das Ur-Feuer. Heimdalls Wohnort ist die Himinbjǫrg, die ‚Himmelsberge‘ (?), die sich nach Snorri dort befinden, wo die Regenbogenbrücke die Welt der Götter erreicht. Im Besitz des Gottes befindet sich das Gjallarhorn, das nach der eschatologischen Vision der Vǫluspá am Ende der Welt ertönen soll.
Die Aufzählung braucht nicht fortgesetzt zu werden. Die Schwierigkeiten, aus diesen Angaben einen schlüssigen Charakter und eine einheitliche Funktion Heimdalls zu ermitteln, liegen auf der Hand. An Vorschlägen dazu hat es freilich nicht gemangelt, im Gegenteil. In ihrer Vielfalt und Widersprüchlichkeit sind sie jedoch nicht weniger verwirrend als die Primärquellen11. Aus den z. T. absolut unvereinbaren Auffassungen von Heimdallr, die seit der Begründung einer eigentlichen „germanischen Religionswissenschaft“ 1835 durch Jacob Grimms „Deutsche Mythologie“12 vorgelegt wurden, vermag gemäß dem heutigen Forschungsstand nur eine einzige, wenig ermutigende zu bestehen: die eines „rätselhaften Gottes“13. So publizierte z. B. der bekannte niederländische Religionshistoriker Jan de Vries 1955 unter diesem Titel (französisch „Heimdallr, dieu énigmatique“14) einen Artikel, den er mit einer vielsagenden Beurteilung der Resultate der früheren Forschung einleitete: „Maintes fois on a fait des efforts sérieux pour déterminer le caractère du dieu scandinave Heimdallr ; le résultat en est néanmoins presque nul“15. Der Stand der Forschung hat de Vries allerdings nicht davon abgeschreckt, einige neue Ideen, teilweise mithilfe von Georges Dumézils Theorie der „Ideologie der drei Funktionen“, vorzuschlagen. Dass das Rätsel „Heimdallr“ damit gelöst wäre, scheint aber auch Dumézil selbst nicht gemeint zu haben, denn nur einige Jahre später erklärte er, der Titel von de Vries’ Artikel sei nach wie vor gerechtfertigt16. Dieses Urteil spiegelt sich auch in den aus dem 20. und gar 21. Jahrhundert stammenden Handbüchern zur germanischen Religionsgeschichte wider. So bemerkte der schwedische Forscher Folke Ström in seinem Buch „Nordisk hedendom“17, das Bild von Heimdallr sei noch „dunkel“ und die Erklärungsversuche seien ebenso vieldeutig und daher verwirrend wie die Angaben in den Primärquellen selbst. Åke V. Ström schloss sich in seinem Buch „Germanische Religion“ aus dem Jahr 1975 dieser Auffassung an und erklärte Heimdallr zu einer „schwer greifbare[n] Gottheit“18. Selbst noch in der schwedischen Ausgabe von Gro Steinslands Einführung „Norrøn religion“ aus dem Jahr 2005 finden de Vries’ Worte Nachhall19.
Diese Forschungslage ist natürlich nicht befriedigend. Wie oben angedeutet, zeigen ja die relativ große Anzahl und der Umfang der Textstellen, die von Heimdallr handeln, dass dieser Gott einen nicht unbedeutenden Platz neben den anderen Göttern der Lieder-Edda einnimmt. In den Handbüchern zur germanischen Religion hingegen führt er ein kümmerliches Dasein und wird es auch weiterhin führen, wenn seine Funktion, sein Charakter und ganz generell seine Bedeutung in der Welt der Nordgermanen nicht näher identifiziert werden.
1.2Die Quellen
Die Quellen, auf die sich die Konstruktion eines Bildes des Gottes Heimdallr zu stützen hat, sind wie gesagt nicht so rar wie jene zu manchen kleineren Gottheiten der altwestnordischen Mythologie. Bezüglich ihrer Art und geographischen Verbreitung sind die Quellen zu Heimdallr allerdings begrenzter.
Für Heimdallr gilt der für die größeren Götter ungewöhnliche Umstand, dass seine Existenz fast ausschließlich durch literarische Quellen – und zwar Quellen des nordgermanischen, genauer gesagt des altwestnordischen Sprachgebiets – bezeugt ist. Abgesehen von einer möglichen Abbildung Heimdalls auf einem Runenstein auf der Isle of Man und einer auf einem Steinstück in Ovingham (Northumberland)20 schweigt das archäologische Material zu seiner Existenz21. Nicht besser sieht es bei den Ortsnamen aus, die sonst häufig von älteren, später verblassten Gottheiten oder von solchen, die vorwiegend ostnordisch von Bedeutung waren, Zeugnis ablegen. Ob die mögliche Ausnahme – der norwegische Berg Heimdalshaugen22 – den Namen des Gottes enthält, ist nicht sicher. Ähnlich „schweigsam“ ist auch das außernordische Schrifttum. Ein Spinnwirtel von Saltfleetby, Lincolnshire, aus dem frühen 11. Jahrhundert weist wahrscheinlich seinen Namen neben dem des Óðinn auf23. In lateinischen Quellen, die eine lange und größere Bekanntheit Heimdalls hätten bestätigen können, wird er nicht erwähnt, und auch in ost- und westgermanischen Quellen kommt er nicht vor oder kann als euhemerisierte Gestalt höchstens erahnt werden24.
Im altisländischen Schrifttum dagegen, vor allem in der Eddadichtung und der sich darauf stützenden Snorra-Edda, wird Heimdallr häufig genannt. Wenn man dem gelehrten Snorri Sturluson glauben darf, war ein ganzes Lied – der Heimdallargaldr25 – nach dem Gott benannt, und mehrere Forscher waren der Meinung, dass Heimdallr der (dann allerdings Rígr genannte) Protagonist des langen Liedes Rígsþula sei. Der weit bekanntere Gott Freyr ist, verglichen damit, nicht in einem einzigen Eddalied die zentrale Gestalt26. Eine besonders herausstechende Position nimmt Heimdallr unter anderem auch in der Vǫluspá und den Hyndluljóð (mit der häufig als interpoliert betrachteten „Kurzen Vǫluspá“, Vǫluspá in skamma) ein. In weiteren Eddaliedern, wie der Lokasenna und der Þrymskviða, tritt er in einigen Strophen handelnd oder sprechend in Erscheinung. In anderen, wie den Grímnis- und den Skírinismál, wird er nur erwähnt. In der späten Skíðaríma (um 1400), die zu den Rímur gehört, hat Heimdallr eine sehr kleine Rolle27.
Auch die Skaldendichtung – Úlfr Uggasons Húsdrápa von ca. 983 und eine Strophe des unbekannten Bjarni (bei Snorri nur mit einem mit A.son abgekürzten Patronymikon näher gekennzeichnet) – enthält Angaben und Mythen zu Heimdallr. Dagegen weist die umfangreiche isländische Sagaliteratur nur wenige Spuren des Gottes auf: Er wird lediglich in Sǫgubrot af fornkonungum und in einer Ausweitung des isländischen Übersetzungswerkes Clemens saga erwähnt.
Was aus dieser Sachlage zu folgern ist, kann erst danach diskutiert werden, wenn ein klareres Bild von Heimdalls Charakter gewonnen wurde. Es kann allerdings bereits festgestellt werden, dass Heimdallr hauptsächlich in der altisländischen literarischen Tradition vorkommt, und dort fast ausschließlich in den mythologischen Quellen, d. h. denjenigen Quellen, in denen die Welt der Götter isoliert zum Thema gemacht wird. Von einem „Heimdallr-Kult“, den man – angesichts der herausragenden Position Heimdalls in der Mythologie – vielleicht in der Sagaliteratur vermuten könnte, wird nicht ein Wort erwähnt.
Diese Übersicht der Quellen muss an dieser Stelle ausreichen. Wegen der mehrfachen Wiederholungen, die ein Quellenkapitel mit vollständiger Wiedergabe der den Gott Heimdallr betreffenden Textstellen mit sich bringen würde, werden die Textstellen und die Hinweise zu den Stellen ihrer Behandlung lediglich am Ende dieser Arbeit in einem Register gesammelt. Der Quellenwert der einzelnen Texte wird im Laufe der Untersuchung gewöhnlich dort, wo eine Textstelle als Hauptquelle zu Heimdallr zum ersten Mal herangezogen und zitiert wird, näher besprochen. Dabei werden nur für die Lesart unmittelbar relevante Abweichungen verschiedener Textvarianten berücksichtigt; für eine ausführliche Übersicht aller Varianten wird auf die etwa 140 Seiten bei Ohlmarks28 hingewiesen.
Auch die Datierung vor allem der Eddalieder soll aus denselben Gründen erst bei den einzelnen Texten näher diskutiert werden. Einige Bemerkungen zum Problem der Datierung seien jedoch vorausgeschickt.
Das Problem berührt bekanntlich nicht in erster Linie die Entstehungszeit der überlieferten Handschriften, die recht gut datierbar sind und deren schriftliche Vorlagen in keinem Fall viel weiter als bis zur ersten Redaktion der Snorra-Edda in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts zurückgehen29. Das Problem betrifft vielmehr vor allem das Alter der mündlichen „Textwerke“ („Lied“, im Unterschied zur abstrakteren „Sage“)30, die in der Forschung häufig als Vorstufe der bewahrten Aufzeichnungen vorausgesetzt werden. Fest steht, dass diese Textwerke aus metrischen Gründen nicht vor dem Ende der Synkopenperiode (um 800 n. Chr.) entstanden sein können31. Wie früh oder spät nach dieser Zeit ein Lied entstanden ist, ist...