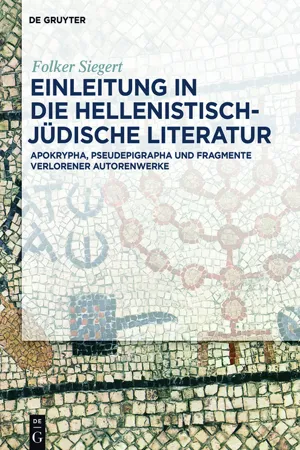![]()
1Übersetzungen aus dem Hebräischen bzw. Aramäischen
Alle Schriften dieses 1. Abschnitts wurden zunächst auf Hebräisch oder auf Aramäisch geschrieben. Alle sind sie auf irgendeine Weise bezogen auf die Hebräische Bibel, also auf das, was in dem Zeitraum zwischen Ben Sira (unten 1.3.1) und einer von Meliton v. Sardes (2.Jh. n. Chr.) berichteten Entscheidungdes Rabbinats213 die Bibel des Judentums künftiger Zeiten werden sollte, später dann auch das Alte Testament der protestantischen Kirchen. Auf all das, was darüber hinaus geht und in der Septuaginta (einer kirchlichen Sammlung) Platz finden sollte, wird erst der 2. Abschnitt eingehen und damit auf das Alte Testament der vorreformatorischen Kirchen.
Von den hebräischen bzw. aramäischen Erstfassungen der Texte dieses 1. Abschnitts haben wir meist nur noch Fragmente, da die Rabbinen sich für alles außerhalb ihrer EntscheidungGelegene nicht mehr interessierten. Komplett – dabei aber oft auch schon erweitert – sindallenfalls die Übersetzungen. Sie sind es denn auch, deretwegen unter dem Titel Hellenistisch-jüdische Literatur Übersetztes zu präsentieren sein wird, im Hinblick nämlich auf seine Rezeption in dieser übersetzten Form. Es werden also, wie unter 0.1.5 bereits definiert, nur solche Texte vorgestellt, die irgendwann eine Übersetzung in die damalige Weltsprache Griechisch erfuhren – sei sie uns erhalten oder auch nicht –, und von da aus oft noch in andere Sprachen.Wo wir beides haben, Original und Übersetzung (1.3.1), richtet sich das Hauptinteresse auf die Übersetzung. Manchmal aber, so gleich zu Beginn (1.1.1–2), werden wir es nur mit Übersetzungen von Übersetzungen zu tun haben, ehe dann (1.2) wenigstens griechische Texte fassbar werden und anschließend (1.3) auch semitische Originale.
Inhaltlich fällt auf, dass vieles in diesem 1. Abschnitt sich mit der Genesis beschäftigt. Das wird auch später immer wieder so sein. Hier zeigt sich ein Kontrast: Während die rabbinischen Schriften sich, sobald man im Rabbinat überhaupt zu schreiben anfing, auf die gesetzlichen Bestimmungen der Tora konzentrierten und daher die Genesis lange unkommentiert ließen und auch beim Buche Exodus erst im Kap. 12 einsetzten, wo die ersten Bestimmungen kommen (so in der Mechilta), haben die Autoren der Pseudepigrapha ein auffälliges Interesse an allem, das davor kommt. Gleiches gilt für das Christentum, das uns diese Schriften wie auch die Schriften eines Philon aufbewahrte.214
1.1Erzähltexte im Anschluss an die Genesis
Den Anfang soll eine Schrift machen, die auf Hebräisch abgefasst wurde und auch inhaltlich „parabiblisch“ ist, nämlich parallel laufend zu Genesis–Exodus. Sie ist, wie auch das später zu nennende Henoch-Buch, als erster Entwurf noch dem 3.Jh. v.Chr. zuzuordnen, dann aber mit vielerlei Bezügen auf später sich Ereignendes aufgefüllt worden.
Heutige Leser von Lev 25 wundern sich, wie auf ein 49. Jahr, das als Sabbatjahr ohne Landarbeit bleiben sollte und wo die Felder und Obstplantagen brach liegen mussten, noch ein ebensolches folgen sollte mit Schuldenerlass und anderen Annehmlichkeiten, die die judäische Gesellschaft sich nie leisten konnte. Dieses sog. Jobeljahr ist eine der aus dem Exil mitgebrachten Utopien, die sich nicht verwirklichen ließen, u.z. schon rechnerisch nicht: Selbst die Rabbinen können uns nicht sagen, ob das Jobeljahr zugleich 1. Jahr einer neuen Siebener-Periode sein sollte oder ob diese erst danach einsetzte.215 Diejenige Jerusalemer Priesterschaft, die im 3. Jh. v. Chr. einen rechnerisch wie praktisch möglichen Lösungsvorschlag gemacht hatte und nachmals als „Essener“ in die Sezession ging, war zu ihrer Zeit längst vergessen.
Jener in Qumran gut belegten Kalenderrechnung aus spätpersischer oder frühhellenistischer Zeit, in welcher 50 Mondjahre (der Tora) 49 Sonnenjahre sind (die Differenz pro Jahr beläuft sich auf knapp 11 Tage), verdanken wir das Grundgerüst und den Leitgedanken des Jubiläenbuchs.
1.1.1Das Jubiläen-Buch als „verbesserte“ Genesis
Eine neugeschriebene Urgeschichte Israels teilt den Weltlauf in „Jubiläen“, d. h. JobelPerioden auf (nach Lev 25); dies sind Zeiträume von 50 Mondjahren = 49 Sonnenjahren. Die Auffassung ist, es seien vonder Schöpfung bis zum Einzugdes Volkes Israel ins Verheißene Land 50 Jubiläen à 50 Jahre vergangen. Das Rechnenmit Daten seit der Weltschöpfung (in christlichen Chroniken dann: anno mundi) hat hier seinen Anfang. So fällt das Begräbnis der Söhne Jakobs (in der Hebr. Bibel nicht erwähnt; vgl. aber Josephus, Ant. 2, 199; Apg 7,16) in Jub. 46,9 ins 2. Jahr der 2. Jahrwoche des 47. Jubiläums = a.m. 2263.216 Dass historische Daten im Judentum eher postuliert als aus vergleichender Chronologie ermittelt wurden (wozu die Benutzung externer Quellen und das Nennen paganerHerrschernamen nötig gewesen wäre), erweist sich nochbei Josephus (s.u. 2.1.7 c). Eine Übersicht über den Weltablauf, wie er in Jub. gemeint sein dürfte, gibt Beckwith, Calendar and Chronology (s.u.) 249–251.
Auf heutige Bibelleser mag es befremdlich wirken, wie im Jubiläen-Buch mit allen, nicht nur den chronologischen Details der biblischen Vorlage umgegangen wird; sie hat jedoch im selben Jahrhundert, dem 2. v.Chr., in der Diaspora durchaus ihre griechischsprachigen Entsprechungen (s.u. 3.2). Hier zeigt sich ein Paradox: In eben jenem Jahrhundert,wo auf beiden Seiten ein Bedürfnis dokumentiert ist, den Tora-Text bzw. den des Nomos wörtlich festzulegen,217 hat auch nochdie größte Freiheit geherrscht im Umerzählen eben dieser Tora. Selbst deren normativer Inhalt, jedenfalls was den Kultkalender betrifft, wurde hier einer Art von „2. Auflage“ unterworfen.
Von dem lange vermuteten hebräischen Original sind Fragmente in Qumran identifiziert worden: 1Q 17–19; 2Q 19 f; 3Q 5; 4Q 176a.b.216–228; 11Q 12,218 insgesamt leider nur wenige Seiten ausmachend, aber paläographisch datierbar (im Falle von 4Q 216) auf die Mitte des 2.Jh. v. Chr. Jedes dieser Fragmente ist auf Hebräisch geschrieben, einer Sprache, die in der Zeit des Zweiten Tempels v. a. für juridische und kultische Zwecke diente: Hier ist, wie auch in der Sektenregel oder im Halachischen Brief, der Anspruch eines „Toragebers“ (more – in more haṣ-ṣedeq steckt das Partizip Präsens Aktiv zu Tora) impliziert.219 Gewissermaßen wird hier versucht, eine vormosaische Tora in Kraft zu setzen. Anscheinend soll sie das „erste Gesetz“ sein (2,24; 6,22), dem gegenüber die Mose-Tora dann das zweite sein wird. Faktisch war es natürlich eine Reform, oder vielmehr der Versuch einer solchen; doch durfte man in religiösen Dingen nicht innovieren, nicht in der biblischen Welt und nicht in der außerbiblischen, und so entging man dem Vorwurf mangelnden Respekts vor der Tradition mit der Fiktion höheren Alters. Wurde diese von der Gesellschaft, d. h. von ihren maßgeblichen Kreisen, akzeptiert, hätte dies ein neues gemeinsames Geschichtsbild bedeutet.
Im Gegensatz zu dieser Teil-Tora ist das sog. Genesis-Apokryphon aus Kairo bzw. Qumran220 durch seine aramäische Sprache deutlich als nichtbiblisch, bestenfalls „parabiblisch“ ausgewiesen. Dieses in der Antike unübersetzt gebliebene Buch wird hier nicht weiter behandelt; vgl. E. ESHEL in: LiDonnici/Lieber, Heavenly Tablets 111–141 über dessen Weltbild im Vergleich mit Jub.; Synopse ebd. 136–141. – Eine inhaltliche Nähe zu dem aram. Buch der Wachenden (unten 1.5.1) und dem gleichfalls älteren, noch schlechter erhaltenen Buch der Giganten (ebd., Zusatz) besteht in Spekulationen über diejenige Engelklasse, welcher der Engelfall von Gen 6,1–4 zuzuschreiben ist (Jub. 5), und in ihrer in aramäischer Tradition hinzugekommenen Bezeichnung mit dem Wort ‘irin, die auch das Daniel-Buch kennt (Dan 4,10.14.20). Umgeschriebene Geschichte und Apokalyptik gehen fortan Hand in Hand.
Zur historischen Situation: Der Versuch einer Reform des Jerusalemer Tempelkults im 3.Jh. v.Chr., insbesondere des ihm zugrunde liegenden, Israelitisches mit Babylonischem mischenden Kalenders (Denis 359–363), war fehlgeschlagen, und die Minderheit derer, die nicht zum Zuge gekommen waren, bildeten als „Zadokiden“ (benannt nach dem ersten Hohenpriester des Jerusalemer Tempels; vgl. Ez 44,15ff; Maier, Zwischen 257–259; ausführlich und bis Ez 40 –48 zurückgehend Albertz, Religionsgeschichte 447–459) eine eigene Religionspartei, die ihre Feste – nach eigenem Kalender – für sich feierte und darum gezwungen war, abseits des Tempels und damit ohne Opfer ihre Gottesdienste zu halten (wegen der Kultzentralisation, die sie akzeptierten). Der Zwist zementierte sich dadurch, dass infolge der Hasmonäersiege die Familie der Zadokide...