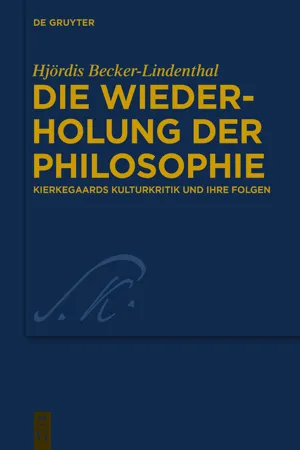![]()
1 Philosophie nach der Philosophie
Hegels wirkungsmächtige Philosophie stellt im Denken der Neuzeit eine Zäsur dar, wie sie in der Geschichte der Philosophie so noch nicht aufgetreten ist: Ihr komplexes System mündet in dem expliziten Abschluß der Geschichte des Geistes, somit auch in der Vollendung der Philosophie als Disziplin. Alle Denker nach Hegel sind daher mit ihrem eigenen ‚Zuspätkommen‘ konfrontiert; sie können entweder Philosophie als Geschichtsschreibung betreiben oder aber versuchen, ihrer eigenen Posteriorität philosophische Relevanz abzugewinnen. Obwohl Hegels geistige Nachkommen den Vollendungsgestus als äußerst provokativ empfunden haben, bekräftigen sie ihn – wenn auch nur vorerst. Das Ende der Philosophie verstehen sie weniger als krönende Selbsterkenntnis des Weltgeistes denn als Kapitulation der Metaphysik vor den Lebensbedingungen der Moderne. Denker nach Hegel zelebrieren daher den endgültigen Abschluß einer Philosophie, welche den konkreten Menschen vernachlässigt habe. Sie treten aber auch mit dem Anspruch auf, Hegels Philosophie ‚aufzuheben‘, und unterwerfen diese einer unerbittlichen, wenn auch nicht immer berechtigten Kritik. Sie definieren das Verhältnis von Philosophie und Geschichte neu, wobei die sozio-kulturellen Veränderungen, die Hegel aus seinem System ausklammert, eine tragende Rolle spielen. Eine Philosophie jedoch, die sich in eine derartige Richtung öffnet, unterscheidet sich wesentlich von dem bis zur Schwelle der Moderne tradierten platonischen Verständnis einer Philosophie, welche sich nur mit dem Wesentlichen einzulassen und alles Zufällige zu entfernen habe37 – „eine Philosophie, die sich auf das Thema der Kultur einlässt“, so Ralf Konersmann, kann „nicht mehr ganz dieselbe sein“.38
Nun wäre es überhastet, Ludwig Feuerbach, Karl Marx und Friedrich Engels, Bruno Bauer, August von Cieszkowski und Moses Hess der Kulturphilosophie zuzuordnen. Als Denker der Posteriorität in erster Generation,39 zu denen auch, so die These dieser Studie, Kierkegaard zählt, weisen sie jedoch auf etwas Entscheidendes hin: Eine Philosophie nach Hegel ist immer auch eine Auseinandersetzung mit der jeweils aktuellen Welt des Menschen. Sie berücksichtigt die Lebensumstände der Moderne. Die Zuwendung zu dem Menschlich-Konkreten, das nun Gegenstand der Philosophie wird, hat auch Folgen für die Gestalt der Philosophie. Sie will sich außerhalb der Universitäten Gehör verschaffen und paßt sich an die veränderten Diskursbedingungen der Moderne an, das bedeutet: Sie verleugnet nicht mehr ihre Literarizität.
Bei aller Rigorosität der Abgrenzung von Hegels Philosophie bleiben die Versuche, die Philosophie neu zu entwerfen, auf Hegel verwiesen – das bezeugt schon die Rolle, welche die Figuren der ‚Aufhebung‘ und ‚Verwirklichung‘ in diesem Vorhaben spielen. Für das paradoxe Unternehmen, die Philosophie ohne Identitäts- und Kenntlichkeitsverlust radikal als Philosophie neu zu bestimmen, hat Konersmann die Formel von der „Philosophie nach der Philosophie“ geprägt.40 Sie gilt es zu erläutern und ihre Funktion für die folgenden Kapitel darzulegen.
1.1 Vollendung und Versöhnung
Die Philosophie Hegels ist mit keinem geringeren Anspruch aufgetreten als demjenigen, die Entwicklungsgeschichte des Geistes zu vollenden – schließlich, so Hegel in den Grundlinien zur Philosophie des Rechts, seien Vernunft und Wirklichkeit an das Ende eines notwendigen Prozesses gekommen und werden sich ihrer Versöhnung in seiner Philosophie bewußt:
[D]ie Gegenwart hat ihre Barbarei und unrechtliche Willkür und die Wahrheit hat ihr Jenseits und ihre zufällige Gewalt abgestreift, so daß die wahrhafte Versöhnung objektiv geworden, welche den Staat zum Bilde und zur Wirklichkeit der Vernunft entfaltet, worin das Selbstbewußtsein die Wirklichkeit seines substantiellen Wissens und Wollens in organischer Entwicklung, wie in der Religion das Gefühl und die Vorstellung dieser seiner Wahrheit als idealer Wesenheit, in der Wissenschaft aber die freie begriffene Erkenntnis dieser Wahrheit als einer und derselben in ihren sich ergänzenden Manifestationen, dem Staate, der Natur und der ideellen Welt, findet.41
Damit, das impliziert eine solche Rhetorik, sei der Schlußstein der abendländischen Philosophie gelegt; eine Philosophie nach Hegel erscheint per definitionem als unmöglich.
Trotz der Provokation, die dem Hegelschen Diktum der Vollendung anhaftet, stimmt die junge Generation der Denker nach Hegel diesem vorerst zu. Auch die kritischen unter ihnen wiederholen die plakative Formel vom Ende der Philosophie. So erscheint sie als Titel eines Essays von B. Bauer,42 Cieszkowski spricht mit Referenz auf Hegel von der Philosophie, „deren wirkliches Ende und wirkliche Vollführung der zweite Aristoteles unserer Tage erst kürzlich vollbracht hat“43, und Heinrich Heine verkündet: „Unsere philosophische Revolution ist beendigt. Hegel hat ihren großen Kreis geschlossen.“44 Jedoch bleibt es nicht bei Anerkennung und Zustimmung. Hegel hat zwar wirkungsstark das Ende der Philosophie verkündet, dabei aber einiges aus ihr ausgeschlossen, was die jüngere Generation als drängende Probleme empfindet. Das Ende der Philosophie, in dessen Lied die Junghegelianer einstimmen, wird von ihnen deswegen auch als das Ende der Hegelschen Philosophie zelebriert und strategisch zur Profilierung des eigenen Vorhabens verwendet. Geschickt unterscheidet Feuerbach eine neuere Philosophie von einer vollkommen neuen Philosophie, die zu entwickeln er sich nach eigener Angabe zur Aufgabe gemacht hat: „Die Vollendung der neueren Philosophie ist die Hegelsche Philosophie. Die historische Notwendigkeit und Rechtfertigung der neuen Philosophie knüpft sich daher hauptsächlich an die Kritik Hegels.“45
In der Kritik der Hegelschen Philosophie nehmen die Begriffe ‚Leben‘ und ‚Existenz‘ einen zentralen Platz ein, denn bei allen Unterschieden eint die Junghegelianer eins: Sie bemängeln die Vernachlässigung der Belange des Menschen aus Fleisch und Blut, der gleichsam durch die Maschen des von Hegel gespannten Geist-Netzes fällt. So betont Feuerbach, die Existenz habe „für sich selbst…Sinn und Vernunft“46, Marx und Engels wollen „von den wirklich tätigen Menschen“ und dem „wirklichen Lebensprozeß“ ausgehen,47 Hess möchte eine Philosophie entwerfen, die nicht hinter dem Leben zurückbleibt,48 und Cieszkowski fordert eine Philosophie, die überhaupt erst ins Leben tritt.49
Während Hegels Verkündung einer Versöhnung von Vernunft und Wirklichkeit nicht die rapiden sozialen Veränderungen des 19. Jahrhunderts berücksichtigt (er verbannt buchstäblich das Problem des Bevölkerungswachstums und der Verarmung der Industriearbeiter durch den Hinweis auf Auswanderung in die USA aus seinem System50), fordert Marx bekanntlich die Verwirklichung der Philosophie durch die Aufhebung des Proletariats.51 Die Geschichte sei eben noch nicht an ihr Ende gelangt, der Mensch noch nicht das geworden, was ihn wesentlich ausmache. Ob im Sinne des sogenannten Kommunistischen Manifests oder einer „Auflösung der Theologie in Anthropologie“52, wie Feuerbach sie vornehmen möchte – die Geschichte des Geistes geht weiter, und wie bei Hegel hat sie auch bei den Junghegelianern ein eindeutiges telos. Mit diesem setzen sie sich jedoch nicht retrospektiv auseinander, vielmehr betonen sie die Zukunftsorientierung ihrer Philosophie. Aus politischer und sozialer Perspektive erscheint die Proklamation des Endes der Weltgeschichte schlichtweg als absurd. Sie impliziert, wie Engels formuliert, eine paradoxe Aufgabe für die Philosophie im traditionellen Verständnis:
Sind aber alle Widersprüche ein für allemal beseitigt, so sind wir bei der sogenannten absoluten Wahrheit angelangt, die Weltgeschichte ist zu Ende, und doch soll sie fortgehn, obwohl ihr nichts mehr zu tun übrig bleibt – also ein neuer, unlösbarer Widerspruch. Sobald wir einmal eingesehn haben…daß die so gestellte Aufgabe der Philosophie weiter nichts heißt als die Aufgabe, daß ein einzelner Philosoph das leisten soll, was nur die gesamte Menschheit in ihrer fortgeschrittenen Entwicklung leisten kann – sobald wir das einsehn, ist es auch am Ende mit der ganzen Philosophie im bisherigen Sinn des Worts.53
Engels’ Präzisierung, daß lediglich die Philosophie im bisherigen Sinn des Wortes...