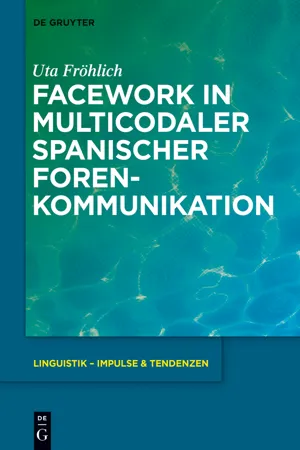![]()
1 Linguistic politeness und facework
Im Zentrum dieser Arbeit, die sich auf multidisziplinärem Terrain bewegt und im Bereich der linguistischen Pragmatik – genauer in der Höflichkeitsforschung – anzusiedeln ist, steht nicht unmittelbar der Begriff (linguistic) politeness, sondern facework.1 Mit facework werden Handlungen beschrieben, die der Beziehung zwischen Gesprächspartnern in einer Interaktion gelten. Somit beschreibt facework jegliche Art von Beziehungsarbeit (GOFFMAN 1967: 12ff.) oder nach Terminologie von HOLLY (1979) Imagearbeit in Gesprächen. Historisch betrachtet entwickelten sich Forschungen zu facework aufgrund von Studien zur Höflichkeit. Seit den frühen 1970ern existieren Untersuchungen zu politeness (WATTS 2003: 10; LOCHER 2012: 36). WATTS (2003: 10) bestätigt dabei den Einfluss der Theorie von BROWN/LEVINSON (1978, 1987) in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft (siehe Kapitel 1.2.1). Im Mittelpunkt sowohl der Theorie von BROWN/LEVINSON (1978, 1987) als auch neuerer politeness- und facework-Studien steht der Begriff face.
Facework umfasst sprachliches Verhalten mit Bezug auf face – eine Art Maske, die wir uns und anderen Gesprächsteilnehmern in einer Interaktion aufsetzen (GOFFMAN 1967; LOCHER 2004). Nach WATTS (2005; siehe Kapitel 1.4.3) schließt facework ein Spektrum von politeness zu ‚unauffälligem‘ und unhöflichem Verhalten ein. Politeness oder auch impoliteness stellen dabei nur einen kleinen Bereich auffälligen oder markierten Verhaltens, in die eine Dialog-Sequenz eingeordnet werden kann, dar. Viel größer ist der Bereich von weniger auffälligem oder unmarkiertem Verhalten der im Gespräch als ‚normal‘ eingestuften Handlungen. Ich nähere mich im Folgenden über politeness dem Begriff facework, indem ich zunächst auf die Begrifflichkeiten polite und politeness eingehe.
Der Begriff polite findet sich historisch betrachtet seit dem 15. Jahrhundert in englischen Wörterbüchern (EELEN 2001: i; KASPER 1998: 677). Inhaltlich lässt sich allerdings keine einheitliche Definition bestimmen: (Sprachliche) Höflichkeit wird in jeder Sprache immer wieder neu verhandelt. Aus diesem Grund ist keine universale Definition möglich (WATTS 2003: 13). Auch innerhalb einer Sprachgemeinschaft, bspw. im Englischen, werden die Termini polite und politeness täglich zwischen Interaktanten ausgehandelt. Entstammen die Gesprächspartner unterschiedlichen Kulturen, kann kein einheitliches Konzept die Grundlage bilden, da jede Kultur etwas anderes unter linguistisch höflichem Verhalten versteht (WATTS 2003: 13).
Des Weiteren kann in Bezug auf Höflichkeit u.a. zwischen einem öffentlichen und privaten Bereich unterschieden werden (siehe BLUM-KULKA 2005). Aufgrund der begrifflichen Verwendung von polite/politeness bzw. höflich/Höflichkeit im täglichen Leben wird im wissenschaftlichen Kontext zur Konkretisierung zwischen politeness1 (Laienverständnis von politeness) und politeness2 (wissenschaftliches Verständnis von politeness/Höflichkeit) (nach EELEN 2001; siehe auch WATTS 2003) differenziert (siehe hierfür Kapitel 1.2.3). Höflichkeit lässt sich somit einerseits bottom-up (ausgehend vom Laienverständnis), aber auch top-down (mithilfe einer politeness- oder facework-Theorie) untersuchen.
Im alltäglichen Sprachgebrauch kann Höflichkeit als gute Manieren oder z.B. als angemessenes (sprachliches) Auftreten im Hinblick auf eine Interaktion innerhalb einer Sprachgemeinschaft erachtet werden. In der linguistischen Pragmatik wird Höflichkeit nicht nur in Bezug auf eine Sprachgemeinschaft untersucht, sondern auch auf einzelne Individuen (FERNÁNDEZ AMAYA ET AL. 2012: 3).
Im folgenden Abschnitt stelle ich das face-Konzept dar. Anschließend erläutere ich politeness und impoliteness, um im weiteren Verlauf dieses Kapitels auf facework, bei mir der Oberbegriff von politeness und impoliteness, anhand der Theorie von WATTS (2005) einzugehen.
1.1 Face
Was andere über und von uns denken, interessiert und fasziniert uns. Studien über dieses Interesse bzw. die Meinung von Individuen über andere Individuen werden im wissenschaftlichen Kontext seit GOFFMAN (1955, 1967) unter den Begriff facework gefasst (HAUGH 2009: 1). Face spielt in vielen Bereichen wissenschaftlicher Forschung eine Rolle, z.B. in der politeness- oder impression management-Forschung, bei Gerichtsdiskursen, Managementpraktiken, Verhandlungen, Konfliktmanagement oder auch beim Zweitsprachenerwerb. Wie aus der Bandbreite der Forschungsfelder deutlich wird, werden mit dem face-Begriff viele verschiedene Phänomene in unterschiedlichen Bereichen innerhalb der Sozial- und Geisteswissenschaften untersucht (HAUGH 2009: 1).
Es wird angenommen, dass das face-Konzept seinen Ursprung in China hat (BARGIELA-CHIAPPINI 2003: 1454). In den wissenschaftlichen Diskurs wurde face erstmals von GOFFMAN (1955, 1967) eingeführt. Auch Goffman beruft sich auf chinesische Quellen (GOFFMAN 1967: 9; siehe auch BARGIELA-CHIAPPINI 2003: 1454). HAUGH (2009: 1) weist deutlich darauf hin, dass das Konzept face erst durch die bahnbrechende Arbeit von BROWN/LEVINSON (1978, 1987) in den Fokus der Wissenschaft gerückt ist.2
Entscheidend für das Verständnis von Goffmans face-Definition ist der Begriff line, den GOFFMAN (1967) wie folgt spezifiziert:
„[…] that is, a pattern of verbal and nonverbal acts by which he [a person] expresses his view of the situation and through this his evaluation of the participants, especially himself. Regardless of whether a person intends to take a line, he will find that he has done so in effect. The other participants will assume that he has more or less willfully taken a stand [...]“ (GOFFMAN 1967: 5).
In der deutschen Ausgabe von GOFFMANS Interaktionsrituale (1971b) wird line mit Strategie übersetzt. Dieser Übersetzung von line kann in diesem Zusammenhang in Bezug auf das Kriterium Intentionalität nicht zugestimmt werden. Eine Strategie impliziert eine bewusste Absicht oder Intention, wohingegen Goffman die Wahl einer line als nicht zwangsweise bewusst beschreibt, auch wenn andere Interaktionsteilnehmer dies als bewusste Entscheidung annehmen mögen. Eine line als Muster impliziert eine vorgegebene Richtung und beschreibt, was für andere Interaktionspartner nach außen in Form von „[…] verbal and nonverbal acts […]“ (GOFFMAN 1967: 5) sichtbar wird. In diesem Zusammenhang definiert GOFFMAN (1967: 5) face als „[…] the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact“ (GOFFMAN 1955: 213).
Face wird als positiver sozialer Wert betrachtet, den eine Person für sich beansprucht. Gesicht oder face wird durch die line gegeben, von der andere Individuen annehmen, man hätte sie in einer bestimmten Interaktion eingenommen. Dies verdeutlicht, dass face3 ein soziales Konstrukt ist. Ebenso leiten sich daraus die Phrasen „to lose face“ (Gesicht verlieren) und „to give face“ (Gesicht geben) ab (siehe GOFFMAN 1967: 9). Da wir alle ein eigenes face besitzen (self-face), wissen wir um das face des anderen (other-face). CHEN (2001) führt den Begriff self-face explizit ein. Er stellt dabei einen wichtigen Teil seines Dichotomie-Modells von einerseits self-politeness und andererseits other-politeness dar. Die Notwendigkeit dieser Zweiteilung besteht für CHEN (2001) in der vorwiegend other-politeness gestützten politeness-Forschung der Vergangenheit, die den Sprecher und seine Handlungen, polite gegenüber anderen zu sein, in den Vordergrund stellt (siehe z.B. BROWN/LEVINSON 1978, 1987).4 Für CHEN (2001: 89) ist nicht nur face of the other oder other-face verletzbar und entscheidend, sondern auch face of self oder self-face. Dies führt zu einer Kombination der Begriffe Selbst und face. Für seine Definition von self verwendet CHEN (2001) einen weiten Selbst-Begriff (siehe FRÖHLICH 2014: 118f.):
„The term 'self', it should be noted, does not only refer to the speaker herself, but also those aligned with the speaker: her family, friends, colleagues, clients, and even her profession“ (CHEN 2001: 88, Hervorhebung hinzugefügt, UF).
Das Selbst bezieht sich in CHEN (2001: 88) folglich nicht nur auf den Sprecher selbst und ist rein individualistisch, sondern wird auf das ‚nähere‘ Umfeld des Sprechers ausgedehnt. Um dies zu illustrieren, führt CHEN (2001: 88) das Beispiel eines Sprechers des Weißen Hauses in den USA an, der eine Art corporate identity vertritt, indem er sich in seiner Funktion an die Öffentlichkeit wendet. Das Selbst ist in diesem Kontext relational, da es sich hier durch die Repräsentation, der Funktion eines Sprechers, äußert. Es handelt sich hierbei um eine Rolle, mit der sich der Sprecher auch eindeutig identifiziert.
Entscheidend im Zusammenhang mit self-face ist es, sein Gesicht zu wahren. GOFFMAN (1967: 12) betont, dass dies die Bedingung für Interaktion, jedoch nicht ihr Ziel sei. Nur der code bzw. der Sprachgebrauch wird ‚sichtbar‘, nicht die Ziele oder Gründe für ein (gezeigtes) Verhalten (GOFFMAN 1967: 12). Unterhaltungen auf der Metaebene deuten meist darauf hin, dass etwas nicht klar kommuniziert wurde, wie z.B. die Frage ‚Wie meinst du das?‘.
Auch kann das self-face eine Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung nach sich ziehen. Die Wortwahl bspw. entscheidet über die Wirkung eines Menschen, ohne dass diesem dies permanent bewusst wäre. Formulierungen können unbewusst gewählt werden, sagen allerdings viel über die Persönlichkeit aus und tragen entsprechend dazu bei, wie eine Person eingeschätzt bzw. wie sie in Erinnerung behalten wird (z.B. als zurückhaltend durch die Wahl vieler Konjunktive oder sogenannter hedges (dt. Abschwächungen) wie z.B. eigentlich).
Face ist nach GOFFMAN (1967) nicht im Körper verortet, sondern kann diffus im „flow of events“ (GOFFMAN 1967: 7) von Begegnungen lokalisiert werden. Es manifestiert sich, wenn Begegnungen gedeutet und interpretiert werden (GOFFMAN 1967: 7). Dies muss nicht nur zwischen einzelnen Personen sein, face kann auch geteilt werden. Darunter versteht GOFFMAN (1967: 42) die schweigende Übereinkunft in vielen Beziehungen. Sportler einer Sportmannschaft identifizieren sich bspw. mit ihrer Gruppe. Dadurch besitzen die Spieler der Mannschaft ein gemeinsames face (siehe HAUGH/HINZE 2003 über ‚saving and losing face‘ in verschiedenen Medien und Textsorten), das durch Erfolg gestärkt oder Misserfolg geschwächt wird. HAUGH (2009: 14) bezeichnet dies als „collective face“. Face bezieht sich in diesem Fall auf den Ruf des Teams (HAUGH 2009: 13). Im Gegensatz dazu steht „personal face“, z.B. sichtbar durch das Verlassen eines Teams ohne jegliche Reue (HAUGH 2009: 14).
Das face-Konzept ist multidimensional. Als geeignetes Untersuchungsfeld von face und seinen Eigenschaften werden Kontexte verbaler Interaktionen erachtet (MATSUMOTO 2009: xii), da face als relational (ARUNDALE 2009: 43;5 TRACY 1990: 210) bzw. interactional (HAUGH 2009:6) gesehen wird und sich somit in Bezug auf andere Interaktionspartner ‚zeigt‘. Interaktionalität von face wird in verschiedener Hinsicht deutlich. Zum einen setzt face eine Bewertung des Verhaltens von Individuen und Gruppen durch andere Individuen voraus. Ohne Interaktion findet weder zu bewertendes Verhalten statt noch kann es durch andere beurteilt werden. Aus diesem Grund behandelt jegliche Forschung zu face(work) die Untersuchung von sozialer Interaktion bzw. Kommunikation (HAUGH 2009: 6). Zum zweiten betrachtet HAUGH (2009) face in einem eher technischen Sinn als interaktional und bezeichnet es als „[…] co-constituted in interaction“ (HAUGH 2009: 6, Hervorhebung im Original)...