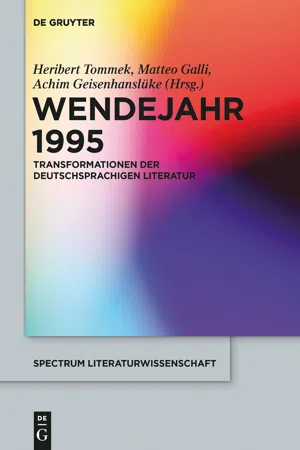![]()
Teil I: 1995 – Strukturartikel
![]()
1 Erinnerung
![]()
Achim Geisenhanslüke
In der Erinnerung
Gedächtnispolitik 1995
Erinnerung 1995
Das Jahr 1995 ist kein Jahr wie alle anderen. Für die Besonderheit des Datums steht nicht nur eine Vielzahl relevanter literarischer Publikationen ein, die sich, wenn auch nicht in dieser Dichte, in vergleichbaren Jahren der Postwendezeit in ähnlicher Ausprägung finden lassen. Das Jahr 1995 unterhält darüber hinaus ein besonderes Verhältnis zur Geschichte, das durch zwei Daten markiert wird: die Wende 1989, die sechs Jahre zurückliegt und die sich auf unterschiedliche Art und Weise, etwa bei Günter Grass [→ Ein weites Feld] und Thomas Brussig [→Helden wie wir], bei Volker Braun [→ Der Wendehals] und Jens Sparschuh, in das Medium des Romans einschreibt, sowie das Ende des Zweiten Weltkrieges, das sich 1995 zum fünfzigsten Mal jährte. 1945 und 1989 bilden eine historische Klammer, die die Gegenstände des literarischen Schreibens im Jahr 1995 in vielerlei Hinsicht bestimmt. Die vieldiskutierte Frage, ob die Wende von 1989 auch literaturgeschichtlich als eine Zäsur zu begreifen ist,63 findet in der Markierung durch das Datum 1945 allerdings eher eine Grenze denn eine Bestätigung. Denn so wie der Zweite Weltkrieg das bestimmende historische Ereignis des 20. Jahrhunderts gewesen ist – unter der nicht selbstverständlichen Voraussetzung, dass erst mit dem Ersten Weltkrieg das „lange 19. Jahrhundert“ zu Ende gegangen ist64 –, so erweist sich die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen als eine der großen Konstanten in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Während im Fall der Wende unklar bleibt, ob politische und literarische Zäsur zusammenfallen, ist das Jahr 1945 wenn auch kein Nullpunkt der Literaturgeschichte, sehr wohl aber beständiges Thema vor allem der erzählenden Literatur. An die Stelle der zeitlich kurz ausgerichteten Zäsur, die das Datum 1989 in historischer wie literaturgeschichtlicher Hinsicht spielen soll, tritt mit dem Jahr 1945 die longue durée von Erinnerungsprozessen, deren archäologische Tiefendimension auszuloten Aufgabe der literaturwissenschaftlichen Kritik ist.
Vor diesem Hintergrund überrascht nur auf den ersten Blick, dass das Thema der Erinnerung im Kontext der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1995 eine zentrale Rolle spielt. Dafür stehen so unterschiedliche Texte ein wie Marcel Beyers [→] Flughunde, Dieter Fortes [→] Der Junge mit den blutigen Schuhen, Elfriede Jelineks [→] Die Kinder der Toten, Christoph Ransmayrs [→] Morbus Kitahara oder W. G. Sebalds [→] Die Ringe des Saturn. Die genannten Texte sind in ihrer ästhetischen Heterogenität sicherlich nicht leicht auf einen Nenner zu bringen. Dennoch verweist die Thematisierung des Zweiten Weltkrieges auf einen gemeinsamen diskursiven Rahmen, den die Texte unterschiedlich ausfüllen. Zu diesen diskursiven Rahmenbedingungen zählt zum einen das allmähliche Verschwinden der Zeugengeneration, das etwa bei Marcel Beyer dazu geführt hat, dass neue, medientheoretische Verfahren der Geschichtsschreibung erprobt werden konnten, zum anderen die Besonderheit der deutschen Erinnerungskultur etwa im Vergleich zu der Frankreichs. Als Maurice Halbwachs den Begriff des sozialen Gedächtnisses und Pierre Nora den des lieu de mémoire prägten, da konnte – wenn auch nicht ohne die damit einhergehenden Verkürzungen und Verdrängungen – die Erinnerungspolitik der Grande Nation mit ihrer ruhmreichen Vergangenheit als Ausgangspunkt für eine Form der nationalen Identitätsbildung gelten, der in der deutschsprachigen Kultur gerade im Kontext der Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges nichts Vergleichbares entspricht. Die Wallfahrt zum Hermannsdenkmal als Ort nationaler Gedenkkultur hat spätestens seit der Vereinnahmung der Arminius-Figur im Nationalsozialismus einen schalen Beigeschmack. Die nationale Identitätsstiftung, die Nora mit dem Begriff des lieu de mémoire verbindet, ist in der deutschen Kultur immer schon durch das Trauma des Zweiten Weltkrieges gestört. Die geographischen Erinnerungsorte der deutschen Gedächtniskultur sind daher auch eigentlich Unorte, Orte der Zerstörung und des Verschwindens, Wunden im Stadtbild wie die Berliner Mauer oder die noch nicht restaurierte Dresdner Frauenkirche. Die symbolischen Erinnerungsorte, die die Literatur stiftet, bleiben davon nicht unbetroffen. Die literarische Erinnerungsarbeit kreist – nicht zuletzt unter der Chiffre Auschwitz – nicht um nationale Denkmäler, sondern um Orte der Zerstörung, um Ruinen und Merkbilder, die Stifter von kultureller Identität nur sein können, wenn sich ihnen die Gewalt einschreibt, von der sie entstellt noch immer Zeugnis ablegen.
Literarische Erinnerung ist daher mehr und zugleich weniger als nationale Gedächtniskultur – mehr, weil sie die Funktion des sozialen Gedächtnisses durch die eigene Arbeit der Entstellung übersteigt, weniger, weil sie die Aufgabe einer kulturellen Gemeinschaftsstiftung nicht erfüllt. „Erinnerungskultur hat es mit ,Gedächtnis, das Gemeinschaft stiftet‘, zu tun“,65 meint Jan Assmann, um in dem Andenken an die Toten zudem ihren religionsphilosophischen Ursprung zu finden. In den Texten von Dieter Forte, Elfriede Jelinek oder W. G. Sebald aber kommen die Toten nicht zur Ruhe. Als Gespenster finden sie in Jelineks Opus magnum Die Kinder Toten eine unheimliche Präsenz, die die nur schlecht gegen Wiedergänger gewappnete Gegenwart bedroht und zum Schluss mit in den Untergang reißt. Die literarische Erinnerungsarbeit stiftet kulturelle Identität als Bekenntnis zu einer Kultur im Sinne Assmanns nur, indem sie die Spuren der historischen Zerstörung zugleich in sie einarbeitet.66 Insofern ist 1945 für die Gedächtniskultur im Jahre 1995 kein äußerliches Datum des gemeinschaftsstiftenden Eingedenkens, sondern als zentrales historisches Ereignis überdies ein NichtOrt, um den die Erinnerung in immer neuen und immer wieder vergeblichen Anläufen kreist.
Geschichte zwischen Scham und Schuld: Bernhard Schlinks Der Vorleser und Marcel Beyers Flughunde
Die Auseinandersetzung mit dem Thema der Geschichte und insbesondere mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs fällt im Jahr 1995 sehr unterschiedlich aus. Der wohl kommerziell erfolgreichste Text des Jahres, Bernhard Schlinks [→] Der Vorleser, legt davon ein beredtes Zeugnis ab. Die Geschichte der erotischen Beziehung zwischen dem Jungen Michael Berg und der ehemaligen KZ-Wärterin Hanna dient keinesfalls der kritischen Aufarbeitung der Vergangenheit, wie es in weiten Teilen der Nachkriegsliteratur üblich war.67 Im Gegenteil: Mit den sehr zeitgemäßen Themen des Analphabetismus und der Sexualität überführt der Roman die Schuldkultur, die die Nachkriegszeit bestimmt hat, in eine Schamkultur, indem er zeigt, wie sich Hanna zunächst ihres Analphabetismus schämt und erst dadurch immer tiefer in die Abgründe des nationalsozialistischen Regimes hineingerät. Ihre späte Alphabetisierung und der Selbstmord dienen nicht der Aufarbeitung ihrer Schuld, sondern der Aufhebung der Scham, die nicht das Leben der vernichteten Juden, sondern das ihre beschädigt hat. In einem ähnlichen narzisstischen Gefängnis ist Michael Berg gefangen, dem es ebenso wenig um Aufarbeitung der Geschichte, sondern einzig um das traurige Schicksal der einstigen Geliebten und die damit verbundene eigene Traumatisierung geht. Gerade der Schluss des Romans nimmt diese Dimension der Scham noch einmal auf. Michael Berg überweist das von Hanna hinterlassene Geld – sie hat sich im Gefängnis das Leben genommen – an die Jewish League against Illiteracy. „Ich bekam einen kurzen computergeschriebenen Brief, in dem die Jewish League Ms. Hanna Schmitz für ihre Spende dankt.“68 Im Mittelpunkt steht der ökonomische Aspekt der Schuld, zugleich aber die Lieblosigkeit eines mit dem Computer erstellten Schreibens, das nicht Hanna Schmitz, sondern die Jewish League against Illiteracy in einem seltsamen Licht erscheinen lässt. Dem Roman geht es nicht um Verarbeitung, sondern um die Abwehr der Erinnerung, die mit Schuld verbunden wäre. Umso erstaunlicher ist es, dass gerade diese Geschichte der Scham, in der eine ehemalige KZ-Wärterin zum Opfer stilisiert wird, zu den erfolgreichsten Texten des Jahres 1995 zählt.
Ein ganz anderes Beispiel für die Auseinandersetzung mit dem Thema der Erinnerung an den Nationalsozialismus gibt Marcel Beyer in seinem Roman Flughunde. Im Mittelpunkt von Beyers Roman steht die Frage nach dem körperlichen Medium der Stimme und dessen Spuren in der Geschichte. Schon das erste Wort des Romans lautet: „Eine Stimme“.69 In Beyers Roman geht es vorrangig um Stimmen, um das Aufzeichnen der Stimme in einem neuen Mediensystem und um das Verlöschen von Stimmen in der Leere der Geschichte:
Beyers Roman ist eine Geschichte der Stimmen und eine Geschichte über Stimmen; er ist der ambitiöse Versuch, die vielfältigen Beziehungen von Sprechen und Denken, Körper undMedium, Manipulation und Gewalt im Kontext faschistischer Herrschaft und Ideologie darzustellen,70
kommentiert Peter Bekes. Vor diesem Hintergrund hat die Forschung immer wieder darauf hingewiesen, dass das Aufschreibesystem des Tontechnikers Kar- nau, der zentralen Figur des Romans, postmodernen Medien- und Sprachtheorien entlehnt ist. Hubert Winkels notiert: „Wie an anderen Stellen auch folgt er dabei den Untersuchungen des Medientheoretikers Friedrich Kittler, ohne dabei allerdings zu dessen literarischem Zauberlehrling zu werden“.71 Und Bernd Künzig fügt dem hinzu:
Die Physiologie der Stimmkartographie ist mit Michel Foucaults Analyse einer modernen, bürgerlichen Wissenschaft verknüpft, deren Ziel es ist, einen neuen Begriff vom Subjekt zu errichten und dieses mit Hilfe der neuen Erkenntnisse zu kontrollieren.72
Es ist die postmodernen Theorien abgelesene Ambivalenz von Stimme und Schweigen, die Beyer Karnaus wissenschaftlichem Verfahren kritisch zugrunde legt. Aus seinem hybriden wissenschaftlichen Interesse heraus verstrickt sich Karnau immer tiefer in die Abgründe des Nationalsozialismus. Zunächst zeichnet er an der Front die Stimmen der Sterbenden auf, später scheut der auf den ersten Blick freundlich wirkende Mann auch nicht vor grausamen Experimenten an KZ- Häftlingen zurück. Karnau erscheint im Roman gerade durch seine Unauffälligkeit, die bald in ein pathologisches Bild umschlägt, als ein überzeugendes Paradigma der Unmenschlichkeit, die die nationalsozialistische Herrschaft kennzeichnete.
Wie Beyer zeigt, gehorcht Karnaus letztlich pathologisch zu wertendes Wissenschaftsinteresse – als Kind hatte er seine Stimme auf einer Tonbandaufzeichnung gehört und nicht erkannt; dieses frühe Ereignis der Persönlichkeitsspaltung versucht er durch die Kartographie der Stimme zu verarbeiten – einer Dialektik von Allmachtsphantasie und realer Ohnmacht. Der Schluss des Romans verlässt überraschend die historische Ebene und wechselt in die Gegenwart. 1992 wird Karnau ausfindig gemacht, bevor er unerkannt wieder verschwindet. In seinen Erinnerungen an die letzten Tage im Führerbunker erlebt Karnau die eigene Ohnmacht noch einmal an der ihn belastenden Tatsache, dass er die Goebbels-Kinder im Bunker nicht schützen konnte. Im Rahmen postmoderner Medientheorien ein neues Bild auf die Geschichte des Nationalsozialismus geworfen zu haben, ohne dabei die Frage nach der Dimension persönlicher Schuld ausgeblendet zu haben, ist das Verdienst Marcel Beyers, der damit ästhetisch wie politisch einen ganz anderen Weg eingeschlagen ha...