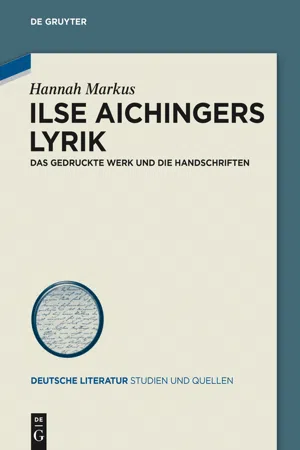![]()
1Einleitung
Ende 2005 übergab Ilse Aichinger ihren Vorlass dem Deutschen Literaturarchiv Marbach (DLA). Darunter waren acht Mappen mit Lyrik – zahlreiche Vorstufen zu ihren publizierten Texten, die deren Genese dokumentieren, aber auch fast einhundert bislang unbekannte Gedichte und Gedichtentwürfe. Sie erlauben Einblicke in Aichingers Arbeitsweise, lassen nach ihrer Veröffentlichungspraxis fragen und erweitern das bislang bekannte lyrische Werk so, dass es einer Re-Lektüre unterzogen werden muss. Die vorliegende Arbeit analysiert das Verhältnis des unveröffentlichten zum veröffentlichten Werk, die Charakteristika und Entwicklungslinien sowie die Anlage und Struktur der Gedichte. So werden die poetischen Prinzipien nachvollziehbar, die Aichingers Lyrik prägen.
1.1Forschungsstand und Ausblick auf das Forschungsvorhaben
Ilse Aichingers publiziertes lyrisches Werk ist schmal, und wirkliche Verbreitung hat nur ihr 1978 veröffentlichter und 1991 um sechs Texte ergänzter Gedichtband Verschenkter Rat1 erfahren. Dennoch sind unter den zahlreichen Preisen, welche der 1921 geborenen Autorin seit 1952 für ihr Œuvre verliehen worden sind, auch drei Auszeichnungen für ihre Lyrik: 1979 erhielt sie den Georg-Trakl-Preis, 1982 den Petrarca-Preis und 1984 den Günter-Eich-Preis.
Nicht nur in der Fachwelt, auch beim Lesepublikum stießen Aichingers Gedichte offenbar jahrelang auf reges Interesse – hiervon zeugt die für eine Lyrik-Publikation ungewöhnlich hohe Auflagenzahl des Gedichtbands. Noch im Erscheinungsjahr 1978 erreichte verschenkter Rat die zweite Auflage und 1981 die dritte (nun als Taschenbuch), die erweiterte Fassung im Rahmen der Werkausgabe von 1991 wurde bisher sogar dreimal aufgelegt, und zudem nahm der Fischer-Verlag den Gedichtband als eins von drei Werken in die Aichinger-Sonderausgabe der Reihe Werke in einem Band auf (1978 und 1986). Verschenkter Rat erfuhr Übersetzungen ins Französische (1987), Niederländische (1987), Polnische (2002) und ins Spanische (2011).2 Auch in den umfangreicheren deutschsprachigen Lyrik-Anthologien des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Autorin beinahe ausnahmslos vertreten – wenn auch in der Regel nur mit einem oder zwei Gedichten.3 Dennoch hat eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrem lyrischen Werk bis in die 1990er Jahre nur ausgesprochen begrenzt stattgefunden. Der erste Beitrag, der mehr als Rezensionscharakter besitzt, stammt von 19684 – eine Annäherung an die bis dahin veröffentlichten Gedichte,5 in der Alexander Hildebrand an ausgewählten Texten auf sieben Seiten einige Charakteristika der Aichinger’schen Lyrik aufzeigt, so ihre auffällige Klangstruktur. Acht Jahre später folgt eine elfseitige Darstellung von Zdenko Škreb, die sich der Spannung zwischen schlichter Sprache und Dunkelheit der Texte widmet.6 Škreb versucht, Aichingers kritische Weltsicht nachzuweisen, und wie bei Hildebrand finden sich hier interessante Ansätze. Doch der behandelte Textkorpus ist in beiden Fällen zu klein, als dass sich fundierte Aussagen ableiten ließen.
Ähnlich verhält es sich mit der ersten Monographie, die versucht, möglichst alle veröffentlichten Aichinger-Texte zueinander in Beziehung zu setzen.7 22 Seiten widmet Marianna E. Fleming dabei den bis dato (1974) „[e]twa dreissig“8 an verstreuten Orten publizierten Gedichten Aichingers, von denen sie 15 genauer beleuchtet. Während einige individuelle Analyseansätze sehr vielversprechend sind9 und Fleming immer wieder treffende Beobachtungen zur Charakteristik der Klangstruktur in Aichingers Lyrik macht,10 muss der begrenzte Umfang ihrer Untersuchung zwangsläufig andere Aspekte stark vernachlässigen. Zudem ist der behandelte Korpus, auch in Hinblick auf Entstehungszeit und Publikationsform, ausgesprochen heterogen, sodass sich daran keine weitreichenderen Thesen prüfen lassen.11
Mit der Veröffentlichung von verschenkter Rat im Jahr 1978 bot sich die Möglichkeit nun. Doch zunächst wurden Aichingers Gedichte seitens der Wissenschaft weiterhin eher stiefmütterlich behandelt. Bis Anfang der 1990er Jahre lieferten stattdessen Rezensionen und die Laudationes der Lyrik-Preise die beste Möglichkeit für eine Heranführung an ihre Lyrik.12 Hervorzuheben ist hier vor allem die Rezension von Heinz Schafroth, der eine Weiterentwicklung und Radikalisierung der Gedichte in Hinblick auf „Frage- und Infragestellung“ behauptet und Hinweise auf lohnende Untersuchungsfelder gibt, etwa auf Aichingers Chiffrensprache.13 Peter Hamm erläutert das Prinzip der Dialektik in Aichingers Gedichten und verwehrt sich gegen den Begriff der Hermetik,14 während Elsbeth Pulver demonstriert, wie „Lesererwartungen“ in den Gedichten grundsätzlich unterlaufen werden, ohne dass das unerwartete Moment zum Effekt wird.15 Die Laudationes sind vergleichsweise weniger ertragreich: So beschäftigt sich Reinhard Urbach in der Rede zum Trakl-Preis nur mit dem Gedicht „In einem“16, und Michael Krüger versucht in der Petrarca-Preis-Laudatio, die Gründe für die Entscheidung der Jury an vier Gedichten zu belegen, wählt aber dafür einen bewusst unwissenschaftlichen Ansatz: Intuitiv, „über jeden manifesten Inhalt, jeden Sinn und jede Aussage hinweg“ erfahre der Leser eine „blitzhafte Vereinigung“ mit den Texten; die Gedichte sperrten sich „gegen den besserwisserischen Zugriff gelehrter Anstrengungen“.17 So werden die Gedichte von Krüger, offenbar unbeabsichtigt, ins Dunkle der Hermetik gerückt.
Über solche gattungsgemäß erklärtermaßen subjektiven Darstellungen gehen in den 1980er Jahren allein zwei Aufsätze hinaus: Erich Fried schreibt 1981 in der Neuen Rundschau 14 Seiten „Über Gedichte Ilse Aichingers“18, und Schafroth, Schweizer Germanist und seit Jahren mit Aichinger befreundet, veröffentlicht 1986, acht Jahre nach seiner Rezension, noch ein mit Anhang zwölf Seiten umfassendes Porträt der Lyrikerin.19 Frieds wichtigste These ist, dass gerade die augenscheinliche „Austauschbarkeit“ von Chiffren und Metaphern in der Bildsprache Ilse Aichingers Sinn transportiert: Konstituiert werde die Trennung von Wirklichkeit und Sprachrealität. 20 Die meisten Gedichte künden für ihn von Verzweiflung „an der Sinnhaftigkeit des Tuns und Treibens dieser Welt“21, was Fried an elf Beispielen demonstriert. Im Fokus von Schafroths Aufsatz steht, Frieds Gedankengang durchaus verwandt, was er „[d]as absurde Glück“22 nennt: eine Wechselwirkung der „radikalen Verzweiflung und des radikalen Selbstbewusstseins“23, welche die Gedichte durchziehe – ohne dass die Texte auf provokante Effekte angelegt seien.24 Beide Texte, wiewohl in Form und Sprache eher dem Feuilleton als der Germanistik nahe, liefern trotz ihrer Kürze wichtige Denkanstöße für die Aichinger-Forschung.
Drei Monographien widmen sich in den 1980er Jahren Aichingers Gesamtwerk. Bei Dagmar Lorenz finden sich 1981 immerhin 38 Seiten über den Gedichtband verschenkter Rat sowie über einige Einzeldrucke.25 Zusätzlich behandelt sie auf neun Seiten die von ihr mit einem Aichinger zugeschriebenen Begriff als ‚Prosagedichte‘ bezeichneten Texte aus dem zweiten Teil von schlechte Wörter.26 Trotz dieses Prädikats27 legt Lorenz den Schwerpunkt in ihrer Untersuchung der Prosagedichte allerdings auf Inhaltsangaben mit Deutungsansätzen. Obwohl sie betont, dass die Progression der Texte nicht in der „kausal-temporalen Handlungsführung“, sondern in den „Wort- und Sinnzusammenhängen“ bestehe,28 vernachlässigt sie diesen Aspekt sowie die Besonderheiten von Sprache und Form.29
In Hinblick auf die Gedichte aus verschenkter Rat geht Lorenz einerseits davon aus, dass in der Lyrik Aichingers weder eine „radikale formale noch eine gehaltsmäßige Entwicklung“ stattgefunden habe, anders als im Prosawerk, das sich immer weiter radikalisiere und schließlich mit den Prosagedichten in schlechte Wörter „im Anarchischen“ münde.30 Andererseits behauptet sie eine „Wandlung der Ansichten“ in Aichingers Gedichten, die durch den Dialog der beiden konträr zueinander stehenden öffnenden bzw. schließenden Gedichte des Zyklus noch betont werde.31 In ihrer Untersuchung behandelt sie jeden der 86 Texte aus verschenkter Rat (1978) in der Reihenfolge des Bands und wendet dafür je maximal die Hälfte einer Druckseite auf.32 Die zugrunde liegende Analysearbeit ist auf so knappem Raum in der Regel nicht nachzuvollziehen. Zudem konzentriert sich Lorenz auf die Übersetzung eines ‚Inhalts‘ der Gedichte.33 Dabei treten bedeutungstragende formale, darunter speziell syntaktische und klangliche Besonderheiten von Aichingers Lyrik in den Hintergrund. Die Metaphern reduziert Lorenz häufig auf ihre alltagssprachlichen Konnotationen, 34 obgleich sie im Vorfeld verschiedentlich betont hat, dass zwar nicht Aichingers Wortwahl, wohl jedoch ihr Gebrauch ungewöhnlich sei: Die Metaphern seien „chiffrenhafter, das heißt, verhüllender, statt illustrierender Art“.35
Die 1984 veröffentlichte Dissertation von Carine Kleiber widmet Aichingers Lyrik etwas über 14 Seiten. Sieben davon entfallen auf verschenkter Rat, die restlichen auf die besagten ‚Prosagedichte‘ in schlechte Wörter.36 Wie Lorenz betont sie, dass in diesen Tex...