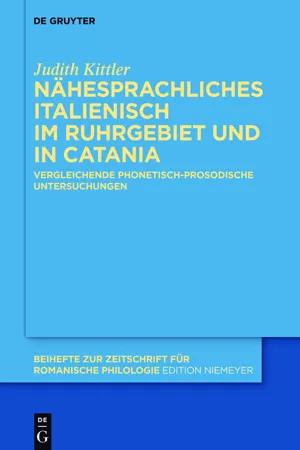
eBook - ePub
Nähesprachliches Italienisch im Ruhrgebiet und in Catania
Vergleichende phonetisch-prosodische Untersuchungen
- 447 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Nähesprachliches Italienisch im Ruhrgebiet und in Catania
Vergleichende phonetisch-prosodische Untersuchungen
Über dieses Buch
Im Fokus dieser Untersuchung steht das nähesprachliche Italienisch von im Ruhrgebiet ansässigen Italienern, die aus Catania stammen. Es werden Unterschiede der Sprechweisen in Lautung und Prosodie herausgefiltert und damit messbar gemacht. Die Besonderheiten der phonetischen wie prosodischen Variation werden darüber hinaus mit denjenigen einer Sprechergruppe aus der Herkunftsprovinz Catania verglichen, um dialektale, innovative sowie kontaktbedingte Merkmale des Italienischen in der Migration beschreiben zu können.
Auf der Webseite des Verlages werden zusätzlich Transkriptionen und Sprechproben aus dem RuhrCat-Korpus zur Verfügung gestellt (siehe Links im Tab Überblick bzw. Overview ).
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Nähesprachliches Italienisch im Ruhrgebiet und in Catania von Judith Kittler im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Historische & vergleichende Sprachwissenschaften. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Im Fokus der vorliegenden Untersuchung steht das gesprochene Italienisch meist süditalienischer im Ruhrgebiet ansässiger Migranten. Italienisch in Situationen der Extraterritorialität ist besonders in den letzten 15 Jahren zu einem bevorzugten Untersuchungsgegenstand verschiedenster Bereiche der Wissenschaft geworden, wie etwa der Soziologie, der Politikwissenschaften, der Rechtswissenschaft, oder auch der Kulturanthropologie (cf. Ehlich 1996, 181). Auch in der Sprachwissenschaft und hier vor allem auf dem Gebiet der Mehrsprachigkeitsforschung, der Soziolinguistik und der Sprachkontaktforschung, hat das Interesse an den oft großen Sprechergemeinschaften italienischer Migranten auf dem amerikanischen und dem australischen Kontinent, sowie insbesondere in Europa stark zugenommen.
Italien kann zumindest bis Ende des 20. Jahrhunderts als ein klassisches Emigrationsland angesehen werden, da es seit dem Beginn der Industrialisierung in großem Maße von Massenemigration, sowie von Binnenmigration von Süd nach Nord betroffen war. Die Gründe hierfür lassen sich vor allem in der wirtschaftlichen Unterentwicklung des agrarisch geprägten Südens ausmachen. Jedoch sind für die Zeit vor der starken Industrialisierung des italienischen Nordens auch dort große Emigrationswellen zu verzeichnen. So emigrierten Italiener seit den 1850er Jahren einerseits in hoher Anzahl in die USA, nach Lateinamerika, Australien und ab Mitte des 20. Jahrhunderts auch in verstärktem Maße in die umliegenden europäischen Länder.
Als Höhepunkt der italienischen Migration nach Deutschland können die 1950er und 1960er Jahre gelten. Das 1955 zwischen Italien und Deutschland geschlossene Anwerbeabkommen, das italienischen Arbeitern – besonders aus den agrarisch geprägten Regionen des Mezzogiorno – ermöglichte, in Deutschland und hier vor allem in den stark expandierenden Bereichen des Bergbaus und der Stahlverarbeitung im Ruhrgebiet eine Arbeit aufzunehmen, löste große Migrationswellen aus. In den ersten Jahren nach dem Anwerbeabkommen reisten Millionen von Italienern aus Sizilien, Sardinien, Kalabrien oder auch aus Apulien und Kampanien nach Deutschland ein und wirkten so dem extremen Arbeitskräftemangel in der boomenden Industrie der Wirtschaftswunderzeit entgegen. Besondere Ballungszentren für Italiener waren vor allem die Großstädte der industriereichen Regionen Deutschlands wie Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Trotz großer Rückwanderungsbewegungen zu Beginn der 70er Jahre, die durch die stagnierende wirtschaftliche Lage und die Ölkrise ausgelöst wurden, leben auch heute noch hunderttausende italienischstämmiger Familien in Deutschland. Allein in NRW zählte das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung im Jahr 20101 121.509 italienische Staatsbürger. Das gesprochene Italienisch im Ruhrgebiet bietet sich als Untersuchungsfeld daher in besonderem Maße auch für diagenerationale Studien an, da inzwischen italienische Familien in vierter Generation dort leben.
In der vorliegenden Untersuchung soll vor allem der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich das gesprochene Italienisch eines Ausschnitts der seit Jahrzehnten im Ruhrgebiet ansässigen italienischen Bevölkerung von demjenigen in den Herkunftsregionen unterscheidet. Anders als in Sprachinselsituatio-nen, die aufgrund der großen geographischen Entfernung vor allem bei italienischen Migranten in Südamerika, den USA und Australien (cf. Bettoni/Rubino 1996; de Fina/Bizzoni 2003; Lattuca/Santoro 2003; Prifti 2014) zu beobachten sind, pflegen die meisten Italiener in Deutschland einen regelmäßigen Kontakt zu Verwandten und Freunden in der Herkunftsregion, der sich dabei nicht nur auf jährliche Ferienaufenthalte beschränkt, sondern auch mit Hilfe von Telefonaten, Briefen, E-Mails und Chats aufrecht erhalten wird. Besonders bei den Mitgliedern der zweiten Generation ist die vermehrte Nutzung des Internets und hier insbesondere bekannter sozialer Netzwerke zur Erhaltung des Kontakts mit der Herkunftsregion und den dort lebenden Verwandten und Freunden zu beobachten. Auch durch das bei der italienischen Sprechergemeinschaft in Deutschland weit verbreitete Satellitenfernsehen werden heute räumliche Distanzen überwunden, und man kann daher bei einer Vielzahl der Italiener von einem nahezu täglichen Kontakt zum gesprochenen Italienisch in Italien ausgehen. Darüber hinaus sind die Italiener im Ruhrgebiet auch durch kirchliche und kulturelle Vereinigungen in stetem Kontakt mit Landsleuten aus anderen Regionen des Herkunftslandes.
Aus dieser besonderen kulturellen wie vor allem sprachlichen Konstellation im «meltingpot» Ruhrgebiet ergeben sich daher vielfältige Bedingungen für die nähesprachliche italienische Kommunikation, die sich aus einem Varietätenkon-tinuum zwischen Standarditalienisch, einer oder mehrerer Varietäten des Regionalitalienischen und (vor allem bei älteren Sprechern) dem Dialekt zusammensetzt. Hinzu tritt noch die Kontaktsprache Deutsch, die je nach Alter der Sprecher eine mitunter wichtige Rolle in der sprachlichen Bearbeitung alltäglicher Kommunikation spielt. Es handelt sich somit um eine variationslinguistische Untersuchung, die zwar von sprachlichen Varietäten bei den untersuchten Sprechern ausgeht, diese aber nicht a priori voraussetzt.
Bis heute ist jedoch eine eher einseitige Beschäftigung mit den Sprachvarietäten, die sich in einem extraterritorialen Migrationskontext manifestieren, festzustellen, da die Sprechweisen der Migranten in erster und zweiter Generation jeweils vor allem dahingehend untersucht wurden, inwiefern die Herkunftssprache Italienisch durch den Einfluss der Umgebungssprache des Aufnahmelandes beeinflusst und möglicherweise grammatikalisch, morphosyntaktisch und vor allem lexikalisch verändert wird. Die Wahrnehmung des gesprochenen Italienischen im Ruhrgebiet, wenn sie sich in Aussagen von Italienisch-Sprechern aus Italien manifestiert, richtet sich jedoch vor allem auf lautliche und prosodische Aspekte, die das Italienische in der Ruhrregion von anderen Varietäten unterscheiden (cf. Kittler 2008).
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die wahrgenommenen Unterschiede in der Lautung auf segmenteller Ebene und der Prosodie auf suprasegmenteller Ebene zu objektivieren und sie damit in einem Ausschnitt des gesprochenen nähesprachlichen Italienisch im Ruhrgebiet messbar und sichtbar zu machen. Die Sprechweisen der Italiener im Ruhrgebiet, die alle aus Catania auf Sizilien stammen, werden darüber hinaus erstmalig hinsichtlich der phonetischen und prosodischen Variation mit denjenigen einer Gruppe, bestehend aus Bewohnern der Herkunftsprovinz Catania, verglichen. Durch die Verknüpfung experimenteller und empirischer Methoden im Bereich der phonetisch-phonologischen und der prosodischen Forschung mit einer migrationslinguistischen Fragestellung schließt diese Arbeit damit in methodischer und migrationslinguistisch fachwissenschaftlicher Sicht eine Lücke und versucht – auf der Basis der empirischen Grundlagen, also bottom-up – darüber Aufschluss zu geben, in welche Richtung sich die Sprechweisen der Muttersprache von Migranten in den ersten Jahrzehnten nach der Zuwanderung – beeinflusst auch durch die Kontaktsprache des Aufnahmelandes – entwickeln.
2 Ziele, Aufbau und Gegenstand der Studie
Die bisher im Bereich der Migrationslinguistik durchgeführten Forschungen haben sich vor allem mit Phänomenen wie etwa dem Code-Switching und -Mixing im mehrsprachigen Diskurs, lexikalischer und morphosyntaktischer Erosion, Pseudoentlehnungen und dem damit einhergehenden Kompetenzverlust im Italienischen beschäftigt. Im Bereich soziolinguistischer Fragestellungen wurden bisher insbesondere Phänomene wie der pendolarismo, also die saisonale Migration italienischer Eisdielenbesitzer aus dem Veneto oder dem Friaul, oder die wahrgenommene sprachliche Identität der in zweiter Generation in Deutschland lebenden Italiener untersucht (cf. Campanale 2006; Melchior 2009). Vor einem geografischen Hintergrund fällt weiterhin auf, dass Einzeluntersuchungen bis dato vor allem die Sprache italienischer Migranten in Bayern und Baden-Württemberg als Untersuchungsgegenstand gewählt haben (cf. Rende 2002; Salmin-ger 2002; Krefeld 2004; Melchior/Krefeld 2008).
Bis auf einzelne Studien, die zunächst einen Überblick über die sprachliche Situation des Italienischen im Ruhrgebiet geben sollten (cf. etwa De Matteis 2004; Bernhard 2010; Bernhard 2013; Bernhard/Lebsanft 2013 ), fehlen jedoch qualitative Untersuchungen des gesprochenen Italienisch in der Rhein-Ruhrregion, die sich vor allem mit der Frage beschäftigen, auf welchen sprachlichen Ebenen sich das nähesprachliche Italienisch in der Migrationssituation von dem in der Herkunftsregion unterscheidet. Hierzu wäre ein direkter Vergleich zwischen einer Sprechergruppe in der Extraterritorialität und Sprechern, deren Italienisch nicht durch Migration und die dadurch auftretenden Kontakte zur Umgebungssprache des Aufnahmelandes beeinflusst wurde, wünschenswert. Auch wurden bisher kaum andere Ebenen der «Migrantensprache» als die lexikalische oder die mor-phosyntaktische Ebene genauer untersucht. Prosodische Variation und Variation in der Gesprächsgestaltung in Bezug auf pragmatische Marker oder Hesitations-phänomene, die zwar weniger «auffällig» wären als kontinuierliche Code-Swit-chings oder grammatikalische Schwierigkeiten, aber dennoch vorhanden sein können, sind ein noch nicht behandeltes Terrain im Bereich der Migrationslin-guistik.
Die Auswertung eines auto- wie hetero-perzeptiven Experiments einer Voruntersuchung (cf. Kittler 2008), in der laienlinguistische Bewertungen der eigenen Sprechweise, aber auch der Sprechweise anderer, erhoben wurden, ergab, dass die Sprechweise italienischer Migranten im Ruhrgebiet häufig als «anders», «steril» oder gar «seltsam» bezeichnet wurde. Auf die Frage, an welchen Stellen innerhalb der Stimuli denn dieser Eindruck entstanden sei, oder welche Merkmale für diesen verantwortlich seien, wurde deutlich, dass die zuvor genannte Andersartigkeit häufig in «la cadenza», «la prosodia», oder «l'intonazione», ferner «la tonalità», «la pronuncia», oder «l'accento» (Kittler 2008) wahrgenommen wurde. Auch berichteten die Italienisch-Sprecher aus dem Ruhrgebiet häufig von Erfahrungen, die sie während ihrer Aufenthalte in der Herkunftsregion gemacht hatten: Verwandte und Freunde nähmen ihre Sprache oft auch als «anders» wahr, was sich nach einigen Tagen vor Ort jedoch legte. Italienische Erasmus-Studenten, die im Wintersemester 2007/2008 gebeten wurden, die Sprache von italienischen Mitstudenten im Ruhrgebiet zu beurteilen, bestätigten diese Wahrnehmung (cf. Kittler 2008).
Den Benennungen der Merkmale nach zu schließen, scheinen es aus laienlinguistischer Sicht somit eher Merkmale segmenteller wie suprasegmenteller Natur zu sein, die in der Sprechweise italienischer Migranten im Ruhrgebiet als «anders» wahrgenommen werden. Dies gilt besonders für Sprachmitschnitte, in denen keinerlei Code-Switchings oder lexikalische Lücken zu Tage treten, da diese sogleich als Shibboleth wahrgenommen werden und so den Blick auf andere mitunter subtilere Ebenen der Sprache verstellen. Auch aus linguistischer Sicht entstand der Höreindruck, dass sich die Sprechweise italienischer Migran-ten vor allem der zweiten Generation mitunter in Prosodie und Lautung von derjenigen in Italien unterscheidet. Bei einigen Sprechern kann, sozusagen in einem Stufenmodell, festgestellt werden, dass sie 1. nicht ständig in Italien leben, 2. im europäischen Ausland leben, 3. in Deutschland leben und 4. die Kontaktsprache, die sie erworben haben, eine Varietät des Ruhrdeutschen ist und sie daher im Ruhrgebiet ansässig sind. Jedoch geht diese Stufenabfolge mit der abnehmenden Genauigkeit der Identifikation der gesprochenen Varietät einher.
Daraus ergibt sich die für die hier durchgeführte Untersuchung leitende Fragestellung, die anhand des zusammengestellten Untersuchungskorpus RuhrCat2 beantwortet werden soll: Welche besonderen Merkmale der Lautung, der Proso-die in Form von Sprechrhythmus und Intonation sowie der Gesprächsgestaltung in Form von Gliederungssignalen, Diskursmarkern, Hesitationsphänomenen und Pausenlängen lassen sich in der Realisierung des Italienischen der Italiener im Ruhrgebiet feststellen oder gar objektivieren? Inwiefern unterscheiden sich diese objektivierten Merkmale von der Realisierung von Italienern ohne Zuwanderungshintergrund aus derselben Herkunftsregion? Weiter wird danach gefragt, ob ein Zusammenhang zwischen den auftretenden Merkmalen und der Aufenthaltsdauer im Ruhrgebiet bzw. der Sprachbiographie des einzelnen Sprechers besteht.
Das folgende Kapitel gibt Aufschluss über die vielfältigen Bedingungsfaktoren für die sprachliche Situation der Italiener im Ruhrgebiet aus kulturell-historischer Sicht, woraufhin die aktuelle Forschungslage der Soziolinguistik und der Migrationslinguistik bezüglich des Italienischen in Situationen der Extraterritorialität vorgestellt wird (Kapitel 3 und 4).
Das Vorgehen bei der Datenerhebung und das Untersuchungsdesign der Studie werden in Kapitel 5 detailliert dargestellt, worauf die Beschreibung der Analysemethoden und Softwareprogramme (Kapitel 6), mit Hilfe derer die gewonnenen Daten ausgewertet wurden, folgt. Teile der 19 in Catania und 15 im Ruhrgebiet durchgeführten Interviews wurden zu einem auf die phonetisch-pro-sodische Analyse zugeschnittenen Untersuchungskorpus zusammengestellt, das mit dem Akronym RuhrCat bezeichnet und in Kapitel 7 detailliert beschrieben wird. Das standardisierte Befragungsverfahren umfasst drei Module:
1.einen soziolinguistischen Fragebogen, der von den Sprechern selbst ausgefüllt wurde und zur Erstellung soziolinguistischer Sprachverwendungs- und Spracherwerbsprofile dient; auf der Basis dieser Sprecherprofile und in Anlehnung an die Kriterien zur Definition verschiedener Migrationsgenerationen nach Backus 1996 konnten im Ruhrgebiet Sprecher aus vier Migrationsgenerationen untersucht werden.3 In Catania wurden Sprecher einer jüngeren Altersgruppe im Alter von 19 bis 33 Jahren und einer älteren Gruppe von 35 bis 84 Jahren befragt.
2. ein leitfadengeführtes Interview, das einerseits zusätzliche Informationen zur Sprachverwendung erheben sollte und andererseits am Ende zwei Erzählfra-gen enthielt (Fragen 17 und 18, cf. Interviewleitfaden, Anhang, 243), die längere Erzählpassagen elizitieren sollten, indem die Sprecher gebeten wurden, etwas über die Heimatstadt zu erzählen und zu berichten, wie man das Finale der Fußballweltmeisterschaft 2006 erlebt hat. Für die phonetisch-prosodische Untersuchung wurden die Antworten auf diese beiden Fragen ausgewählt, zu dem Teilkorpus Intervista_Analyse zusammengestellt, aufbereitet und analysiert.
3. die Nacherzählung einer Bildergeschichte (cf. Anhang, 297), was der bestmöglichen Vergleichbarkeit der Sprechweisen dienen sollte. Die Sprecher im Ruhrgebiet wurden zudem gebeten, die Bildergeschichte nach der Realisierung in italienischer Sprache noch einmal auf Deutsch zu erzählen. Auch diese Sprechproben wurden für die phonetisch-prosodische Untersuchung aufbereitet, zu dem Teilkorpus Storia zusammengestellt und analysiert.
So konnten insgesamt 95 Sprechproben mit einer Gesamtlänge von 1:44 Stunden untersucht und die Sprechweisen der Informanten in Bezug auf ihre Herkunftsregion und zwei unterschiedliche Sprechstile verglichen werden. In Kapitel 7 finden sich sowohl die Sprachverwendungsprofile der 34 Sprecher,4 als auch werden die für die phonetisch-prosodische Analyse relevanten Sprechproben genauer charakterisiert.
In Kapitel 8 werden dann zunächst die für die phonetisch-prosodische Analyse ausgewählten Merkmale und Variablen beschrieben und hinsichtlich ihrer Relevanz diskutiert. Der Bereich der Segmentalia untergliedert sich jeweils in die den Vokalismus und den Konsonantismus betreffenden Merkmale. Im Bereich des Vokalismus werden offenes und geschlossenes E und O in offener und geschlossener Silbe, sowie die Schwaisierung in unbetonten Silben untersucht, während im Konsonantismus die Lenisierung intervokalischer Okklusive, die intervokali-sche Entaffrizierung von /-tʃ-/, die Assimilation von /-st-/ und /-nd-/ und die Aff-rizierung von /-ns-/ untersucht werden. Im Bereich der Suprasegmentalia werden die Sprechproben jeweils der Analyse der Variationen der Grundfrequenz F0, der Dauer von La...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Half Title
- Beihefte zur Zeitschrift
- Title
- Copyright Page
- Meinen Eltern
- Vorwort
- Contents
- Abbildungsverzeichnis
- Transkriptionszeichen
- 1 Einleitung
- 2 Ziele, Aufbau und Gegenstand der Studie
- 3 Italienisch im Ruhrgebiet
- 4 Forschungsstand
- 5 Datenerhebung und Untersuchungsdesign
- 6 Methoden und Analyseprogramme
- 7 Untersuchungskorpus RuhrCat
- 8 Phonetisch-Prosodische Analyse: Auswahl und Beschreibung der relevanten Merkmale und Variablen
- 9 Analyse-Ergebnisse
- 10 Zusammenfassung und Ausblick
- 11 Bibliographie
- 12 Anhang
- Abbildungen und Diagramme