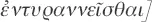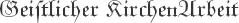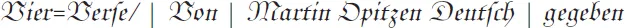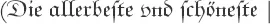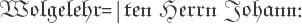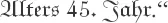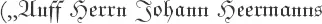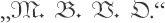![]()
Kommentar
Queis non dehinc
Epigrammartiges Gedicht in Hinkjamben
Dünnhaupt, Nr. 191 A; –
(Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: Ko 137), S. 61. Unsere Ausgabe folgt diesem Druck.
Der kurze, offenbar zu Opitzens Lebzeiten nicht gedruckte Text ist nicht datierbar, könnte aber gut aus den späten Jahren des Dichters in Danzig oder Thorn stammen, als dieser selbst – seit dem Prager Frieden von 1635 – im polnischen Exil lebte; vgl. Seidel (2011). Überliefert sind die Verse in der „12. Anmerckung“ des vierten Teils („Von Reinund Zierlichkeit der Worte“) von Andreas Tschernings poetologisch-sprachkundlichem Hauptwerk, dem 1658 erstmals und ein Jahr später in einer Titelauflage (vgl. Borcherdt, Tscherning, S. 317; Dünnhaupt, Bd. 6, S. 4130f.) wieder gedruckten Unvorgreifflichen Bedencken. Tscherning (1611–1659) war ein Bunzlauer Verwandter Opitzens und hatte nicht nur Gedichte nach dessen Regeln publiziert, sondern unterrichtete auch als Poetikprofessor in Rostock seit 1644 in Opitzens Sinne; zu ihm und seinen Beziehungen zu Opitz vgl. LW 3, S. 597f. Das Unvorgreiffliche Bedencken ist ein Kompendium, dessen Programm auf Vermittlung und Reintegration der allmählich divergierenden poetologischen und sprachpflegerischen Positionen der Opitzianer zielt; vgl. dazu Borcherdt, Tscherning, S. 172–212. In den das Werk konstituierenden „Anmerckungen“ setzt der Verfasser sich mit Detailfragen auseinander, so geht es in der vorliegenden Passage um die Verwendung griechischer Wörter, worüber „so wol H. Opiz als auch H. Buchner in ihren Poëtereyen ausführlich … gehandelt haben“ (S. 60). Tscherning bezieht sich auf die Passage in der Poeterey, wo Opitz die Benutzung fremdsprachlicher Wörter kritisiert und anmerkt, daß „die Lateiner eine solche abschew vor dergleichen getragen / das in jhren versen auch fast kein griechisch wort gefunden wird“ (Poeterey / Jaumann, S. 36; vgl. allerdings bestimmte Lizenzen, z.B. Quintilian, Institutio oratoria 1,5,58: confessis quoque Graecis utimur verbis, ubi nostra desunt). Tscherning zitiert dann – offenbar in Relativierung des Verdikts – „ein kurtzes Epigramma des H. Opizen das sonst vielleicht in niemandes Hand sein möchte/ worinnen er auch gar bequem- und nachdencklich im Lateinischen ein grichisches wort untermenget“ (S. 61). Das die „Anmerckung“ abschließende lateinische Gedicht ist trotz des mit drei Versen ungewöhnlichen Formats wohl als vollständiges Epigramma zu verstehen, dessen Kontext freilich, von der allgemein gehaltenen Exilthematik abgesehen, unbestimmt bleibt. In sprachlicher Hinsicht experimentiert Opitz hier mit den Möglichkeiten der lateinischen Literatursprache; vgl. Cicero, De oratore 3,152 f., zu den drei Arten, wie man mit einfachen Wörtern der Rede Glanz verleihen könne: … aut inusitatum verbum aut novatum aut translatum. Inusitata sunt prisca fere ac vetustate ab usu cotidiani sermonis iam diu intermissa. Hierauf könnte man den Archaismus queis, den griechischen Neologismus und die übertragene Verwendung von sedere beziehen. – Versmaß: Hinkjamben.
1f. Queis non … sedebit … (Et queis sedebit?)] Die auffällige Junktur von unpersönlichem sedere mit Dativ, die archaische Form queis (für quibus) und die variierende Wiederaufnahme des Relativsatzes als Frage geben dem Text ein manieriertes Gepräge.
1
Die Vokabel ist ein von Cicero,
Briefe an Atticus 2,14,1 gebildeter und nur an dieser Stelle nachzuweisender Neologismus:
Ego autem usque eo sum enervatus ut hoc otio quo nunc tabescimus malim εντυαννεισθαι quam cum optima spe dimicare. In dem Brief aus dem Jahr 59 v. Chr. geht es um innenpolitische Spannungen während des Triumvirats zwischen Caesar, Pompeius und Crassus. Ein Bezug zu denkbaren Situationen der 1630er Jahre ist schwerlich herzustellen. Es ist auch keineswegs sicher, dass Opitz die ausgefallene Vokabel aus eigener Cicero-Lektüre kannte. Auch im Briefwechsel zwischen Tscherning und Opitz begegnen übrigens mehrfach seltene Wörter und Junkturen, so etwa ein Zitat aus einem weiteren Atticus-Brief (Conermann/Bollbuck, S. 1275, Anm. 15).
[R.S.]
Libertas animi
Eintrag in ein Stammbuch
Nicht bei Dünnhaupt. – Überliefert in alten Handschriften: STB-PK Berlin: Dep. Breslau 17 (ehemals StB Breslau: Hs. R 402), S. 802, sowie UB Breslau: Akc. 1949/713 (ehemals StB Breslau: Hs. Klose 175). Unsere Wiedergabe erfolgt nach der erstgenannten Abschrift.
Durch den Titel ist das vierzeilige Epigramm als Stammbucheintrag ausgewiesen, Conermann/Bollbuck drucken es allerdings nicht ab. Solange das Album, in dem das Gedicht steht, nicht aufgefunden wird, erübrigen sich Spekulationen über die Zueignung der Verse und den möglichen Kontext. Die auf Opitzens Leitphilosophie, den Neostoizismus, gründende Mahnung könnte an einen jungen Adligen gerichtet sein, der vor dem Mißbrauch kontingenter Güter wie Reichtum und Macht gewarnt wird. Bildlich wird das Ideal stoischer Selbstgenügsamkeit durch den Gegensatz von Freiheit (Libertas … sibi vivit) und Gefangenschaft (subdita claustris … serva) illustriert, vgl. auch die Rahmenstellung von Libertas und serva. Gedanklich folgt der Text u.a. dem fünften und sechsten ‚Paradox‘ der Stoiker; vgl. Cicero, Paradoxa Stoicorum 33: solum sapientem esse liberum, et omnem stultum servum; ebd. 42: solum sapientem esse divitem. – Versmaß: elegische Distichen.
[R.S.]
Dum patriam Musae
Epigramm unter einem Porträt Johannes Heermanns
Dünnhaupt, Nr. 126; – L
ABORUM S
ACRORUM | C
ONTINUATIO |
| 1631. (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: 350.1 Theol. 2°), auf einer Seite im Anschluß an das Titelblatt. Die deutsche und die lateinische Gedichtfassung sind abgedruckt bei Heinrich Schubert: Leben und Schriften Johann Heermanns von Köben. Ein Beitrag zur schlesischen Literaturgeschichte, in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens 19 (1885), S. 182–236, hier S. 215; die Seite ist wiedergegeben bei: John Roger Paas: Effigies et Poesis. An Illustrated Catalogue of Printed Portraits with Laudatory Verse by German Baroque Poets. Bd. 1. Wiesbaden 1988, S. 375. Bernhard Liess beschreibt in: Johann Heermann (1585–1647): Prediger in Schlesien zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Münster 2003 (= Arbeiten zur Historischen und Systematischen Theologie 4), S. 62f., die Seite und gibt die beiden Gedichte wieder. Unsere Ausgabe folgt dem Erstdruck.
Weitere Fassungen dieses Porträts mit Opitzens Versen sind wiedergegeben in: John Roger Paas: Effigies, wie oben, S. 368–384. Diese unterschiedlichen Versionen gehen darauf zurück, daß es zum einen vor dem Abdruck in Heermanns Laborum Sacrorum Continuatio frühere – fehlerhafte – Stadien gab, die dann korrigiert wurden. Zum anderen wurde Heermanns Porträt samt den Gedichten Opitzens auch in anderen Zusammenhängen verwendet; siehe dazu vor allem John Roger Paas: Opitz in Praise of Johannes Heermann: An Example of the Versatility of Portrait Verse, in: Opitz und seine Welt, S. 413–420. Wie aus Paas, Effigies, deutlich wird, enthalten nicht alle Drucke sowohl die lateinischen als auch die deutschen Verse.
Über das Verhältnis des schlesischen Pastors und Dichters Johannes Heermann zu Opitz wie zu anderen literarisch berühmten Leuten seiner Zeit ist kaum etwas bekannt, es läßt sich nur durch die Begleitgedichte zu seinen Werken erschließen; siehe Carl Hitzeroth: Johann Heermann (1585–1647). Ein Beitrag zur Geschichte der geistlichen Lyrik im siebzehnten Jahrhundert. Marburg 1907. Heermann habe aber auch bei ihnen als angesehener Dichter gegolten. Zu bedenken ist vielleicht, dass Opitz seit seinen Studententagen in Heidelberg David von Schweinitz kannte, einen Freund Heermanns und Regierungsrat Herzog Georg Rudolphs in Schlesien zu Liegnitz (s. dazu Conermann/Bollbuck, S. 1190). Zu Heermanns Leben und Werk siehe des Weiteren: Carl Alfred Zell: Untersuchungen zum Problem der geistlichen Barocklyrik mit besonderer Berücksichtigung der Dichtung Johann Heermanns (1585–1647). Heidelberg 1971; Johann Heermann: Sontags- und Fest-Evangelia durchs gantze Jahr auff bekandte Weisen gesetzt. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1636, hrsg. und eingeleitet von Irmgard Scheitler. Frankfurt/Main 1992; Johann Heermann (1585–1647) Zycie i twórczość – Johann Heermann (1585–1647) Leben und Werk. Materiały z sesji naukowej pod redakcja Alojzego Koniora. Leszno 2008.
Heermanns
Labores Sacri wurden zum ersten Mal im Jahre 1624 veröffentlicht. Bei diesem Werk (drei Teile in einem Band) handelt es sich „um seine erste, alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres umfassende Postille“, so Bernhard Liess, wie oben, S. 59. Eine wesentlich erweiterte Fassung der Sammlung mit Sonntagspredigten erschien 1631 mit der vorliegenden
Laborum Sacrorum Continuatio. Der erste Teil des nunmehr zweibändigen
Werkes behandelt die Zeit vom ersten Advent bis zum Sonntag
Exaudi, der zweite die Zeit von Pfingsten bis zum 26. Sonntag nach Trinitatis. Ein dritter Teil folgte 1638/1639 unter dem Titel
Laborum Sacrorum Continuatio Festivalis; s. dazu LW 3, S. 578f. Zu Form und Inhalten von Heermanns Postillen siehe Liess, passim. Paas, Opitz in Praise of Johannes Heermann, S. 417, vermutet, daß Opitz den Auftrag zu den Porträtgedichten direkt von dem Buchdrucker Müller in Breslau erhalten und die Verse wohl nach der Rückkehr von seiner Frankreichreise gegen Ende des Jahres 1630 verfaßt habe. Zur gleichen Zeit müsse Müller auch den bekannten Augsburger Kupferstecher Lukas Kilian (1579–1637) mit Heermanns Porträt beauftragt haben. Eine spätere Verbindung zwischen diesen dreien besteht darin, daß sich in dem umfangreichen Druck, den Heermann zu Ehren des verstorbenen Buchdruckers Müller herausgab
gedruckt 1636 bei Henning Köler in Leipzig), natürlich auch ein deutsches Gedicht Opitzens befindet
fol. G
r – G iij
r).
Das lateinische Gedicht Opitzens unter dem Kupferstichporträt Johannes Heermanns ist auf einer Seite im Anschluß an das Titelblatt des ersten Bandes der
Laborum Sacrorum Continuatio abgedruckt. Über dem von einem Parallelschraffur-Rechteck umgebenen Porträt ist als Überschrift zu lesen:
Heermanni P.L.C. Heermann ist wiedergegeben als Halbfigur nach links. Er legt seine beiden Hände auf eine Brüstung, in die sein Wahlspruch
Mihi Omnia Iesus eingeschrieben ist; seine rechte Hand hält ein Buch. Das Porträt wird umrahmt von einem ovalen Band mit der Inschrift
IOHANNES HEERMANNUS, RAUTENAS SIL. P. L. C. ECCLES. KOEBENIANAE PASTOR: AETAT. XLV. ANN. MDCXXXI. Unter Opitzens Gedicht findet sich links von dessen Unterschrift
Mart. Opitius noch der Vermerk des Stechers
Lucas Kilian sculps: A°. 1631. Während das Porträt und das lateinische Gedicht optisch eine Einheit bilden, ist Opitzens eigene deutsche Übertragung separiert darunter gestellt. Diese deutsche Übersetzung ist abgedruckt in
Deütsche Poemata (1641), S. 668; vgl. Conermann/Bollbuck, S. 1510.
Auf der nächsten Seite folgt ein deutsches Gedicht
das mit
unterzeichnet ist und – berücksichtigt man die Buchstabenumstellung – von „Martin Opitz von Boberfeld“ stammt. In diesem beschreibt der Sprecher, wie die Vorstadt Leipzigs durch den Krieg ein Raub der Flammen geworden sei, ein neu gedrucktes Buch Heermanns den Brand aber unversehrt überstanden habe; siehe auch Liess, wie oben, S. 62f. Heermanns
Labores Sacri erlebten etliche weitere Auflagen (vgl. Dünnhaupt, Bd. 2, S. 2054–2056).
Die drei Gedichte Opitzens finden sich auch in der Ausgabe Lübeck 1636. In Laborum Sacrorum Continuatio Festivalis von 1638 wurden auf der Rückseite des Titelblattes unter dem Porträt Heermanns und dem lateinischen Gedicht Opitzens nicht dessen deutsche Verse, sondern ein Gedicht Colers abgedruckt („Die Lehr vnd LebenßArt den GOttßGelehrten macht | Herr Heermann der hier steht/ hat beydes stets bedacht | Wie Er in Lehr vnd Thun/ ein Werckzeug sey gewesen | Das wird in dieser Schrifft die NachWelt ewig lesen.“). Neu hinzugekommen ist nun ein lateinisches Geleitgedicht Opitzens, das unter die Texte anderer Beiträger eingereiht ist (siehe dazu den Kommentar zu QVos aevi dederas; LW 3, S. 578). Nach Liess, wie oben, S. 64, läßt ein Vergleich der vorangestellten Widmungsverse und Begleitgedichte in den verschiedenen Ausgaben Heermanns zunehmende Beachtung erkennen, da als Beiträger nun weitaus bekanntere und bedeutendere Persönlichkeiten erscheinen.
Des weiteren erfolgte ein Abdruck auf der Rückseite des Titelblattes (nur mit Opitzens lateinischem Gedicht) in einer Ausgabe der Continuatio Festivalis von 1641 (P...