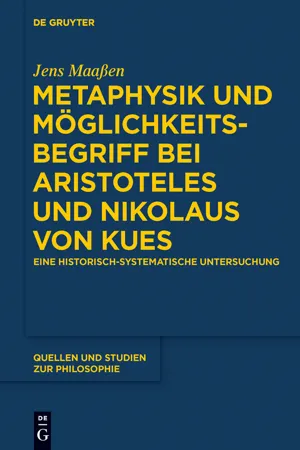![]()
1 Einleitung
„Freilich heißt für den wissenschaftlichen Geist, deutlich eine Grenze zu ziehen, bereits, sie zu überschreiten.“1
„Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müßten wir beide Seiten dieser Grenze denken können (wir müßten also denken können, was sich nicht denken läßt).“2
Metaphysik und Möglichkeitsbegriff sind auf je unterschiedliche Weise zwei Grundbegriffe des philosophischen Denkens. Wie aber hängen diese Grundbegriffe zusammen? Bestimmt die Wirklichkeit des Seienden notwendigerweise das, was es auch sein oder nicht sein könnte? Oder bestimmt umgekehrt das Mögliche das, was wirklich ist? Gibt es überhaupt Dimensionen des Möglichen oder ist alles ausschließlich und notwendig das, was der Fall ist? Ist der Raum des Möglichen größer und mehr zu gewichten, als derjenige des Wirklichen?3
Während die Metaphysik nach Aristoteles’ allgemeiner Bestimmung die ausgezeichnete Wissensdisziplin von den ersten Prinzipen und Ursachen mit dem Anspruch auf Letztbegründung jenseits des Sinnlich-Wahrnehmbaren ist und gerade darum als einzige frei genannt werden muss, weil sie im betrachtenden Wissen – der θεωρία – Erkenntnis um ihrer selbst willen sucht4, hat der Möglichkeitsbegriff eine komplexe Semantik und eine umfangreiche Anwendung in allen Wissengebieten. So sind Möglichkeitsdenken und Möglichkeitsaussagen eine zentrale Bedingung zur Bildung von Hypothesen, für Skepsis an bestehendem Wissen und für neue Theorien. Schon allein unsere Alltagssprache bezeugt die zentrale Bedeutung dieses Terminus als Ausdruck einer „reflektierende[n] Sprachschicht“5, wenn wir von dem sprechen, was sein kann bzw. möglich ist, ob etwas gemäß seiner Disposition z.B. essbar, reparierbar oder fassbar ist, und wenn wir fragen, was getan oder erkannt werden kann.
Insbesondere die Philosophie ist auf die Möglichkeitssemantik angewiesen, wenn sie im Kontext ihrer Argumentationen Gedankenexperimente über mögliche Sachverhalte oder Theorien entwickelt und bei ihrer Kritik prinzipiell von der Möglichkeit anderer Begründungen, besserer Argumente oder zutreffender Begriffe ausgeht. Die Geschichte der Philosophie zeigt dort, wo es um das gedanklich und begrifflich Mögliche geht, wie bestehende Probleme und Lösungen, Fragen und Antworten modifiziert oder bezweifelt und verändert oder gar neu formuliert werden. Folgt man einem solchen Philosophieverständnis, so ist Philosophie gleichsam der ausgezeichnete gedankliche Raum, in dem die Möglichkeiten des Denkens und das Denken der Möglichkeit aufeinander verweisen. In diesem Raum werden Begründungsansprüche und deren Infragestellungen zu wesentlichen Aufgaben des Philosophierens: Ist es möglich, dass etwas ist oder nicht ist? Können wir das Wesen der Dinge erkennen oder nicht? Ist es möglich, dass wir Wissen von einer extramentalen Welt haben oder nicht? Können wir uns frei entscheiden oder nicht? Kann es einen Gott geben und wie können wir ihn erkennen? Was können wir überhaupt erkennen oder denken?
Vor allem metaphysische Aussagen sind aufgrund ihrer besonderen Wissensinhalte Gegenstand der Auseinandersetzungen. Denn erste Prinzipien und Ursachen sind per definitionem nicht zufällig oder subjektiv, sondern notwendig und uneingeschränkt gültig bzw. wirksam. Sie sind die Fixsterne, die den Horizont des Möglichen erleuchten und auf die hin das, was der Fall sein kann, geordnet ist. Anders formuliert: Prinzipientheoretische Aussagen beanspruchen mit Notwendigkeit eine Erst- bzw. Letztbestimmung, die an und für sich absolut, mithin unbedingt ist und alles andere strukturiert. Bemerkenswerterweise sind derart ausgezeichnete Prinzipien nicht nur an die Unterscheidung zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit gekoppelt, sondern auf die Semantik des Möglichkeitsbegriffs für die zu konstituierende Ordnung angewiesen. An diesen Zusammenhang von Ordnung und Möglichkeit für die Metaphysik richtet sich die vorliegende Arbeit aus.
1.1 Zur Fragstellung und Methode der Untersuchung
Das Untersuchungsinteresse geht von der Annahme aus, dass ohne den modalen Begriff der Möglichkeit Theoriebildung überhaupt und insbesondere Metaphysik nicht möglich ist. Hans Poser ist dieser Annahme bereits im Anschluss an ältere Forschungsliteratur nachgegangen und auch jüngere Arbeiten bestätigen, dass der Möglichkeitsbegriff für die verschiedenen (nicht) metaphysischen Systeme letztlich unverzichtbar ist.6 Im Anschluss an diese Ergebnisse lässt sich die Leitfrage der Untersuchung zu den zwei ausgewählten Metaphysiken des Aristoteles und des Nikolaus von Kues wie folgt formulieren: Wie sehen die Beziehungen zwischen dem oder den ersten Prinzipien oder Ursachen und dem Möglichkeitsbegriff in diesen unterschiedlichen Philosophien aus? Die Beantwortung dieser Frage ist an der impliziten und expliziten argumentativen Funktion des Begriffs für die Theoriebildung interessiert; insofern kann die Frage auch anders formuliert werden: Inwieweit kann die komplexe Semantik des Möglichkeitsbegriffs für die jeweilige prinzipientheoretische Ebene der Metaphysiken nachgezeichnet werden?
Ein zentrales Vorhaben der Arbeit liegt mithin in der Klärung der Verwendung des Begriffs ,Möglichkeit‘ innerhalb der konkreten Argumentationen und Konzeptionen. Dabei ist zu beachten, dass der Terminus in unterschiedlichen Erklä-rungszusammenhängen steht und seine Semantik unterschiedlich weit oder eng gefasst wird. Diese Bedingung schließt in methodischer Hinsicht eine rein abstrakte bzw. formale Bedeutungsreduktion, wie sie etwa eine modallogische Darstellung zum Ziel hätte, aus und fordert stattdessen eine Rekonstruktion der jeweiligen Kontexte in Form einer genauen Textanalyse, die mit unterschiedlicher Gewichtung in die Bereiche der Ontologie, der Theorie des Geistes, der Bedeutungs- und Erkenntnistheorie führt. Eine umfassende Darstellung der aristotelischen und cusanischen Philosophie ist allerdings nicht das Ziel der Arbeit. Es geht um den Nachweis der konstitutiven Funktion des Begriffs in verschiedenen Theorieelementen. Von besonderem Interesse ist hierbei die implizite Verwendung, bei der die Möglichkeitssemantik gleichsam im Hintergrund wirksam ist. An diesen Stellen ist es die Aufgabe der Interpretation, den versteckten, in der Verwendung liegenden philosophischen Gehalt des Möglichkeitsbegriffs – sein theoretisches Potential – offen zu legen und in die jeweilige Metaphysik einzuordnen.
Maßgeblich für die Untersuchung ist die bereits oben skizzierte und jede Metaphysik bestimmende Grundkonzeption, sowohl Letztbegründung im Sinn des Absoluten als auch Erklärung der Welt zu sein, wodurch die Erfahrung divergierender Vielheiten nicht ignoriert wird. ,Welt‘ bedeutet hier alles, was der Fall ist oder sein kann. Der Begriff des Absoluten wird von mir in der Bedeutung von ,voraussetzungslos‘ oder ,unbedingt‘ verwendet; gemeint ist also ein für sich selbst voraussetzungsloses Prinzip oder voraussetzungsloser Grund, der alles andere prinzipiiert bzw. begründet und anderes in seiner Unterschiedenheit existent sein lässt. Ob das Absolute als Vielheit oder als Einheit konzipiert ist, ob es allem anderen immanent oder transzendent ist, bleibt fürs Erste offen. Wichtig ist zunächst die formale Kennzeichnung der Voraussetzungslosigkeit, Superiorität und Notwendigkeit.
Indem die Metaphysik eine Theorie vom Absoluten und von der Weltwirklichkeit sein will, formuliert sie einen umfassenden Rationalitätsanspruch. Hierbei hat sie ihren primären Gegenstand jenseits phänomenaler Faktizität, um diese auf die zugrunde liegende nicht-phänomenale Ordnungsstruktur zurückzuführen. Das, was der Fall ist, wird nicht geleugnet, sondern von seinen grundlegenden nicht-empirischen Voraussetzungen her gedacht. In Bezug auf diese Erklärungsabsicht ist die Leitfrage der Untersuchung nach der Funktion des Möglichkeitsbegriffs an die Frage nach der Realisierung des Rationalitätsanspruchs gekoppelt: Zu welchen Problemlösungen und damit zu welchen Konzeptionen des Absoluten und der Weltwirklichkeit trägt die Möglichkeitssemantik bei? Für Aristoteles will die vorliegende Untersuchung die philosophische Bedeutung des Möglichkeitsbegriffs in dem Zusammenhang von Ontologie – Semantik – Denken weiterführend erschließen, wobei zu zeigen sein wird, inwiefern die Grundrelation zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit eine eigene strukturelle Problematik erzeugt. Gleiches gilt für die Position des Cusanus. Allerdings muss bei ihm die Trias um die besondere Position des göttlichen Absoluten, für dessen Benennung der Möglichkeitsbegriff in anderer Weise in Anspruch genommen wird, erweitert werden.
Das historische Interesse an zwei Vertretern der abendländischen Metaphysik ist verbunden mit dem systematischen Interesse an Theoriebildung und an dem, was innerhalb der Philosophie den Raum des Möglichen ausmacht, ihn erweitert und begrenzt. Dabei ist die Wahl für Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) und Nikolaus von Kues (1401–1464), zwei auf den ersten Blick weit auseinander liegende Denker, eine von vielen möglichen, aber keine beliebige. Gemessen an der Fragestellung der Arbeit könnte jede Philosophie oder Theorie in den Blick genommen werden, die, wenn nicht auf ihre metaphysischen Bedingungen, so doch immer auf ihren implizit oder explizit verwendeten Möglichkeitsbegriff befragt werden kann. Allerdings haben die hier ausgewählten Positionen des Aristoteles und des Nikolaus von Kues exemplarischen Charakter für die Geschichte der Metaphysik, insofern sie, wie die Analysen zu zeigen haben, in unterschiedlicher Weise philosophie-historisch entscheidende Neuerungen und Veränderungen markieren, die sich über die jeweiligen Verwendungen des Möglichkeitsbegriffs nachzeichnen lassen.
Um in einem ersten Zugang den Unterschied zwischen beiden Positionen zu veranschaulichen, bietet es sich an, auf je eine ausgewählte Metapher der Selbstbeschreibung, die beide Denker in ihren Texten gebrauchen, einzugehen: Aristoteles können wir, wie es zu Beginn von Buch B der Metaphysik heißt, als „Wanderer“ charakterisieren, der Ziel und Weg seines wissenschaftlichen Vorhabens genau kennt. Seine Wanderung führt ihn vom anfänglichen „Staunen“ über das nächstliegende Unerklärte zur sicheren Erkenntnis dessen, was unveränderlich und um seiner selbst willen gewusst wird.7 Dank seiner exakten Fragestellung generiert er die zielführenden Wegmarken – seine philosophischen Aporien – und löst den „Knoten“, der den Fragenden ansonsten nicht fortkommen ließe. Das Bild des Wanderers charakterisiert Aristoteles als einen Denker, der systematisch sein Ziel verfolgt und es auf sicherem Weg zu erreichen beabsichtigt.
Cusanus hingegen beschreibt sein Philosophieren als „Jagd nach der Weisheit“.8 Er ist ein Jäger, der zwar seine Beute kennt, ihrer aber nicht endgültig habhaft wird, sie nicht erlegt. Für ihn gibt es nicht nur immer weitere Jagden, sondern auch verschiedene Jagdgründe – insgesamt zehn -, in denen die Weisheit zu suchen ist. Was in Aristoteles’ Metaphysik durch den umfangreichen Fragekatalog abgesichert und eingegrenzt wird, entwickelt sich bei Cusanus zu einem in sich differenzierten Forschungsprojekt über das adäquate Wissen vom göttlichen Absoluten; ein Projekt, das in immer neuen Versuchen sein Scheitern reflektiert. Der durch den christlichen Glaubenskontext motivierte Denker ist nicht weniger zielorientiert als sein antiker Vorgänger, aber sein besonderer Wissensgegenstand ist gemäß der Metaphorik der Jagd ein sich entziehender, ohne je ganz abwesend zu sein. Wo Aristoteles einer klaren Wanderroute folgt, muss sich Cusanus auf die Unwägbarkeiten bzw. besonderen Paradoxien seiner Jagd einstellen. Während der erste trotz aller Schwierigkeiten seiner Planung folgen kann, muss der zweite immer neue Strategien der Verfolgung entwickeln.
Die Anschaulichkeit von Wanderung und Jagd markiert in nuce die Verschiedenheit beider Metaphysiken. Der Wanderer muss die richtigen Wegmarken kennen; der Jäger muss mit immer neuen Begriffen das Sich-Entziehende zu fangen versuchen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die historisch-systematische Fragestellung der vorliegenden Untersuchung noch einmal an Kontur. Denn, um im Bild zu bleiben, worin unterscheiden sich die Möglichkeiten des Wanderers von denen des Jägers, und worin sind sie sich ähnlich oder gleich? Meine Leitthese lautet: Weder die aristotelische Metaphysik der Substanz noch die cusanische des Unendlichen kommt ohne eine starke Möglichkeitssemantik aus.Was genauer mit dem Ausdruck ,stark‘ gemeint ist, haben die Analysen im Einzelnen zu zeigen.
Aristoteles ist nicht der erste Philosoph, der den Terminus ,Möglichkeit‘ in seiner Philosophie verwendet, aber er ist der erste, der die differenzierte Bedeutung des Begriffs systematisch für seine unterschiedlichen philosophischen Konzeptionen nutzt.9 Hierin ist zweifellos seine originäre Leistung zu sehen. Seine Anwendungen der Begriffssemantik für die Bereiche der Logik, der Aussageweisen und der Metaphysik ist bis heute fundamental und bildet die Folie, auf der die meisten weiteren Reflexionen eingeschrieben werden. Die aristotelische Position bildet gleichsam die historisch-systematische Ausgangsbedingung, die bei einer Untersuchung zu dem Verhältnis zwischen Metaphysik und Möglichkeit nicht ausgeblendet werden kann. Zudem sind in wirkungs- und problemgeschichtlicher Hinsicht zentrale Theoreme, wie das Nichtwiderspruchsprinzip, die Substanzoder die Satzkonzeption, von grundlegender Bedeutung. Dies gilt insbesondere mit Blick auf Nikolaus von Kues, der die Theoreme des antiken Philosophen kri-tisch rezipiert und transformiert.
Die philosophiehistorische Stellung des Denkers aus dem 15. Jahrhundert wurde in dem besonderen Verhältnis zur Problematik der spätmittelalterlichen Theologie, die Trias ,Gott – Mensch – Welt‘ in einer konsistenten Einheit zu den-ken, gesehen. Diese Einschätzung ist richtig, wenn man nicht ausschließt, dass Aspekte seiner Philosophie über die historische Einordnung zu einer „Epochenschwelle“ hinausweisen können.10 Die Diskursbedingungen des Christentums trennen die Metaphysik des Cusanus mindestens in einem Punkt grundsätzlich von der des Aristoteles. Cusanus geht es im Kern seiner überlegungen um die philosophische Möglichkeit oder Ermöglichung der Erkenntnis Gottes als Unendlichkeit oder unendlicher Einheit (infinitum/unum). Dabei dokumentieren insbesondere seine späten Werke, wie die Möglichkeitssemantik in der Bedeutung von Können (posse) eine zentrale Stellung gewinnt und zu einer eigenen Spekulation über die Möglichkeit führt. Alfons Brüntrup hat für diese Entwicklung den zutreffenden Begriff der „posse-Metaphysik“11 geprägt, den auch ich für meine Untersuchung als Interpretament übernehme. Allerdings ist der Ausdruck ,posse‘ im gesamten Werk bis hin zu den Gottesnamen ,possest‘ (Können-Ist) und ,posse ipsum‘ (Können selbst) nachweisbar und macht, wie in Ergänzung zu Brüntrup zu zeigen sein wird, die eminente Stellung des Möglichkeitssemantik auch schon vor dem Spätwerk greifbar.
Während also Cusanus fragt, wie wir überhaupt Wissen von Gott als unendlicher Einheit haben können und dieses Wissen sprachlich fassen müssen, geht es Aristoteles um die Frage, was das Seiende als Seiendes, was die Substanz (oüma) ist. Die epistemologischen und methodischen Schwierigkeiten, wie sie die spätmittelalterliche Metaphysik mit der Gotteserkenntnis zu bewältigen hat, stellen sich für den antiken Philosophen nicht. Andererseits besteht gerade über den Substanzbegriff eine enge konzeptionelle Verbindung zu Cusanus, der in diesem zentralen Terminus eine notwendige, aber zu kritisierende Voraussetzung für seinen eigenen Ansatz sieht. Im Horizont der vorliegenden Untersuchung lassen sich die zentralen Fragen der beiden Metaphysiken präzise formulieren: Wie ist es möglich, dass etwas überhaupt als Eines in seiner Veränderung besteht (persistiert) und wir wahrheitsfähige Sätze darüber bilden können? Wie ist es möglich, dass im Unendlichen Endliches existiert und Endliches Unendliches erkennen oder benennen kann?
Die hier skizzierten Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen beiden Positionen markieren in einem ersten Zugang, in welchem Spannungsfeld sich die Arbeit bewegt und in welchen philosophischen Theoremen die Möglichkeitssemantik Bedeutung haben wird.
1.2 Hinweise zur Interpretation und Gliederung
Da der Möglichkeitsbegriff zu den fundamentalen Termini der Philosophie und auch des Alltagsdenkens gehört, ist eine Untersuchung über ihn nicht möglich, ohne ihn zugleich vorauszusetzen und eigens anzuwenden. Bestimmte Begriffe können erst im Verlauf einer Darstellung an Bedeutung und Klarheit gewinnen, sie werden hermeneutisch gebraucht und ihr Gehalt erst durch die Untersuchung erschlossen. Zu diesen Ausdrücken zählen hier neben dem der Möglichkeit auch der der Substanz, der Begriff Gottes oder der des Unendlichen; sie werden zunächst vorausgesetzt. Es ist daher auch nicht Absicht der vorliegenden Arbeit, die oben angegebene Bedeutung von Möglichkeit als Modalbegriff und im Sinn der Strukturunterscheidung den relevanten Begriffsverwendungen und überlegungen in den Texten einfach zuzuweisen. Dieses Vorgehen bliebe relativ abstrakt und verfehlte das Besondere der jeweiligen Aussagen sowie ihrer Zusammenhänge. Stattdessen wird die Arbeit die metaphysischen Positionen Schritt für Schritt in ihren Argumentationsverläufen rekonstruieren. Sollte es hierbei zu eventuellen Redundan...