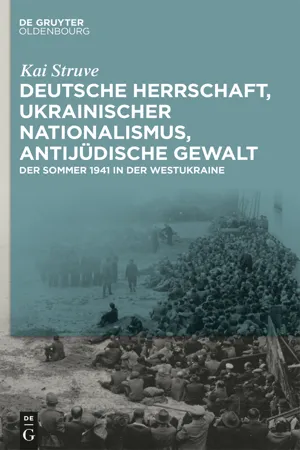![]()
1 Einleitung
In den ersten Tagen und Wochen nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 traf die Juden in den neu besetzten Gebieten eine Welle von Gewalt. Sie ging von den deutschen Polizei-, SS- und Wehrmachtseineiten, aber auch von einheimischen Aufständischen und Zivilisten aus. Auf deutscher Seite setzte mit dem Angriff auf die Sowjetunion eine weitere Eskalation der Verfolgung der Juden ein, die bald zum Versuch der vollständigen Ermordung der gesamten jüdischen Bevölkerung wurde – zunächst in den neu besetzten Gebieten in der Sowjetunion und anschließend in weiteren Teilen des deutsch beherrschten Europas.
Die folgende Studie fragt nach den Gründen der Gewalt durch Einwohner der neu besetzten Gebiete und ihren Zusammenhang mit den deutschen Gewalttaten. Gewalttaten von einheimischer Seite gab es in großer Zahl nur in denjenigen Gebieten zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, die auf der Grundlage des Hitler-Stalin-Pakts im September 1939 und im Juni 1940 von der Sowjetunion besetzt worden waren. Die folgende Untersuchung behandelt darunter das mehrheitlich ukrainische Ostgalizien, das nach der sowjetischen Besetzung Ostpolens im September 1939 zusammen mit dem nördlich angrenzenden Wolhynien als „Westukraine“ der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik angeschlossen wurde.1
Die Studie greift damit eine Frage auf, die infolge von Jan Tomasz Gross’ Buch über den Pogrom in der polnischen Kleinstadt Jedwabne und der heftigen Auseinandersetzung darüber in der polnischen Öffentlichkeit auch in der internationalen Forschung mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat.2 Anders als im polnischen Fall war allerdings für die übrigen von der Sowjetunion 1939 und 1940 besetzten Gebiete schon lange bekannt, dass es hier Pogrome gegen Juden von Seiten der einheimischen Bevölkerung während der ersten Tage nach dem deutschen Einmarsch im Sommer 1941 gegeben hatte, auch wenn das Ausmaß und die Zusammenhänge umstritten waren und weiterhin sind.
Massenerschießungen durch deutsche Polizeikräfte und Gewalttaten durch einheimische Kräfte waren allerdings nicht die einzigen Verbrechen, die in den Tagen nach dem deutschen Angriff in dieser Region stattfanden. Zwischen dem 22. Juni und den ersten Julitagen ermordeten die Wachmannschaften und andere NKVDKräfte mehrere tausend Insassen sowjetischer Gefängnisse in den grenznahen Gebieten. In Ostgalizien und Wolhynien handelte es sich größtenteils um Ukrainer, einen beträchtlichen Anteil an den ermordeten Gefängnisinsassen hatten aber auch Polen und Juden. Gleichwohl standen die antijüdischen Gewalttaten an vielen Orten in einem engen Zusammenhang mit dem sowjetischen Massenmord an den Gefängnisinsassen, da Juden als vorrangige Träger und Nutznießer der sowjetischen Herrschaft in den vorhergehenden 21 Monaten und damit auch als mitschuldig an den sowjetischen Verbrechen angesehen wurden.
Ein weiterer Kontext der antijüdischen Gewalttaten in den ukrainischen Gebieten bestand darin, dass in der gleichen Zeit der von Stepan Bandera geführte Teil der „Organisation ukrainischer Nationalisten“ (Orhanizacija Ukraïns’kych Nacionalistiv, OUN) versuchte, einen selbstständigen ukrainischen Staat in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten mit ukrainischer Bevölkerung zu errichten. Gewalttaten in diesem Zusammenhang trafen allerdings nicht nur Juden, sondern auch Polen und prosowjetische Ukrainer, jedoch in einem beträchtlich geringeren Ausmaß.
Der neue Krieg, der Wechsel der Herrschaft von den Sowjets zu den Deutschen, die Konfrontation mit den sowjetischen Verbrechen und mit den grauenhaften Bildern, die sich in den Gefängnissen boten, aber auch die Erwartung, dass das zentrale Ziel der ukrainischen Nationalbewegung, ein ukrainischer Nationalstaat, nun verwirklicht werden könnte, schufen besonders für die ukrainische Bevölkerung in den ersten Tagen des Krieges einen emotionalen Ausnahmezustand, der Exzesstaten begünstigte. Exzesstaten gab es jedoch nicht nur auf einheimischer, sondern, wie noch zu zeigen sein wird, auch auf deutscher Seite. Tatsächlich waren die Pogrome – und dies ist in der Forschung bisher nur wenig beachtet worden – mit den meisten Todesopfer in Ostgalizien in erster Linie Gewaltexzesse von Teilen der Waffen-SS-Division „Wiking“, die mit der Panzergruppe 1 und damit als eine der Wehrmacht unterstellte Kampftruppe durch das nördliche Galizien kam.
Die Gewalttaten gegen Juden von ukrainischer Seite sind hoch umstritten. Wie unten ausführlicher dargelegt wird, bestehen die kontroversen Fragen dabei vor allem im Ausmaß der Gewalt, in der Rolle der OUN und ihrer Zusammenarbeit mit den Deutschen und nicht zuletzt auch in der Frage, inwieweit es eine zentrale Planung und Vorbereitung der Gewalt auf ukrainischer Seite gab – eigenständig oder in Absprache mit deutschen Stellen. Die Auseinandersetzung darum wird nicht selten mit großem emotionalem Engagement ausgetragen. Dies geht auf die Gedächtnisgeschichte der Geschehnisse des Sommers 1941 zurück.
Bilder von Pogromszenen in Lemberg am 1. Juli 1941 sind zu globalen Ikonen des Holocaust geworden. Im Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz überlieferte, von deutschen Kriegsberichterstattern aufgenommene Fotografien bedrohter, misshandelter Frauen, denen ihre Kleider ganz oder teilweise entrissen wurden, sind seit der ersten Veröffentlichung von zwei Aufnahmen aus dieser Serie in Gerhard Schoenberners Der gelbe Stern im Jahr 1960 zu Bildern von Opfern des Holocaust schlechthin geworden (Abb. 1). Seitdem wurden sie in zahlreichen weiteren Publikationen zur Bebilderung der Geschichte des Holocaust, des Zweiten Weltkriegs und manchmal auch anderer Geschichten benutzt.3
Abb. 1: Lemberg, 1. Juli 1941
Diese Bilddokumente und ihr ikonischer Status mögen dazu beigetragen haben, dass dem Pogrom in Lemberg in der Literatur häufig ein überhöhtes Ausmaß mit vielen tausend Todesopfern zugeschrieben wird. Tatsächlich dürfte es in Lemberg am 1. Juli 1941 einige hundert Tote gegeben haben.4
Zu den Faktoren, warum die Diskussion über die ukrainische Beteiligung an antijüdischen Gewalttaten mit großen Emotionen verbunden ist, gehört aber auch, dass an den anderen Massenmord in diesen Tagen, nämlich das sowjetische Massaker an den Gefängnisinsassen, bis zum Ende der Sowjetunion in der Westukraine nicht öffentlich erinnert werden konnte. Dieser Massenmord wurde gleichwohl nicht vergessen und die Erinnerung an dieses Verbrechen, das die westukrainische Bevölkerung im Jahr 1941 stark erschüttert hatte, trat in den 1990er Jahren wieder mit neuer Wucht hervor. In Zeitungen und Zeitschriften erschienen zahlreiche Artikel darüber und eine Reihe von Massengräbern mit Opfern dieses Verbrechens wurden mit großer öffentlicher Anteilnahme geöffnet. Das sowjetische Massaker des Jahres 1941 wurde damit zu einem zentralen Symbol des Leidens der Westukraine unter der sowjetischen Herrschaft. Nun erschienen auch erste wissenschaftliche Veröffentlichungen über die sowjetischen Verbrechen, nachdem vorher nur in der ukrainischen Diaspora dazu publiziert werden konnte. In die Publizistik und in den nach sechs Jahrzehnten oder mehr veröffentlichten Erinnerungen von Zeugen der Verbrechen fanden dabei häufig auch übertriebene Darstellungen Eingang. Dazu gehört, dass Beschreibungen sowjetischer Grausamkeiten bei der Ermordung der Gefangenen, die 1941 schon in großer Zahl kursiert waren, unkritisch übernommen wurden.5
Zu den Gründen dafür, dass die Frage der antijüdischen Gewalttaten von ukrainischer Seite und insbesondere durch den von Stepan Bandera geführten „revolutionären“ Teil der OUN, der meist als OUN-B bezeichnet wird, so umstritten ist, gehört aber auch die sowjetische Propaganda gegen den ukrainischen Nationalismus. Die von der Bandera-OUN ins Leben gerufene Ukraïns’ka Povstans’ka Armija (Ukrainische Aufstandsarmee, UPA) hatten nach der erneuten sowjetischen Besetzung der Westukraine 1944 ihren Kampf für einen ukrainischen Staat noch bis in die 1950er Jahre fortgesetzt. Dieser Krieg und damit einhergehende massenhafte sowjetische Repressionen – dazu gehörte die Deportation von ungefähr einer halben Million Westukrainern in sowjetische Lager – trafen die ukrainische Bevölkerung in Ostgalizien beträchtlich stärker als die deutsche Herrschaft bis 1944.6 Das zentrale Thema der sowjetischen Propaganda, die diesen Krieg begleitete, bestand darin, die OUN und die UPA mit den deutschen „Faschisten“ und ihrer brutalen Herrschaft in der Ukraine gleichzusetzen. Sie erschienen hier als Handlanger und Henkersknechte der Deutschen. Kennzeichnend für die sowjetische Propaganda und Publizistik in diesen Jahren und auch in den folgenden Jahrzehnten war zum einen, dass sie den Bruch zwischen der OUN-B und den Deutschen im Sommer und Herbst 1941 ignorierte. Zum anderen verwischte sie die politischen Unterschiede unter den Ukrainern. Einerseits dienten die faschistischen Züge der OUN dazu, den ukrainischen Nationalismus insgesamt mit dem Faschismusvorwurf zu belegen. Andererseits tendierte sie dazu, die Beteiligung von Ukrainern an Verbrechen unter deutscher Herrschaft in einer generalisierenden Weise dem ukrainischen Nationalismus und insbesondere der Bandera-OUN zuzuschreiben. Vor allem aber war kennzeichnend, dass sowjetische Publikationen Verbrechen der OUN-B gegen Juden und teilweise auch gegen Polen lange Zeit nicht als solche thematisierten, sondern in erster Linie darauf zielten, die OUN-B und die ukrainischen Nationalisten mit Verbrechen gegen Ukrainer und gegen die Sowjetunion zu belasten.7 In diesem sowjetischen Diskurs ging es nicht um historische Aufklärung, sondern darum, ein Feindbild zu schaffen, mit dem die ukrainischen Selbstständigkeitsbestrebungen bekämpft werden konnten. Dieses Feindbild wirkt in Russland und den östlichen Teilen der Ukraine, aber auch in der internationalen Öffentlichkeit noch bis in die Gegenwart nach.8 Während in der Sowjetunion mit dem Faschismusbegriff die Unterstützung der radikalen ukrainischen Nationalisten für den deutschen Angriff am 22. Juni 1941 und für die Unterdrückung und Ausbeutung der Ukrainer unter deutscher Herrschaft herausgestellt wurde, verband sich dieser sowjetische Faschismusdiskurs in der internationalen Öffentlichkeit mit dem Vorwurf an die OUN, den deutschen Massenmord an den Juden unterstützt zu haben und für Pogrome in den ersten Tagen nach dem deutschen Einmarsch verantwortlich zu sein. Von besonderer Bedeutung war hier die Kampagne gegen Theodor Oberländer in den Jahren 1959/60, die eine breite internationale Resonanz hatte.9
Die propagandistische Instrumentalisierung und gezielte Verfälschung vieler Tatsachen vor dem Hintergrund der brutalen Unterdrückung des ukrainischen Widerstandskampfes in der Westukraine trug dazu bei, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage von Verbrechen von OUN und UPA in der ukrainischen Emigration nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit ausblieb und dass sie auch in der Ukraine seit 1991 bisher nur ansatzweise stattgefunden hat. In sowjetischer Zeit war die Bewahrung einer positiven Erinnerung an den Widerstandskampf der UPA und damit auch an die OUN nach dem sowjetischen militärischen Sieg über die UPA ein Akt des fortgesetzten Widerstands gewesen. Kritische Thesen zur Geschichte der OUN und der UPA wegen ihrer Nähe zum Faschismus, der Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Deutschland und ihrer Verbrechen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs erschienen vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen als Fortsetzung der sowjetischen Propaganda. In der unabhängigen Ukraine blieb die Öffentlichkeit weiterhin in hohem Maße entlang der bestehenden Konfliktlinien gespalten: Auf der einen Seite stand die unkritische Heroisierung der Bandera-OUN und der UPA und auf der anderen Seite das in der sowjetischen Zeit geprägten Bild als vom nationalsozialistischen Deutschland geschaffene und gelenkte Organisationen, die der verbrecherischen deutschen Herrschaft in der Ukraine dienten.10
Vor dem Hintergrund der sehr gegensätzlichen Deutungen dessen, was im Sommer 1941 geschah, steht im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung eine mikrogeschichtliche, beinahe kriminalistische Rekonstruktion von Vorbereitungen, Motiven und Tatabläufen sowie von Tätergruppen, Opfern und Opferzahlen. Im ersten Teil der Studie wird dabei das Verhältnis zwischen den Deutschen und den verschiedenen ukrainischen Akteuren vor dem 22. Juni 1941 und ihre jeweiligen Planungen und Vorbereitungen für den Krieg untersucht. Dieser Teil behandelt auch Gewalttaten während des Septembers 1939. Damit wird ein Vergleich der Geschehnisse des Sommers 1941 mit einem anderen Fall von Gruppengewalt während eines Herrschaftswechsels ermöglicht. Im Hauptteil der Studie wird dann die Frage von Gewalttaten für mehr als dreißig größere und mittlere Städte sowie für eine Reihe von Dörfern in den ersten Wochen nach dem deutschen Angriff am 22. Juni 1941 behandelt.
Forschungsgeschichte
Die in der Studie untersuchten Gewaltereignisse sind mit einer Reihe von Forschungskontexten verbunden. Dazu gehören die Holocaust-Forschung, Forschungen zur Wehrmacht im „Vernichtungskrieg“, aber auch zur Haltung der einheimischen, nichtjüdischen Bevölkerung gegenüber der deutschen Okkupation und ihrer Rolle beim Mord an den Juden. Relevant sind aber auch Forschungen über den radikalen ukrainischen Nationalismus, insbesondere über die OUN, die deutsch-ukrainischen Beziehungen vor und während des Zweiten Weltkriegs sowie zur sowjetischen Herrschaft in den Jahren 1939–41 und den sowjetischen Verbrechen im Sommer 1941.
In der Holocaust-Forschung sind im Zusammenhang mit den seit den 1980er Jahren geführten Diskussionen zur Entschlussbildung über die Ermordung der gesamten jüdischen Bevölkerung im deutschen Machtbereich die Phase vom Beginn des deutschsowjetischen Krieges 1941 bis zur Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 genau erforscht und die Abläufe, soweit aufgrund der vorhandenen Quellen möglich, detailliert rekonstruiert worden. Diese Phase bildete eine weitere Eskalationsstufe nach dem Angriff auf Polen am 1. September 1939 im Übergang von Verdrängung und Vertreibung der Juden zum Genozid.11
Zu den zentralen, mittlerweile allgemein geteilten Ergebnissen dieser Diskussion gehört es, dass die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD sowie andere an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung beteiligte SS- und Polizeieinheiten vor dem Angriff auf die Sowjetunio...