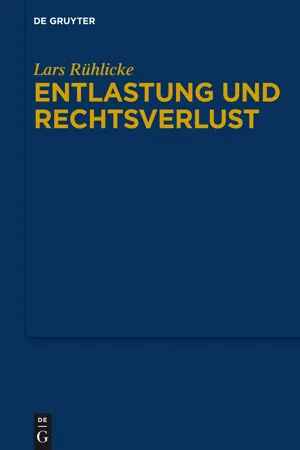
- 373 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Entlastung und Rechtsverlust
Über dieses Buch
Die Durchsetzung von Ersatzansprüchen gegenüber Vorständen, Aufsichtsräten und Geschäftsführern begegnet vielfältigen Problemen. Sie entstehen, wenn die Gesellschafter den Organmitgliedern zunächst vorbehaltlos "Entlastung" erteilen und erst im Nachhinein von Verfehlungen erfahren. Die Arbeit geht der Frage nach, in welchen Fällen die Entlastung zum Verlust von Ersatzansprüchen führt und die Haftung der Organmitglieder ausschließt.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Entlastung und Rechtsverlust von Lars Rühlicke im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Gesellschaftsrecht. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
_____
1. Teil: Die Grundlagen der Untersuchung
§ 1 Die funktionelle Identität der bürgerlich-rechtlichen und der gesellschaftsrechtlichen Entlastung
Die Untersuchung der dogmatischen Konstruktion der Entlastungsfolgen setzt zunächst voraus, dass Klarheit über den Untersuchungsgegenstand besteht. Hierfür ist eine umfassende Analyse der Interessenlage der Beteiligten und der zugrunde liegenden gesetzlichen Wertungen erforderlich. Denn dogmatische Konstruktionsfragen stellen keinen Selbstzweck dar.8 Sie dienen dazu, die in Ansehung der gesetzlichen Wertungen schutzwürdigen Belange der Beteiligten zur Geltung zu bringen. Zudem entspricht die hier zugrunde gelegte Einordnung der Entlastung als allgemeines Institut der Geschäftsbesorgung längst nicht dem gesicherten Rechtsbestand. Im Gegenteil wird im Gesellschaftsrecht einhellig vertreten, dass die Entlastung ein besonderes gesellschaftsrechtliches,9 verbandsrechtliches,10 körperschaftsrechtliches11 bzw. organschaftliches12 Rechtsinstitut sei. Wie sich im Laufe der Untersuchung zeigen wird, handelt es sich hierbei nicht nur um eine unzulässige begriffliche Verengung. Vielmehr kaschiert der Hinweis auf organschaftliche Grundsätze auch den Mangel an rechtsdogmatischer Begründung. Denn die Rechtfertigung der klassischen Entlastungsfolgen mit Hinweis auf organschaftliche Grundsätze bleibt solange rein begrifflich, wie nicht offengelegt wird, inwieweit hierin eine Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen des Privatrechts liegt und–letztlich entscheidend–worin der sachliche Grund für diese Abweichung besteht. Für die Darstellung folgt hieraus, dass die Entlastung–gleichsam induktiv–zunächst im Bürgerlichen Recht (I.) und sodann im Gesellschaftsrecht (II.) näher zu untersuchen ist, um auf dieser Grundlage die funktionelle Identität der beiden Erscheinungsformen nachzuweisen (III.). Darüber hinaus lassen sich aus dem Verhältnis von Rechenschaft und Entlastung bereits gewisse rechtliche Konkretisierungen des Entlastungsin stituts ableiten (IV.), denen die dogmatische Konstruktion der Entlastungsfolgen gerecht werden muss. Nach dieser Grundlegung sind die denkbaren Konstruktionsansätze herauszuarbeiten und im Einzelnen auf ihre Tauglichkeit zur Rechtfertigung der anerkannten Entlastungsfolgen zu untersuchen.
I Die Entlastung im Bürgerlichen Recht
Bei den klassischen Geschäftsbesorgungsverhältnissen des Bürgerlichen Rechts taucht die Entlastung vor allem im Zusammenhang mit »Schlussrechnungen« nach Abschluss der übertragenen Geschäfte auf.13 Das beruht auf dem engen funktionalen Zusammenhang der Entlastung mit der Rechenschaftsablegung durch den Geschäftsführer. Da dieser Zusammenhang für das Verständnis des Entlastungsinstituts grundlegend ist, soll hiervon gleich zu Beginn ausführlicher die Rede sein.
1. Die Rechenschafts und Rechnungslegungspflicht des Geschäftsführers nach Ausführung der Geschäfte
Schon der Auftragsvertrag als Grundform der bürgerlich-rechtlichen Geschäftsbesorgung verpflichtet in § 666 BGB den Geschäftsführer–den Beauftragten–»nach der Ausführung des Auftrags« zur Rechenschaft.14 Handelt es sich bei der Geschäftsführung um »eine mit Einnahmen und Ausgaben verbundene Verwaltung«, so erweitert und ergänzt § 259 Abs. 1 BGB diese Rechenschaftspflicht um eine Rechnungslegungspflicht. Der Geschäftsführer hat danach eine »geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und der Ausgaben« anzufertigen und die erforderlichen Belege vorzulegen. Die Schlussrechnung hat dabei nicht nur die Aufgabe, die noch ausstehenden Leistungsverpflichtungen der Parteien näher zu konkretisieren. Vielmehr dient sie als integraler Bestandteil des Rechenschaftsvorgangs dazu, den Geschäftsherrn über die Einzelheiten der vorgenommenen Geschäfte und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten in Kenntnis zu setzen. Das Erfordernis einer geordneten Zusammenstellung der Rechnungspositionen macht deutlich, dass der Geschäftsherr durch die Schlussrechnung in die Lage versetzt werden soll, die Geschäftsführung und die geltend gemachten Ansprüche des Geschäftsführers auf ihre sachliche Berechtigung hin zu überprüfen. Hierdurch unterscheidet sich die Rechenschafts und Rechnungslegungspflicht von der ebenfalls in § 666 BGB normierten Benachrichtigungs- und Auskunftspflicht. Diese dient während der laufenden Geschäftsführung vornehmlich dazu, dem Geschäftsherrn eine effektive Wahrnehmung des in § 665 BGB vorausgesetzten Weisungsrechts zu ermöglichen, um so auf den weiteren Verlauf der Geschäftsführung Einfluss zu nehmen.15
Die Rechnungslegungspflicht verdrängt die Rechenschaftspflicht nicht, sondern gestaltet sie im Bereich der finanzbezogenen Geschäfte besonders aus.16 Aus der Rechenschaftspflicht kann sich nach § 242 BGB deshalb die Verpflichtung ergeben, über die erteilten Belege hinaus zusätzliche Unterlagen zu unterbreiten oder die Geschäftsführung in einem mündlichen oder schriftlichen Rechenschaftsbericht eingehender zu erläutern.17 Daneben steht es dem Geschäftsführer frei, den Geschäftsherrn über das geschuldete Maß hinaus über den Verlauf der Geschäfte zu informieren. Allgemein gilt, dass die Rechenschaft–ebenso wie die Rechnungslegung–»vollständig, richtig, verständlich und nachprüfbar« sein muss.18 Da in bürgerlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen das sog. Selbstbelastungsverbot des Strafrechts (»nemo tenetur se ipsum accusare«, vgl. § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO) nicht greift, ist der Geschäftsführer im Rahmen der Rechenschaftspflicht grundsätzlich verpflichtet, tatsächliche oder etwaige Pflichtverletzungen und sogar gegen den Geschäftsherrn begangene Straftaten (§§ 263, 266 StGB) von sich aus offenzulegen.19 Gerade an diesen Informationen hat der Geschäftsherr typischerweise ein besonderes Interesse. Die Vorschrift des § 666 BGB soll dem Geschäftsherrn deshalb auch und gerade dann die notwendige Übersicht verschaffen, wenn der Geschäftsführer gegen die ihm obliegenden Pflichten verstoßen hat und die Rechenschaft den Nachweis des Vertrauensmissbrauchs erst ermöglicht oder zumindest erleichtert.20 Zum pflichtgemäßen Inhalt der Rechenschaft gehören deshalb sämtliche Umstände, die nach der Verkehrsan schauung und vernünftigem Ermessen zur sachgerechten Beurteilung der Geschäftsführung erforderlich sind.21
2. Die Rechtsfolgen abgelegter Rechenschaft für die Haftung des Geschäftsführers
Rechenschaft und Rechnungslegung zielen nach den vorstehenden Ausführungen darauf ab, den Geschäftsherrn in die Lage zu versetzen, sich ein umfassendes Bild über die Geschäftsführung zu machen und zu entscheiden, ob der Geschäftsführer die ihm übertragenen Geschäfte ordnungsgemäß und erfolgreich geführt hat. Neben dieser Kontrolle soll die Rechenschaft den Geschäftsherrn aber auch in die Lage versetzen, die Geschäfte künftig wieder selbst in die Hand zu nehmen. Da die Rechenschaft insoweit den förmlichen Schlusspunkt der zurückliegenden Geschäftsführung darstellt, lässt sich zwangslos formulieren, dass der Geschäftsführer Rechenschaft ablegt, um sich für die Zukunft selbst von den übertragenen Aufgaben zu entlasten. Dieser Gedanke klingt z. B. in Art. 114 Abs. 1 GG an, wo es heißt, dass der Bundesminister der Finanzen »dem Bundestage und dem Bundesrate über alle Einnahmen und Ausgaben…zurEntlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen« hat.22 Damit ist freilich nicht das hier zu untersuchende Rechtsinstitut der Entlastung gemeint. Zu einem Anspruchsverlust führt die Rechenschaftsablegung nämlich nur im Hinblick auf die Rechenschaftspflicht selbst, da der Geschäftsführer von ihr durch Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB) frei wird.23 Das entbindet ihn grundsätzlich von der Last, zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu den Einzelheiten der Geschäftsführung Stellung zu nehmend24 Auf diese Weise bleibt ihm erspart, sich die Einzelheiten der Geschäftsführung nach längerer Zeit durch u.U. aufwendiges Aktenstudium erneut vor Augen führen zu müssen.
a) Die Darlegungs- und Beweislast des Geschäftsführers im Ersatzprozess
Selbst wenn der Geschäftsführer seine Rechenschaftspflicht aber ordnungsgemäß erfüllt hat, verbleibt eine Konstellation, in der eine erneute Stellungnahme und Erläuterung erforderlich werden kann. Macht der Geschäftsherr später nämlichAnsprüche aus pflichtwidriger Geschäftsführung geltend, trifft den Geschäftsführer nach allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast, dass er die ihm vorgeworfene Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB) und ihn insbesondere kein Verschulden trifft (§ 276 Abs. 1 Satz 1 BGB).25 Zwar ändert § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB seinem Wortlaut nach nichts daran, dass zunächst der Geschäftsherr die Pflichtverletzung des Geschäftsführers und den daraus entstandenen Schaden darlegen und ggf. beweisen muss. Doch stellt sich gerade bei handlungsbezogenen Pflichten, die im Wesentlichen auf die Beachtung der bei der Geschäftsführung erforderlichen Sorgfalt gerichtet sind, die Frage, ob nicht auch hinsichtlich der objektiven Pflichtverletzung eine Umkehr der Darlegungsund Beweislast zulasten des Geschäftsführers gelten muss. Besteht nämlich die Pflichtverletzung in einem Sorgfaltspflichtverstoß, so ist mit dem Nachweis der objektiven Pflichtverletzung in aller Regel zugleich auch der Nachweis für das Vertretenmüssen in der Form der Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2 BGB) erbracht.26 Denn für Fahrlässigkeit gilt nach allgemeiner Ansicht kein individueller, sondern ein auf die allgemeinen Verkehrsbedürfnisse ausgerichteter objektiv-abstrakter Sorg- faltsmaßstab.27 Das hätte zur Folge, dass § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB bei handlungsbezogenen Pflichten weitgehend leerliefe, weil nicht der Schuldner die fehlende Fahrlässigkeit, sondern der Gläubiger als Voraussetzung des § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB bereits den Sorgfaltspflichtverstoß darzulegen und ggf. zu beweisen hätte. Die Rechtsprechung gelangt zutreffend jedenfalls dann zu einer Beweislastumkehr hinsichtlich der objektiven Pflichtverletzung, wenn die Schadensursache allein aus der Verantwortungssphäre des Schuldners herrühren kann.28 Während diese Frage im Allgemeinen von den Umständen des Einzelfalls abhängt, wird die Schadensursache für die Schadensersatzpflicht des Geschäftsführers dagegen nicht selten allein aus dem Obhuts- und Gefahrenbereich des Geschäftsführers stammen.29 In einem solchen Fall muss der Geschäftsführer dann ausnahmsweise darlegen und beweisen, er habe weder objektiv noch subjektiv pflichtwidrig gehandelt.30 Im Gesellschaftsrecht ist dieser Befund in besonderen Vorschriften sogar zwingend festgeschrieben (§§ 93 Abs. 2 Satz 2,116 Satz 1 AktG, §§ 34 Abs. 2 Satz 2, 41 GenG, § 52 Abs. 1 GmbHG), weil die Gesellschaft dort typischerweise nicht über die für die Beurteilung der Pflichtwidrigkeit erforderliche Nähe zur Unternehmensführung verfügt.31 Die Gesellschaft trifft folglich die Darlegungs- und Beweislast nur dafür, dass und inwieweit ihr durch ein Verhalten des Organmitglieds in dessen Pflichtenkreis ein Schaden erwachsen ist.32 Hingegen hat das Organmitglied darzulegen und ggf. zu beweisen, dass er seinen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist oder ihn kein Verschulden trifft, oder dass der Schaden auch bei pflichtgemäßem Alternativverhalten eingetreten wäred33 Zwar fehlen im übrigen Gesellschaftsrecht entsprechende Regelungen, doch werden § 93 Abs. 2 Satz 2 AktG, § 34 Abs. 2 Satz 2 GenG bei der GmbH,34 beim Verein35 und auch im Personengesellschaftsrecht36 entsprechend herangezogen. Die Analogie wird nicht zuletzt mit der Erwägung begründet, dass der Geschäftsführer einer Rechenschaftspflicht unterliege und sich deshalb auch hinsichtlich der Pflichterfüllung entlasten müssed37 Diese Begründung lässt sich zwanglos auf alle rechenschaftspflichtigen Geschäftsführer übertragen, soweit die Geschäftsführung gegenüber dem Geschäftsherrn derart verselbständigt ist, dasser diejenige Handlung oder Unterlassung, die den Schaden verursacht hat, nicht mehr konkret benennen kann und er deshalb »immer in einer Beweisnot wäre«.38
b) Die Gefahr der Beweisnot vor Ablauf der Verjährungsfrist
Dass dem Geschäftsführer danach in einem Ersatzprozess vielfach der Entlastungsbeweis für objektiv und subjektiv pflichtgemäßes Handeln obliegt, führt dazu, dass er die Geschäftsführung in einem späteren Rechtsstreit mit dem Geschäftsherrn selbst dann erneut rechtfertigen muss, wenn dieser gegen die ursprünglich geleistete Rechenschaft gar keine Einwendungen erhoben hat. Zwar verliert der Geschäftsherr infolge der geleisteten Rechenschaft nach § 362 BGB seinen Anspruch auf R...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Title
- Impressum
- Vorwort
- Inhaltsübersicht
- Einleitung
- 1. Teil: Die Grundlagen der Untersuchung
- 2. Teil: Die Entlastung als rechtsgeschäftlicher Verzicht
- 3. Teil: Die Entlastung und das Verbot widersprüchlichen Verhaltens
- Literaturverzeichnis
- Fußnoten