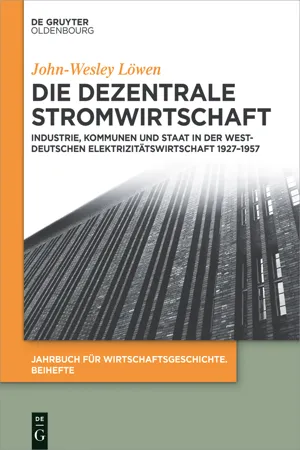
eBook - ePub
Die dezentrale Stromwirtschaft
Industrie, Kommunen und Staat in der westdeutschen Elektrizitätswirtschaft 1927-1957
- 363 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die dezentrale Stromwirtschaft
Industrie, Kommunen und Staat in der westdeutschen Elektrizitätswirtschaft 1927-1957
Über dieses Buch
Der Autor untersucht, wie sich die Marktsituation in der deutschen Stromwirtschaft unter der Bedingung netzgebundener Liefermonopole historisch darstellte. Sie widerlegt, dass Leitungsmonopole mit dem Fehlen von Wettbewerb gleichzusetzen sind und die Stromkonzerne die Regulierungspolitik beeinflussten. Es gab noch in der frühen BRD unzählige dezentrale Stromerzeuger in Industrie und Kommunen, die sich gegen die Konzerne erfolgreich behaupteten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die dezentrale Stromwirtschaft von John-Wesley Löwen im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Wirtschaftsgeschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
1.1 Forschungsstand
Der Elektrizitätswirtschaft ist seit der Entstehungszeit von ihren Protagonisten und den außenstehenden Beobachtern gleichermaßen eine große Bedeutung für die Wirtschaft und Gesellschaft zugeschrieben worden. Die elektrotechnischen Erfindungen galten unter den Zeitgenossen nicht selten als bahnbrechende Innovationen, die Visionen und soziale Utopien auslösten, die sich gekonnt von den historischen Gegebenheiten abzusetzen verstanden.1 Werner von Siemens, der die Entwicklung der aufkommenden Neuen Industrien zu ergründen versuchte und bereits 1886 das „naturwissenschaftliche Zeitalter“ ausrief, zweifelte genauso wenig daran wie zwei Jahrzehnte später Walther Rathenau, dass die Elektrizität ungeahnte Möglichkeiten eröffnen und für alle gesellschaftlichen Bereiche Bedeutung erlangen würde.2 Ihre vielfältige Einsetzbarkeit veränderte nicht nur den Arbeitsprozess in den Betrieben, sondern hatte darüber hinaus tiefgreifende Auswirkungen auf das alltägliche Leben der Bevölkerung. Diese Sichtweise ist später von der wirtschaftshistorischen Forschung aufgegriffen worden. Sie hält bis heute an dem Paradigma fest, dass eine steigende Wirtschaftsleistung mit einem zunehmenden Energiebedarf einhergeht. Joseph Schumpeter verglich die Elektrizität mit der Entwicklung der Eisenbahn. Er war davon überzeugt, dass die elektrotechnischen Innovationen und die Investitionen in die wirtschaftliche Umsetzung einen langfristigen Konjunkturzyklus ausgelöst hatten, dessen Wirkungen noch in den 1930er Jahren, als er seine historische Analyse des Kapitalismus verfasste, zu beobachten waren.3 David Landes bezeichnete das symbiotische Wachstum von elektrischer Kraft und Elektromotoren kurzerhand als ein „neues Produktionssystem mit grenzenlosen Möglichkeiten“.4
Neuere Untersuchungen sind etwas zurückhaltender in ihren Schlussfolgerungen. Sie weisen darauf hin, dass ein technologischer Wandel, der sich durch die Einführung von universell einsetzbaren Techniken in den gesellschaftlichen Produktionsprozess vollzieht, längere Zeiträume in Anspruch nimmt, bis aus ihm signifikante Wachstumsraten resultieren.5 Das ist in den letzten Jahren vor allem am Beispiel der Dampfmaschine der klassischen Industriellen Revolution nachgewiesen worden, die sich selbst in England erst ab den 1850er Jahren auf breiter Front gegen die mit Wasserkraft betriebenen Maschinen durchzusetzen vermochte.6 Die Wissensproduktion erfuhr im ausgehenden 19. Jahrhundert einen rasanten Aufwärtstrend. So entstand auch ein elastisches Angebot an Wissen hinsichtlich der Möglichkeiten, elektrische Energie in den Industriebetrieben, öffentlichen Einrichtungen und privaten Haushalten für unterschiedliche Zwecke einzusetzen, die Stromversorgung kostengünstiger zu gestalten und weitere, bis dahin nicht genutzte Ressourcen, zur Stromerzeugung heranzuziehen. Doch es bedurfte mehr als nur technischer Erfindungen, damit dieses Produktivitätspotenzial auch genutzt wurde. Eine wesentliche Voraussetzung war der institutionelle Rahmen, der Anreize für diese Investitionen schaffte.7 Ein Merkmal der Institutionen ist, dass sie die Handlungsfreiheit der Marktakteure stets in einer bestimmten Weise einschränken, weshalb es nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Wirkung einzelner Bestandteile des institutionellen Rahmens im Laufe der Zeit ändert und diese zu einem Hindernis für die Ausschöpfung neuer technischer Möglichkeiten werden können. Institutionen garantieren nicht a priori ein effizientes Resultat. Entscheidend ist daher die Fähigkeit der beteiligten Marktakteure, die tradierten Spielregeln an die Erfordernisse einer veränderten Marktsituation anzupassen oder sogar neue institutionelle Arrangements auszuhandeln.8
In historischen Darstellungen wird die Elektrizitätswirtschaft in der Regel als eine Entwicklung vom isolierten Stadtwerk zur überregionalen Stromversorgunggeschildert, in der die Stromübertragung und -verteilung eine bedeutende Rolle einnehmen. Im Fokus stehen die öffentlichen Stromanbieter und Netzbetreiber, während die Eigenanlagen, die von der Industrie für die Erzeugung des eigenen Strombedarfs eingesetzt wurden, bisher keine, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung angemessene, Berücksichtigung finden. Das Forschungsinteresse konzentriert sich bis heute fast ausschließlich auf die öffentliche Stromversorgung, wie die in diesem Zusammenhang oft zitierte Untersuchung des Technikhistorikers Thomas Hughes verdeutlicht.9 Er rückt in seiner systemtheoretisch inspirierten Betrachtung das Stromnetz als zentralen Bestandteil der Elektrizitätswirtschaft in den Mittelpunkt, um die Expansion der öffentlichen Stromversorgung in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Großbritannien von den Anfängen bis zum Ende der 1920er Jahre vergleichend darzustellen. Hughes zeichnet das Bild eines fortschreitenden räumlichen Integrationsprozesses, der in Metropolen wie New York, Berlin und London seinen Ausgangspunkt hatte, sich auf die Vororte der Städte ausweitete und sich schließlich im letzten Schritt auf die Landstriche mit geringer Bevölkerungsdichte ausdehnte. Die Dynamik dieser Entwicklung war zwar aufgrund der landesspezifischen Verhältnisse unterschiedlich, doch letztendlich führte sie in allen Fällen zu einer Konzentration durch Unternehmensfusionen oder – wie im britischen Fall – Verstaatlichung. Das war die organisatorische Voraussetzung für den netztechnischen Zusammenschluss der Kraftwerksanlagen.
Der technische Durchbruch, so die von Hughes und anderen Technikhistorikern vertretene These, erfolgte bereits 1891 mit der Demonstration der Drehstromübertragung auf der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt.10 Hier konnte erstmals der Nachweis erbracht werden, dass die Stromübertragung über weite Entfernungen möglich war, womit gleichzeitig der Systemstreit zwischen Gleich- und Wechselstrom entschieden wurde. Die öffentlichkeitswirksame Inszenierung in Frankfurt, bei der Wasserstrom vom 175 Kilometer entfernten Lauffen am Neckar übertragen wurde, gab der Zentralisierung zusätzlichen Schwung. Eine der treibenden Kräfte bei der Errichtung und Erweiterung der öffentlichen Infrastruktur waren die Elektrofirmen, die ein starkes Interesse daran hatten, den Absatzmarkt für die eigenen Produkte auszuweiten. Sie beteiligten sich an der Finanzierung neuer Stromanlagen mit eigens dafür eingerichteten Finanzierungsgesellschaften, in der Erwartung, den Verkauf der elektrotechnischen Erzeugnisse damit steigern zu können.11 Auf diese Weise entstanden seit den 1880er Jahren neben dem städtischen Elektrizitätswerk in Berlin eine Reihe weiterer Stadtwerke. Die Gründung des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes (RWE) im April 1898 erfolgte nach dem gleichen Muster und sollte sich bald zum größten Stromanbieter Westdeutschlands entwickeln.12
Diese klassische Lesart der historischen Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft und mit ihr der Elektroindustrie übersieht die industrielle Kraftwirtschaft, die insbesondere in Deutschland weit verbreitet war. Im Unterschied zu den bisherigen Forschungsbeiträgen wird die Industrie in dieser Arbeit methodisch konsequent in die Analyse einbezogen, um ihre Bedeutung für die dezentrale Struktur der westdeutschen Elektrizitätswirtschaft und ihre vielschichtige Beziehung zu den öffentlichen Stromanbietern aufzuzeigen. Nach Hans-Ulrich Wehler erwies sich die Vielzahl „dezentralisierter Stromerzeuger als Irrweg“, die weiträumige Stromlieferung – verdeutlicht am Fall RWE – dagegen als weit überlegen.13 Doch übersieht wie die meisten auch Wehler die Investitionen der Industrie in eigene Stromerzeugungsanlagen. Ruhrindustrielle wie Hugo Stinnes, August Thyssen und später auch Albert Vögler, die im Aufsichtsrat des RWE saßen und die Expansionsstrategie des Essener Stromanbieters maßgeblich vorantrieben, ließen gleichzeitig für ihre eigenen Industriebetriebe dezentrale Stromerzeugungsanlagen errichten. In Essen hatte zum Beispiel die Firma Krupp bereits zehn Jahre vor der Gründung des RWE eine eigene Stromanlage errichtet – und das war in der Schwerindustrie sowie in anderen Wirtschaftszweigen kein Einzelfall. Im Gegenteil, in den ersten Jahrzehnten der Elektrizitätswirtschaft war dieses Investitionsverhalten in der deutschen Industrie weit verbreitet, so dass sich ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg drei Viertel der errichteten Kraftwerksanlagen im Besitz der Industrie befanden.14 In Deutschland folgte die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft keiner Zwangsläufigkeit in Richtung der von Rathenau beschworenen Zentralisation.15
Die industriellen Kraftwerksbetreiber und die öffentlichen Versorgungsbetriebe entwickelten die Stromanlagen in der Frühphase der Elektrizitätswirtschaft unabhängig voneinander, weshalb ihre Interessen nur in Ausnahmefällen kollidierten. Die Industrieunternehmen, die Eigenanlagen errichteten, drängten nicht als Stromanbieter auf den Markt und sie führten deshalb, im Unterschied zu den städtischen Elektrizitätswerken, die von den erwähnten Finanzierungsgesellschaften der Elektroindustrie errichtet wurden, keine Verhandlungen mit der Kommunalverwaltung zwecks Tarifgestaltung und Benutzung der öffentlichen Wege.16 Sie forderten anfänglich – wenn überhaupt – nur selten das Recht, den Strom über öffentliche Wege zu leiten, weil die Kraftwerksanlagen in der damaligen Zeit als isolierte Einrichtung gebaut wurden. Das könnte teilweise erklären, warum in der zeitgenössischen Wahrnehmung die Debatten und Auseinandersetzungen im Vordergrund standen, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Stromversorgung geführt wurden. Der Umstand, dass sich die historische Forschung bis heute auf diesen Teilbereich der Elektrizitätsgeschichte konzentriert, ist daher nicht zuletzt ein Problem der quellenmäßigen Überlieferung. Für die öffentlich geführten Debatten in den verschiedenen Kommunen gibt es vergleichsweise leicht zugängliches Material. Damit bleiben allerdings bedeutende Entwicklungen unbeachtet.
Die Stadt- und Urbanisierungsgeschichte hat sich in den letzten Jahren zwar wieder verstärkt mit der Bedeutung der Elektrizitätsversorgung im Dienstleistungsangebot der Stadt beschäftigt.17 In diesem Zusammenhang sind die Fallstudien von Dieter Schott über die „Vernetzung der Stadt“ erwähnenswert, die aufschlussreiche Einblicke in die Entstehung der kommunalen Infrastruktur im Bereich der Energiewirtschaft und des Nahverkehrs bis zum Ersten Weltkrieg geben.18 Doch die Eigenanlagen der Industrie werden in dieser Darstellung wieder außer Acht gelassen.
Schotts Forschungsergebnisse bestätigen im Wesentlichen die bereits von Ulrich Wengenroth widerlegte zeitgenössische Behauptung, wonach mit den städtischen Elektrizitätswerken gleichzeitig der elektrische Antrieb in die mittelständischen Handwerksbetriebe Einzug hielt und die öffentlichen Stromanbieter somit zum Rettungsanker des Handwerks wurden.19 Bei den Elektrizitätswerken handelte es sich bis nach der Jahrhundertwende häufig um reine Lichtzentralen, die Strom für die Beleuchtung von Theatergebäuden, Straßen und öffentlichen Plätzen sowie Gaststätten und Kaufhäusern lieferten. Für die breite Bevölkerung blieb elektrisches Licht dagegen eine im Vergleich zu Kerzen, Gasleuchten oder Petroleumlampen teure Beleuchtungsmethode. Die ersten Abnehmer von Kraftstrom waren die elektrisch betriebenen Straßenbahnen des öffentlichen Nahverkehrs, bis schließlich auch das Kleingewerbe allmählich Elektromotoren in ihren Betrieben aufstellte und Lieferverträge für Kraftstrom mit den Stromanbietern abschlossen. Schott orientiert sich in seiner detailreichen Untersuchung an den für die Stadtgeschichtsschreibung üblichen zeitlichen und räumlichen Einschränkungen, weshalb es ihm auch nur mit Einschränkungen gelingt, auf dem Gebiet der Elektrizitätsversorgung den Wandel der kommunalen Selbstverwaltung im „langen 20. Jahrhundert“ überzeugend darzulegen.20 Folgt man dem nicht nur von Schott angewandten Analyserahmen, der von einem stufentheoretischen Modell ausgeht, so gewinnt man den Eindruck, dass die kommunale Energiepolitik spätestens mit dem Übergang zu regionalen Versorgungsstrukturen endet. Damit wird jedoch allzu leicht übersehen, dass sich die Kommunalbetriebe vielfach nur aus der Stromerzeugung zurückzogen, die Verteilungsnetze im Niederspannungsbereich aber weiterhin in ihrem Besitz behielten, um auf die Tarifpolitik Einfluss nehmen zu können. Außerdem blieben die Städte und Gemeinden die Konzessionäre der Elektrizitätswerke und waren Miteigentümer der großen Stromkonzerne. Die Oberbürgermeister saßen als kommunale Aktionäre in den Aufsichtsräten dieser Kapitalgesellschaften, während dagegen die Stadtverordnetenversammlung als Ort der Entscheidung an Bedeutung einbüßte.21
1.2 Fragestellung und Untersuchungsmethode
In dieser Untersuchung werden analytisch drei Dimensionen oder Ebenen unterschieden, die fortlaufend die Elektrizitätswirtschaft durchziehen und maßgeblich beeinflussen. Die Eigenanlagen der Industrie, die öffentlichen Elektrizitätswerke als Netzbetreiber und Stromanbieter sowie die staatliche Elektrizitätspolitik bilden diese Dimensionen, die in einer Wechselwirkung zueinander stehen und zwischen denen sich ein komplexer werdendes Beziehungsgeflecht herausgebildete.22 In Bezug auf die Eigenanlagen gilt es zu klären, warum die Industrieunternehmen diese überhaupt für die Stromversorgung der eigenen Betriebe errichteten und in welchen Situationen sie zum Fremdstrombezug wechselten. Das ist die klassische Frage, die ursprünglich von Ronald Coase, dem Begründer der Transaktionskostenökonomie, gestellt worden ist, um die Existenz von Unternehmen in der Marktwirtschaft zu erklären.23 Der Strombezug von einem Anbieter, so kann man mit Coase argumentieren, ist mit Transaktionskosten verbunden, die der Verbraucher durch die vertikale Integration der Stromanlagen zu reduzieren versucht. Es ist daher zu prüfen, welche Kosten der Stromlieferung die Industrieunternehmen dazu veranlassen, Eigenanlagen aufzustellen. Die Suchkosten dürften dabei weniger zu Buche schlagen, denn in der Elektrizitätswirtschaft haben die öffentlichen Netzbetreiber bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ein rechtlich anerkanntes Liefermonopol ausgeübt. Die Kosten der Aushandlung und Überwachung der Lieferverträge für eine sichere und technisch störungsfreie Strombelieferung sowie die steuerliche Belastung des Strompreises kommen dagegen schon eher in Frage. Es ist zum Beispiel denkbar, dass die Konzessionsabgaben, welche die Elektrizitätswerke an die öffentlichen Haushalte abführen mussten, aus der Sicht der Stromabnehmer ein zusätzlicher Anreiz waren, in den Ausbau der Eigenanlagen zu investieren. Die „Steuerentlastungsstrategie“, von der Richard Tilly mit Blick auf die kommunale Investitionstätigkeit im Deutschen Kaiserreich spricht, würde so gesehen also nicht darin bestehen, dass die Bürger und die örtliche Wirtschaft damals den Ausbau des städtischen Elektrizitätswerkes unterstützten, weil sie die Erwartung hegten, die Einnahmen der Kommunalbetriebe für eine Reduzierung der Steuerlast einsetzen zu können.24
Neben den Transaktionskosten sind aber auch die Kosten für die Erzeugung und den Transporte der elektrischen Energie zu berücksichtigen, die durch technische Entwicklungen beeinflusst werden. Der Umstand, dass die Stromanbieter für die Errichtung der Leitungsnetze hohe Investitionskosten zu tragen hatten, ist sicherlich ein nicht zu unterschätzender Faktor, der dazu beitrug, dass die öffentlichen Elektrizitätswerke in der Frühzeit nur selten erfolgreich gegen Industriekraftwerke konkurrieren konnten. Die Stromnetze waren außerdem störungsanfällig, was leicht zu Unterbrechungen bei der Belieferung führte. Diese technischen Probleme bekamen die Elektrizitätswerke nur allmählich in den Griff. Hinzu kamen die Stromerzeugungskosten. Der elektrische Generator konnte auf unterschiedliche Weise betrieben werden, wobei die Turbine, die ab Anfang des 20. Jahrhunderts vermehrt Einzug in die Kraftwerksanlagen hielt, eine von mehreren Mögl...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Half Title
- Jahrbuch für
- Title
- Copyright
- Vorwort
- Inhalt
- 1 Einleitung
- 2 Vom Elektrofrieden zur gebundenen Konkurrenz
- 3 Wirtschaftsaufschwung und Kriegswirtschaft
- 4 Kontinuität und Wandel
- Schlussbetrachtung
- Archive und Quellenbestände
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Register
- Fußnoten