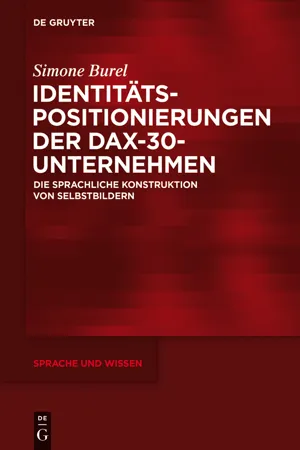![]()
___
Teil B: Empirie
![]()
5 Ebene der Situationalität
Da diskursive Strukturen nicht nur durch textimmanente Strukturen determiniert werden, sondern auch durch den kommunikativ-pragmatischen Rahmen des Diskurses, werden auf der Ebene der Situationalität die Einflüsse behandelt, welche Aussagen teilweise schon bedingen oder filtern.300 Im Folgenden werden daher die durch Texte handelnden Akteure (UNTERNEHMEN) in ihrem Handlungsbereich, dem Diskursbereich WIRTSCHAFT und dem abgeschlossenen Diskursraum DAX-30, analysiert. Zugleich beeinflussen auch Strukturbedingungen wie Textsorten die Handlungsmuster der AKTEURE, da diese bereits Orientierungsmuster an die Korpustexte vorgeben (vgl. Brinker 2005, 132). Für ein tieferes Verständnis des Diskurses werden die UNTERNEHMEN im Folgenden in ihrer systemischen Eigenart und Lebenswelt analysiert.
5.1 Diskurshandelnde: Die DAX-30-UNTERNEHMEN
Eine handelnde Instanz wird (nicht nur in der Diskursanalyse) als Akteur bezeichnet. Der Akteur führt Handlungen aus, für welche er „Können“ (prozedurales und deklaratives Wissen) selbst besitzt oder durch andere beschafft (vgl. Schmid/Lyczek 2008, 15). Die Handlung unterscheidet sich als zielgerichtetes und begründbares Verhalten demnach von anderen unreflektierbaren Verhaltensweisen (vgl. Schmid/Lyczek 2008, 16). Akteure können ihre Handlungen zudem durch ihre Sprache mitteilen und deren Bedeutung erklären, d. h. sie produzieren symbolische Ordnungen durch Zeichen und objektivieren diese. Es wird in dieser Analyse also von AKTEUREN ausgegangen, die absichtsvoll (sprachlich) handeln. Die Symbolisierung einer Handlung durch Zeichen ist dabei nicht nur Grundlage für ihre Reflexion und Weitergabe, sondern auch für ihre Regulierung in Gesetzen der Gesellschaft, welche etwa als Handlungsregeln für Unternehmen maßgeblich sind.301 Unternehmen sind in ihren Handlungen daher nicht autonom, sondern, neben der Limitierung durch vorhandenes Wissen, auch durch Regeln der Gesellschaft begrenzt (vgl. Schmid/Lyczek 2008, 17). Daneben beeinflussen auch andere Diskurse deren (sprachliche) Handlungen, worauf die folgenden Kapitel eingehen.
5.1.1 UNTERNEHMEN als Systeme
Die handelnden AKTEURE des Diskurses – UNTERNEHMEN – lassen sich systemtheoretisch als Systeme302 ansehen, da sie auf eine Aufgabenvollführung und damit auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind (vgl. Niederhäuser/Rosenberger 2011, 23).303 Nach den Autoren Schmid/Lyczek (2008, 26), die sich an das St. Galler Managementmodell im Sinne einer systemorientierten Managementlehre anlehnen, sind Unternehmen dabei
offene, soziotechnische, zweckorientierte und WIRTSCHAFTliche Systeme, die Funktionen für verschiedene Teilumwelten erbringen. (Schmid/Lyczek 2008, 26)
Wirtschaftlich [e ] bezieht sich dabei auf den Diskursbereich der Unternehmen; zweckorientiert [e ] verweist auf ihre Funktion der Nutzenstiftung und Mehrwertgenerierung; sozio-technisch [e ] meint den arbeitsteiligen Prozess, in welchem sie Aufgaben für ihre Anspruchsgruppen lösen (für diese Nutzen stiften und somit Wert schöpfen); offen [e ] bezieht sich auf die (Austausch-)Beziehung mit ihrer Umwelt (anderen Systemen), d. h. ein Unternehmen ist damit nur ein Teilsystem im Gesamtsystem (Supersystem) seiner Umwelt bzw. der Gesellschaft. Es ließe sich dabei als ein soziales System ansehen, das aus Mitgliedern (Menschen) besteht (vgl. Jernej 2008, 136), die untereinander Informationen austauschen. Seit Jahrtausenden sind WIRTSCHAFTssysteme fest in Gesellschaften integriert und stellen daher einen Teil der gesellschaftlichen Gesamtkultur dar (vgl. Jernej 2008, 136).304
In einem System funktioniert der Austausch zwischen den Mitgliedern nunmehr nach bestimmten Systemregeln, die „im Wesentlichen in Einstellungen und Verhalten überein stimmen und auf dieser Grundlage kollektive Zielsetzungen verfolgen“ (Ebert/Konerding 2008, 69). Bei sozialen Systemen ist diese koordinierende und ordnungsbildende Praxis die Kommunikation als Indikator für soziale Strukturen (vgl. Müller 2007, 137f.). Kommunikation ist jedoch nicht nur Voraussetzung für die Koordination und Erhaltung des Systems, sondern erschafft dieses erst, durch
In-BeziehungTreten […], das darauf abzielt, mit Hilfe gemeinsam verfügbarer Zeichen wechselseitig vorrätige Bedeutungsinhalte im Bewusstsein zu aktualisieren. (Burkart 2002, 63)
Die Verdinglichung des Systems und seiner Gegenstandswelt durch (sprachliche) Kommuni kation ist somit wesentlich für dessen Identitätskonstruktion. Durch diese Kommunikation wird dem Handeln des Unternehmens Form und Sinn zugeschrieben, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, indem durch Erklärungen gewisse Bedeutungen ausgehandelt werden, um gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen. Denn Unternehmen müssen ihre Exis tenz und damit ihre Funktion für die umgebende Gesellschaft immer wieder legitimieren (vgl. Schmid/Lyczek 2008, 27), da sie als soziale Systeme im reziproken Austausch mit anderen Systemen liegen (vgl. Jernej 2008, 143). Ihre Sinnproduktion muss permanent neu ausgehandelt werden, „um in der kommunikativen Dynamik der Gesellschaft existieren zu können“ (Kastens 2008, 43). Unternehmen konstituieren damit im systemischen Kontinuum ihren eigenen Deutungsrahmen für sprachliche Zeichen und fixieren diesen textuell.
5.1.2 Unternehmen: Institution und Organisation
In der Forschung kommt immer wieder die Frage auf, ob ein Unternehmen als Organisation oder als Institution305 zu fassen ist. Brünner (2009, 157f.) etwa sieht Unternehmen, neben Universitäten oder Schulen, als Institutionen an, wenn man ihnen eine „Rolle als Teilsysteme im gesellschaftlichen Funktionszusammenhang“ (Brünner 2009, 158) zuerkennt.306 Nach Schmid/Lyczek (2008, 27) ist ein Unternehmen eine besondere Form der Organisation, die wiederum eine konkrete Realisation einer Institution ist, d. h. eine Organisation, die nach dem Regelwerk der Institution handelt.307 Eine Institution verstehen die Autoren als eine Formation, welche „die Spielregeln einer Gesellschaft oder, förmlicher ausgedrückt, die vom Menschen erdachten Beschränkungen menschlicher Interaktion“ (Schmid/ Lyczek 2008, 7) bestimmt. Institutionen sind also staatliche Behörden oder Gemeinden. Das bedeutet letztendlich, dass Institutionen auch bestimmen, was Akteure tun müssen und dürfen, und damit das gesamte WIRTSCHAFTsgeschehen regeln (vgl. Schmid/Lyczek 2008, 7). Institutionen prägen den Diskurs somit vorab bereits durch ihre definierten Regeln und ermöglichen daher Ordnung und Regulierung. Organisationen wie Unternehmen halten sich wiederum an diese handlungsleitenden Regeln (vgl. Schmid/Lyczek 2008, 18ff.).
Dieser deontische Charakter institutioneller Wirklichkeit soll aus linguistischer Perspektive weiter erörtert werden. Searle (2009) geht in seinem Aufsatz Was ist eine Institution ?308 von einem breiteren Institutionsbegriff aus und subsumiert darunter beispielsweise auch die Gesellschaft. Den Begriff ›Institution‹ definiert er dabei anhand von „drei primitive[n] Tatsachen“ (Searle 2009, 90ff.):309 Kollektiver Intentionalität, das Zuweisen einer Funktion (mittels der Form X gilt als Y) sowie einer Statusfunktion, die kollektiv anerkannt wird. Die Institution stellt, sobald sie „errichtet“ (Searle 2009, 94) worden ist, eine Struktur aus konstitutiven Regeln zur Verfügung. Neben der Betonung dieser konstitutiven Regeln ist Searles Modell vor allem aussagekräftig in Bezug auf die institutio...