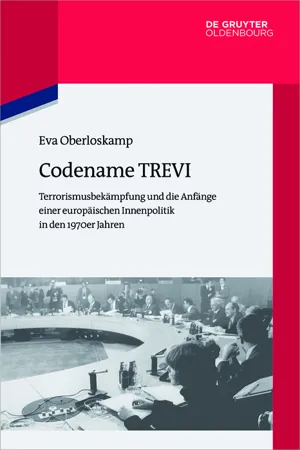1. Einleitung
Die Innenpolitik, zusammen mit dem Justizbereich, ist seit der Jahrtausendwende zu einem der am stärksten expandierenden Politikfelder der Europäischen Union geworden1. Diese Domäne war nicht von den Römischen Verträgen betroffen gewesen und lange allein der nationalen Politik in den EG-Staaten vorbehalten geblieben. Die Anfänge einer europäischen Koordinierung im Bereich der Innenpolitik liegen erst in den 1970er Jahren: 1976 gründeten die für die Innere Sicherheit zuständigen Minister der damals neun EG-Mitgliedstaaten eine intergouvernementale „Europäische Konferenz für Innere Sicherheit“, die sogenannte TREVI-Konferenz2. Hauptanliegen dieses fortan regelmäßig tagenden Gremiums war es, eine intensivierte Zusammenarbeit der EG-Sicherheitsbehörden politisch abzustimmen.
Wesentlicher Auslöser und Motor der TREVI-Konferenz war der in den 1970er Jahren zunehmend grenzüberschreitend beziehungsweise transnational operierende „internationale Terrorismus“3, der in einigen EG-Staaten als massive Bedrohung wahrgenommen wurde. Dies gilt in besonderem Maße für die Bundesrepublik Deutschland, für die Gefährdungen durch in- und ausländische Terroristen ein bis dahin unbekanntes Problem gewesen waren4. In teilweise schwierigen Lernprozessen mussten Strategien des Umgangs hiermit entwickelt werden. Eine wichtige Erkenntnis, die dabei handlungsrelevant wurde, war die Einsicht, dass innenpolitische und gesetzgeberische Maßnahmen allein nicht ausreichten, um der terroristischen Herausforderung wirksam entgegenzutreten. Vielmehr könne, so etwa die von Bundesinnenminister Werner Maihofer 1976 in einer Bundestagsrede formulierte Überzeugung, der „erkennbar werdenden Internationalisierung des Terrorismus […] nur durch eine entsprechende Internationalisierung der Bekämpfung des Terrorismus erfolgreich begegnet werden“5.
Der Terrorismus als „Angriff auf das Herz des Staates“6 wurde dabei als ein derart drängendes Problem perzipiert, dass die Bereitschaft enstand, sich in einem in hohem Maße „souveränitätsgeladenen Politikfeld“7 für engere Formen der Zusammenarbeit zu öffnen und dabei unter Umständen auch „Einschnitte in nationale Sicherheitskompetenzen zu akzeptieren“8. Das Politikfeld, das damit in den Sog der europäischen Integrationsdynamik geriet, bildete eine Schnittstelle zwischen klassischen Konzepten äußerer und innerer Sicherheit und war bislang zu den Kernbereichen moderner staatlicher Machtausübung gezählt worden9. Durch eine europäische Kooperation der Sicherheitsbehörden – die Organe des staatlichen Gewaltmonpols sind – sollten Bestand und Stabilität staatlicher Organisation der EG-Partner gewährleistet werden.
Die TREVI-Konferenz war jedoch bereits in den 1970er Jahren weitaus mehr als lediglich eine pragmatische Antwort auf die terroristische Bedrohung10: Sie stand tatsächlich und auch im Bewusstsein der beteiligten Akteure von Anfang an im unmittelbaren Kontext der europäischen Integration: Dies gilt erstens, weil eine europäische Kooperation im Bereich der Inneren Sicherheit nicht allein als Reaktion auf die terroristische Bedrohung von Bedeutung war, sondern auch im Hinblick auf den in den Römischen Verträgen eingeforderten freien Personenverkehr ohne Grenzkontrollen innerhalb der EG. Die TREVI-Konferenz wurde zumindest von einem Teil der beteiligten Staaten als Möglichkeit gesehen, die Realisierung dieser Grundfreiheit des Binnenmarktes voranzutreiben. Zweitens war die TREVI-Konferenz ein Präzedenzfall für eine Intensivierung europäischer Zusammenarbeit in Politikfeldern, die jenseits des Geltungsbereichs der Römischen Verträge lagen. Insbesondere bundesdeutschen Akteuren ging es vor diesem Hintergrund von Anfang an nicht allein um Terrorismusbekämpfung, sondern auch um den Aufbau einer „europäischen Innenpolitik“, so eine Formulierung von Maihofer aus dem Jahr 197711. Insgesamt erweisen sich die 1970er Jahre für das europäische Politikfeld der Inneren Sicherheit als eine wichtige Formierungsphase, in der zentrale Weichenstellungen für spätere, auch rechtlich formalisierte Integrationsschritte erfolgten.
Die vorliegende Studie bildet damit sowohl einen Beitrag zur Geschichte der staatlichen Terrorismusbekämpfung in den 1970er Jahren als auch zur Geschichte der europäischen Integration. Die Gründung der Konferenz und die ersten Jahre ihrer Tätigkeit erlauben exemplarisch eine vertiefte Analyse der Prozesse und Schwierigkeiten, von denen das Zusammenwachsen Europas seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt war. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht dabei die bundesdeutsche Perspektive: Dies ist zunächst sachlich begründet, denn die Bundesrepublik befürwortete wie kaum ein anderer Staat eine europäische Kooperation im Bereich der Inneren Sicherheit. Darüber hinaus hat diese Fokussierung auch pragmatische Gründe, denn in bundesdeutschen Archiven sind einschlägige Akten zur Politik des Bundesinnenministeriums relativ gut zugänglich. Trotzdem versucht die Arbeit ebenfalls, soweit möglich, die Positionen insbesondere der beiden anderen „großen“ EG-Partner Frankreich und Großbritannien zu beleuchten. Das Hauptinteresse gilt dabei den politischen Aushandlungsprozessen. Die Umsetzung der politischen Beschlüsse durch die Sicherheitsbehörden auf operativer Ebene kann im Rahmen dieser Arbeit lediglich punktuell einbezogen werden.
Zeitlich setzt die Untersuchung mit den ersten bundesdeutschen Überlegungen zur internationalen Terrorismusbekämpfung nach dem Olympia-Attentat 1972 ein. Sie endet mit dem Ablauf des Jahrzehnts: Dieser Einschnitt erklärt sich zum einen aus der Tatsache, dass die TREVI-Kooperation nach anfänglich großem Elan gegen Ende des Jahrzehnts zu stagnieren begann. Neuen Aufschwung erlangte sie erst im Laufe der 1980er Jahre aufgrund veränderter Herausforderungen und Probleme. Der Zeitraum von der Gründung der Konferenz 1975/76 bis 1979/80 kann somit als erste Phase von TREVI betrachtet werden, die durch spezifische gemeinsame Ziele, aber auch durch eigene Schwierigkeiten und Konfliktkonstellationen charakterisiert ist. Zum anderen ist die zeitliche Eingrenzung der engeren Analyse auf die Zugangsbeschränkung archivalischer Quellen aufgrund der 30-jährigen Sperrfrist zurückzuführen12.
Die Existenz von TREVI war zwar öffentlich bekannt, die verhandelten Themen und Inhalte der Kooperation wurden jedoch lange geheim gehalten. Die Treffen fanden unter striktem Ausschluss der Öffentlichkeit sowie anderer staatlicher und EU-Stellen statt und die Kommunikation der beteiligten Ministerien und Sicherheitsbehörden erfolgte in den 1970er Jahren unter dem Codenamen „trevi“ über die verschlüsselten Telex-Verbindungen der Inlandsnachrichtendienste13. Symptomatisch für die Intransparenz der TREVI-Kooperation ist ihr Name, dessen Herkunft und Bedeutung nicht eindeutig zu klären sind: Die gängigste Variante – die allerdings teilweise auch explizit bestritten wird14 – besagt, dass TREVI als Akronym für „Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, Violence Internationale“ zu entschlüsseln sei. Andere Autoren interpretieren ihn als Verweis auf den Trevi-Brunnen in Rom, wo 1975 der Europäische Rat stattgefunden hatte, auf dem die Gründung der Konferenz angestoßen worden war15. Über den Bezug auf diesen Brunnen wird das Wort gelegentlich auch mit A.J. Fonteijn (auf deutsch „Brunnen“) in Verbindung gebracht, ein führender Beamter im niederländischen Justizministerium16, das im zweiten Halbjahr 1976 – als die Konferenz mit der Einrichtung von AGs und UAGs ihre praktische Arbeit begann – den Vorsitz innehatte. In den eingesehenen Akten war kein klarer Hinweis auf die Herkunft und Bedeutung des Initialworts auszumachen und eine Umfrage unter Beamten der Sicherheitsbehörden und zuständigen Ministerien aus den 1990er Jahren zeigt, dass auch jetzt noch keine Einigkeit über die Bedeutung des Kurzworts herrschte17. Vermutlich ist die Bezeichnung TREVI als Wortspiel zu verstehen, dessen Mehrdeutigkeit bewusst beabsichtigt war.
Angesichts der weitgehenden Geheimhaltung und Intransparenz wird das Thema in den politik- oder rechtswissenschaftlichen Arbeiten, in denen die Konferenz Erwähnung findet, in aller Regel nur knapp behandelt18, wobei immer wieder auch verzerrte oder unzutreffende Sachinformationen auszumachen sind19. Vertiefte und quellenbasierte Analysen zur TREVI-Konferenz liegen bislang nicht vor. Inzwischen ist die Durchführung solcher Studien jedoch aufgrund der Freigabe einschlägiger Akten möglich. Zentrale Bestände für die vorliegende Arbeit waren insbesondere die Akten des Bundesministeriums des Innern und des Bundeskanzleramts im Bundesarchiv Koblenz sowie des Auswärtigen Amts im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin. Darüber hinaus konnten in geringerem Umfang Akten des Ministère de l’Intérieur in den französischen Archives Nationales und Akten des Foreign and Commonwealth Office sowie des Home Office aus den British National Archives eingesehen werden. Ebenfalls mit einbezogen wurden Parlaments- und Pressedokumente, die aber aufgrund des geheimen Charakters der Zusammenarbeit nur zu Teilaspekten des Themas Aussagekraft besitzen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, jene Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren, Konstellationen und Prozesse zu analysieren, welche die Geschichte der frühen TREVI-Konferenz geprägt haben. Es geht somit um die Antriebskräfte des europäischen Zusammenwachsens im speziellen Politikfeld der Inneren Sicherheit. Die Analyse orientiert sich an der in den Politikwissenschaften üblichen Unterscheidung dreier Dimensionen des Politischen, die sich sowohl auf die innerstaatliche Ebene der Bundesrepublik anwenden lässt als auch auf die zwischenstaatliche Ebene der TREVI-Konferenz. Demnach können politische Vorgänge und Systeme entlang einer formalen, einer prozessualen und einer inhaltlichen Dimension betrachtet werden, welche oftmals auch im Deutschen mit den englischen Begriffen „polity“, „politics“ und „policy“ bezeichnet werden20. Die erstgenannte Dimension („polity“) bezieht sich auf den Handlungsrahmen, d. h. grundlegende Organisationsformen und -normen eines Staates, so etwa zentrale Verfassungsprinzipien und rechtliche Regelungen, politische und administrative Institutionen, informelle Regeln und Konventionen sowie die politische Kultur21. Die prozessuale Dimension („politics“) verweist auf die Art und Weise, wie Willensbildung und Interessenvermittlung erfolgt – auf das oftmals konflikthafte Zusammenwirken der politischen Akteure, die jeweils eigene Ziele und Vorstellungen zu verwirklichen suchen, gleichzeitig aber unter dem Zwang der wechselseitigen Rücksichtnahme stehen. Die dritte Dimension („policy“) schließlich umfasst die inhaltlichen Handlungsprogramme, die von politischen Akteuren und Instanzen verfolgt werden, sowie deren Umsetzung, also Resultate von politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Die Gesamtheit dieser drei Dimensionen lässt sich als „politisches System“ definieren22.
Die drei Dimensionen des Politischen sind eng miteinander verwoben: Der Handlungsrahmen ist die Voraussetzung dafür, dass politische Prozesse stattfinden können, die zur Umsetzung politischer Inhalte führen. Im historischen Rückblick freilich sind in den Quellen die Handlungsprogramme der Akteure und die realisierten Maßnahmen am offensichtlichsten erkennbar. Erst die Rekonstruktion der policy-Ebene in ihrem zeitlichen Wandel und in ihren jeweiligen Kontexten erlaubt Rückschlüsse auf die politischen Prozesse. Die differenzierte Erfassung der politics-Ebene wiederum ist Grundlage für die stärker abstrahierende Analyse des Handlungsrahmens. In methodischer Hinsicht geht die vorliegende Arbeit deshalb bei der Quellenauswertung zunächst von einer Untersuchung der Inhalte und Prozesse aus, um hierauf aufbauend auf allgemeine Charakteristika des Handlungsrahmens zu schließen.
Aus den drei soeben dargelegten Analysekategorien lassen sich konkrete Fragen zur Funktionsweise der frühen TREVI-Konferenz ableiten. Im Hinblick auf die inhaltliche Dimension („policy“) sind die Ziele, Handlungsprogramme und Motive der unterschiedlichen Akteure zu eruieren sowie die tatsächlich umgesetzten Maßnahmen. Die prozessuale Dimension („politics“) verweist auf die Abläufe und Entscheidungsprozesse im politischen System auf nationaler und europäischer Ebene: Wie versuchten die unterschiedlichen Akteure, ihre jeweiligen Interessen in unter Umständen konflikthaften Konstellationen durchzusetzen? Wie verliefen Kommunikations- und Informationsflüsse? Wie kam es zur Festlegung von Zielen und Handlungsprogrammen? Kamen Beschlüsse eher durch Topdown- oder durch Bottom-up-Prozesse zustande, welchen Einfluss hatten die Ministerial- und Sicherheitsbürokratien, welchen die politische Führungsebene? Im Zusammenhang mit der Dimension des Handlungsrahmens („polity“) schließlich stehen abstraktere und grundsätzlichere Fragen: Auf welchen rechtlichen Grundlagen fußte die Kooperation? Welche Elemente politischer Kultur – Wahrnehmungen, Sinnzuweisungen, Wertsetzungen, Diskurs- und Verhaltensmuster – konditionierten das Handeln der Akteure? Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Praxis der TREVI-Kooperation Rückwirkungen auf das politische System der beteiligten Staaten hatte und hier zu Veränderungen führte. Ein besonderes Interesse soll in diesem Zusammenhang außerdem auf die Frage gerichtet werden, inwieweit die Akteure im demokratischen System der jeweiligen Einzelstaaten Rechenschaft über ihre Tätigkeiten auf europäischer Ebene ablegten und inwieweit sie einer demokratischen Kontrolle unterlagen.
Insgesamt ist stets ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, worin genau jeweils die Antriebskräfte für eine engere Kooperation der EG-Staaten bestanden und woraus sich besondere Schwierigkeiten ergaben. Zusammenfassend kann auf dieser Grundlage eine Abwägung erfolgen, welcher der klassischen politikwissenschaftlichen Theoriestränge zur europäischen Integration – Neofunktionalismus oder Intergouvernementalismus23 – für den betrachteten Themenbereich eher überzeugende Erklärungsansätze bietet.
Die Gliederung des Buches verbindet chronologische und systematische Gesichtspunkte: In einem hinführenden Kapitel (2.) werden zunächst zentrale Kontexte der 1970er Jahre, und damit auch ge...