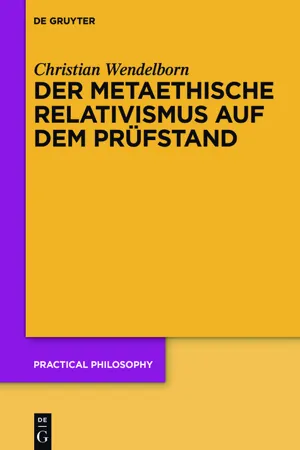![]()
1Einleitung
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, den metaethischen Relativismus auf den Prüfstand zu stellen. Zum einen untersuche ich, ob einige der zentralen Argumente gegen einen moralischen Objektivismus überzeugend sind und eine Rechtfertigung dafür bieten, den metaethischen Relativismus als alternative Position in Betracht zu ziehen. Zum anderen geht es mir um eine Auseinandersetzung mit der Annahme, der Relativismus stehe vor erheblichen theoretischen Schwierigkeiten, denen kaum begegnet werden könne.
Die beiden Ergebnisse meiner Arbeit lauten: 1. Zwei zentrale Überlegungen, die die Ablehnung des Objektivismus und die Frage nach dem Relativismus motivieren, lassen sich nicht in überzeugende Argumente ummünzen. Eine Überlegung lässt jedoch durchaus einen begründeten Zweifel am moralischen Objektivismus zu und rechtfertigt die Suche nach einer alternativen metaethischen Theorie. 2. Der metaethische Relativismus bietet eine recht plausible alternative Theorie unserer moralischen Praxis, die in relevanter Hinsicht nicht-revisionär ist. Entgegen der Einschätzung vieler Philosophen steht der Relativismus nicht von vornherein vor unüberwindbaren theoretischen Schwierigkeiten.
1.1Motivation für die Arbeit
Die Motivation für meine Untersuchung speist sich aus einer bemerkenswerten Beobachtung: Einerseits erfreut sich die Ansicht, dass die Moral irgendwie relativ ist und dass moralische Fragen keine objektiven Antworten haben, außerhalb philosophischer Fachkreise großer Beliebtheit. Viele Menschen scheinen relativistische Intuitionen bezüglich der Moral zu haben, auch wenn sie diese Intuitionen nicht immer in systematischer Weise artikulieren können.
Andererseits jedoch hat der Relativismus keinen guten Stand innerhalb der philosophischen Diskussion. Der Relativismus wird zumeist in ein paar Sätzen als völlig unplausibel beiseite geschoben. So wird oft angeführt, dass der Relativismus eine sehr kontraintuitive Implikation habe, von der dann angenommen wird, dass sie den Relativismus ins philosophische Abseits bringt: Fälle, die wir als moralische Meinungsverschiedenheiten verstehen, sind im relativistischen Bild nicht mehr als Meinungsverschiedenheiten zu verstehen, da in diesem Bild die Disputanten nur noch darüber sprechen, was ihre je eigene Moral als richtig oder falsch bestimmt.
Bemerkenswert ist nun, dass – zumindest meiner Erfahrung nach – viele Menschen mit relativistischen Neigungen mehr oder weniger unbeeindruckt von dieser philosophischen Kritik bleiben. Und das nicht, wie ich denke, weil sie starrsinnig sind, sondern weil sie den Eindruck haben, dass mit dieser Kritik letztlich nicht viel über ihre eigene relativistische Intuition ausgesagt ist. Denn zum einen ändert die (angebliche) Tatsache, dass der Relativismus eine kontraintuitive Implikation hat, nichts an ihrem Eindruck, dass der moralische Objektivismus unplausibel ist.1 Zum anderen haben sie das Gefühl, dass ihnen der Philosoph hier eine Position anbietet, die ihre – wie sie möglicherweise zugeben würden – unklare relativistische Intuition nicht angemessen auf den Punkt bringt. Der Relativismus wird in der Metaethik zumeist als Kontextualismus präsentiert, wonach z.B. das moralische Urteil „Abtreibung ist moralisch falsch“ je nachdem, wer urteilt, eine unterschiedliche Bedeutung haben kann. Dieser spezifisch semantischen These zufolge urteilen oder sprechen moralisch Urteilende letztlich aneinander vorbei. Ich habe es nun sehr oft erlebt, dass Studierende, die ihre relativistische Neigung kenntlich gemacht haben, auf diese These reagieren, indem sie sagen: „Das ist eigentlich nicht das, was ich mit Relativismus meine!“ Auch wenn sie auf Nachfragen oftmals ihre Intuition nicht klar artikulieren konnten, so wurde doch deutlich, dass sie unter Relativismus eine Position verstehen, die divergierende moralische Urteile sowohl als relativ als auch als divergierend begreift. Diese Intuition wird auch in der Philosophie oft mit dem Stichwort „irrtumsfreie Meinungsverschiedenheiten“ auf den Punkt gebracht: Angenommen wird damit, dass sich Menschen in moralischen Fragen uneinig sein können, obwohl keiner der Opponenten einem Irrtum unterliegt. Dass alles andere als klar ist, wie diese Intuition konsistent artikuliert werden kann, ändert zunächst einmal nichts an der Tatsache, dass der Relativismus, der in der Metaethik diskutiert wird, diese Intuition gar nicht auf den Punkt zu bringen scheint.
Die Position, die in der Metaethik als Relativismus bezeichnet wird, befindet sich demnach in einer misslichen Lage: Einerseits beschränkt sich das philosophische Interesse an dieser Position überwiegend darauf, ihre manifeste Falschheit zu demonstrieren. Andererseits scheinen die weit verbreiteten Zweifel am moralischen Objektivismus relativistische Intuitionen zu nähren, die diese Position scheinbar ohnehin nicht angemessen artikuliert. Ein zentrales Anliegen meiner Arbeit ist es deshalb, zu prüfen, ob der metaethische Relativismus aus dieser Lage befreit werden kann. Ist es möglich, eine theoretisch ernstzunehmende und plausible relativistische Analyse moralischer Urteile zu bieten, die zugleich die (vortheoretische) relativistische Intuition vieler Menschen angemessen artikulieren kann?
1.2Argumente gegen den Objektivismus
Bevor ich jedoch in meiner Arbeit dieses Anliegen verfolge, möchte ich die Motive für die relativistische Intuition untersuchen und der Frage nachgehen, ob sich aus ihnen philosophisch haltbare oder überzeugende Argumente ergeben. Ich denke, dass die relativistische Intuition vieler Menschen zunächst und vor allem eine anti-objektivistische Intuition ist. Der moralische Objektivismus ist in den Augen vieler abwegig oder nicht haltbar.
Zwei Motive scheinen mir dabei eine zentrale Rolle zu spielen: Erstens stellt die Existenz von weit verbreiteten und tiefgreifenden moralischen Meinungsverschiedenheiten wohl eines der Hauptmotive für den Zweifel am moralischen Objektivismus dar. Wie kann es sein, dass Menschen so grundlegende und scheinbar unauflösbare moralische Meinungsverschiedenheiten haben, wenn es doch objektive Antworten auf moralische Fragen gibt?
Zweitens besteht ein Unbehagen bezüglich der mit dem Objektivismus assoziierten Annahme, die Moral habe eine spezifische Autorität über Handelnde. Diese Annahme wird oft auf den Punkt gebracht, indem gesagt wird, dass moralische Fakten oder Tatsachen Gründe für Handlungen geben. Anders gesagt: Wenn es für jemanden moralisch falsch ist, eine bestimmte Handlung auszuführen, dann hat er einen normativen Grund, diese Handlung zu unterlassen. Es ist nun allerdings eine weit verbreitete Vorstellung, dass Gründe für Handlungen instrumentalistisch zu verstehen sind, Gründe also letztlich immer von den Wünschen der Handelnden abhängen.Warum sollte jemand einen Grund für eine Handlung haben, wenn diese Handlung keinen einzigen seiner Wünsche zu erfüllen hilft? Wie soll es Gründe für Handlungen geben, die unabhängig von den Wünschen der jeweils Handelnden sind? Wenn es aber keine wunschunabhängigen Gründe gibt, dann muss die Moral entweder auch wunschabhängig sein – in dem Sinne, dass es für jemanden nur dann moralisch richtig ist, eine Handlung auszuführen, wenn diese Handlung dazu beiträgt, einen seiner Wünsche zu erfüllen – oder die Moral gibt von sich aus keine Gründe zum Handeln. Beide Optionen sind aber kaum mit dem common-sense-Verständnis der Objektivität der Moral vereinbar: Die Objektivität der Moral schließt aus, dass moralische Richtigkeit und Falschheit notwendig von den Wünschen Handelnder abhängen und dass moralische Richtigkeit und Falschheit nicht von sich aus, d.h. intrinsisch, normativ oder autoritativ im Sinne von „Gründe-gebend“ sind.
Im ersten Teil meiner Arbeit werde ich untersuchen, ob die genannten beiden Motive in philosophische Argumente übersetzt werden können, die überzeugend sind. Den moralischen Objektivismus werde ich als eine metaethische Position verstehen, die versucht, ein vortheoretisches Verständnis einer objektiven Moral auf den Punkt zu bringen. Diesem Verständnis zufolge müsste für eine objekti ve Moral gelten, dass bestimmte Handlungen in bestimmten Situationen wirklich und unabhängig davon, aus welcher Perspektive man schaut, unterlassen oder getan werden müssen. Moralische Forderungen müssten demnach, will man die Moral denn als spezifische objektive Autorität begreifen, einen besonderen Handlungsdruck auf ihre Adressaten ausüben, einen Handlungsdruck, der wirklich und unabhängig von den Adressaten und denjenigen, die diese Forderungen „zitieren“ (also die moralisch Urteilenden), besteht. Diese ontologische Voraussetzung eines objektivistischen Moralverständnisses lässt sich philosophisch mit dem Begriff der „wunschunabhängigen Normativität“ moralischer Werte oder Tatsachen theoretisch fassen, wobei „wunschunabhängig“ hier bedeutet, dass die mit einer moralischen Forderung verbundene Normativität – ihre Gründe-gebende Kraft – nicht von entsprechenden Wünschen der Adressaten abhängig ist. In Verbindung mit einer semantischen und einer erkenntnistheoretischen These ergibt sich daraus die z.B. in der Aussage „Es ist einfach so, dass Person P Handlung h aus moralischen Gründen unterlassen muss“ zum Ausdruck kommende Ansicht des moralischen Objektivisten: (i)Moralisch Urteilende versuchen moralische Tatsachen mit einer spezifischen Normativität zu erkennen,(ii) es gibt solche Tatsachen und (iii) manchmal erkennen moralische Urteilende diese Tatsachen tatsächlich.
1.3Metaethischer Relativismus
Ganz unabhängig davon, wie sie zu der Frage stehen, ob Zweifel am moralischen Objektivismus angebracht sind, sind sich die meisten Philosophen darin einig, dass relativistische Entwürfe, wie Thomas Schmidt es formuliert, „von Anfang an mit erheblichen theoretischen Hypotheken belastet sind: Anhänger relativistischer Positionen stehen vor theoretischen Schwierigkeiten, von denen fraglich ist, ob ihnen begegnet werden kann.“2 So sind sich moralische Objektivisten mit Irrtumstheoretikern und Non-Kognitivisten darüber einig, dass der Relativismus in der Metaethik keine ernstzunehmende Position ist.3 Obwohl die Frage nach dem Relativismus die Moralphilosophie seit ihren Anfängen begleitet und auch oftmals als eine der zentralen Herausforderungen für das Nachdenken über Moral bezeichnet wird,4 ist die Auseinandersetzung mit dem Relativismus in der zeitgenössischen metaethischen Diskussion zumeist schnell beendet. Das liegt daran, dass der Relativismus in Form der oben genannten semantischen These auf den Punkt gebracht wird, welcher dann mit sprachphilosophischen Überlegungen ihre theoretischen Schwierigkeiten und vermeintliche Unplausibilität nachgewiesen wird. Der Relativismus wird damit auf eine Position festgelegt, die man auch als indexikalischen Kontextualismus bezeichnet. Für einen moralischen Satz wie „Abtreibung ist moralisch falsch“, den eine Person P in einem Kontext C ausdrückt, gilt diesem indexikalischen Kontextualismus zufolge:
Indexikalischer Kontextualismus: Wenn S der moralische Standard der Person P ist, die in C den Satz äußert, dann drückt diese Person P in C die Proposition aus, dass Abtreibung relativ zu Standard S moralisch falsch ist.
Das folgende Argument kann man als Standard-Argument gegen diese Form des metaethischen Relativismus bezeichnen: Wenn zwei Personen P und P* jeweils unterschiedliche Standards haben und P urteilt, dass Abtreibung moralisch falsch ist, und P* urteilt, dass Abtreibung nicht moralisch falsch ist, dann drücken beide Personen Propositionen aus, die miteinander vereinbar sind – ergo haben sie keine Meinungsverschiedenheit. Es scheint aber doch offensichtlich zu sein, dass P und P* unterschiedlicher Meinung bezüglich des moralischen Status von Abtreibung sind, wenn sie die genannten Urteile fällen. Daraus, dass der Kontextualismus diese kontra-intuitive Implikation hat, schließen die meisten Gegner des Relativismus, dass seine semantische Analyse schlicht falsch ist.
Der zweite Teil meiner Arbeit setzt nun an neueren Entwicklungen in der sprachphilosophischen Debatte um den Relativismus an. Denn dem indexikalischen Kontextualismus stehen neue Entwürfe von relativistischen Theorien gegenüber, die gerade mit dem Anspruch antreten, das – wie ich es nennen werde – „Problem der verlorenen Meinungsverschiedenheit“ lösen zu können. So haben etwa Berit Brogaard, John MacFarlane, Max Kölbel und Peter Lasersohn relativistische Ansätze mit dem Anspruch entwickelt, die theoretischen Probleme des Kontextualismus in verschiedenen Diskursbereichen zu vermeiden.5 Diese neuen Entwürfe sind zwar nicht primär bzw. nicht alle im Kontext der Frage nach einem plausiblen metaethischen Relativismus angesiedelt, sie sind aber auch für diese Frage einschlägig. Im deutschsprachigen Raum werden diese Theorien jedoch kaum in metaethischen Zusammenhängen diskutiert. Der metaethische Relativismus wird hier fast ausschließlich als indexikalischer Kontextualismus verstanden und kritisiert.6
Ich möchte mich daher im zweiten Teil mit den auch als genuin relativistisch bezeichneten Entwürfen vor allem im Hinblick auf die Frage nach einem metaethischen Relativismus und dem Problem der verlorenen Meinungsverschiedenheit auseinandersetzen. Allerdings ist die Theorienlandschaft mittlerweile einigermaßen unübersichtlich, so dass ich zunächst eine Taxonomie verschiedener Positionen vorstelle. Ich werde dann zwei Theorien – den nicht-indexikalischen Kontextualismus und den Wahrheits-Relativismus –, die sich vom indexikalischen Kontextualismus abgrenzen lassen, daraufhin untersuchen, ob sie das Problem der verlorenen Meinungsverschiedenheit lösen können. Dabei werde ich den nicht-indexikalischen Kontextualismus in idealtypischer Form und den Wahrheits-Relativismus anhand des konkreten Entwurfs von John MacFarlane diskutieren.
Auch wenn, wie ich darstellen werde, der Wahrheits-Relativismus von MacFarlane das Problem der verlorenen Meinungsverschiedenheit auf gewisse Art und für meine Fragestellung angemessen lösen kann, möchte ich zeigen, dass es letztlich unnötig ist, den Weg mit den neueren Relativisten in unorthodoxe semantische Gefilde anzutreten.
Neben diesen neuen relativistischen Entwürfen ist nämlich auch ein interessanter Ansatz entwickelt worden, der, wie ich denke, den indexikalischen Kontextualismus wieder in die Debatte zurückholt. Gunnar Björnsson und Stephen Finlay haben eine instruktive Strategie entwickelt, wie der metaethische Kontextualist mit dem Problem der verlorenen Meinungsverschiedenheit plausibel umgehen kann. Sie verfolgen dabei das Projekt, aufzuzeigen, dass der Kontextualismus eine nicht-revisionäre Theorie unserer moralischen Praxis zu bieten hat. Unter einer „nicht-revisionären metaethischen Theorie“ möchte ich eine Theorie bezeichnen, die unsere moralische Praxis und unsere moralische Sprache im Großen und Ganzen rechtfertigen kann und sie nicht als wesentlich defizitär oder irrtumsbehaftet verstehen muss. Ich möchte aufzeigen, dass Björnssons und Finlays Ansatz die Ressou...