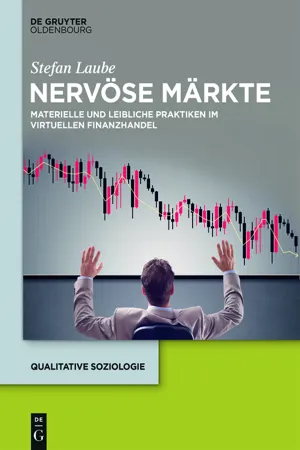![]()
1Einleitung: Wie beobachtet der Finanzhandel den Markt?
Finanzmärkte der Gegenwart sind kein Betätigungsfeld für Computerverweigerer. Wären Sie ein Finanzhändler, bestünde das von Ihnen und Ihren HändlerkollegInnen genutzte Büro auf den ersten Blick aus nichts als Bildschirmen. Vor Ihrem Gesichtsfeld türmten sich mindestens vier Monitore auf. Auf Ihrem Trading Desk tummelte sich eine Vielzahl von Tastaturen und Computermäusen. Sie sollten zudem, hätten Sie diesen Beruf gewählt, nicht auf ein informationsarmes Arbeitsumfeld eingestellt sein, denn zu Ihrem Inventar gehörte ein Reuters-Cobra-Monitor. Dieser Bildschirm visualisierte laufend und in Echt-Zeit die Preisfluktuationen der Finanzprodukte, die Sie handelten. Bereits der Blick auf nur einen kleinen Ausschnitt dieses Monitors verdeutlicht die Informationsvielfalt, der sich FinanzhändlerInnen tagtäglich, minütlich und sekündlich gegenübersehen. Neben den Preisschwankungen als allgegenwärtigem rotem bzw. grünem Blinken oder als sich ständig bewegenden Kurven liefert ein eigenes Fenster Nachrichtenmeldungen im Sekundentakt: „UBS STUFT PAION<PA8G.DE> HERUNTER AUF „NEUTRAL“ VON „BUY“, KURSZIEL 3,80 (ZUVOR 12) EURO“1. Die Oberfläche des Finanzbildschirms steht nie still, sondern versorgt HändlerInnen ununterbrochen mit neuen Marktinformationen.
Digitale Informations- und Kommunikationstechnologien sind in den Finanzmärkten unserer Zeit allgegenwärtig. Deshalb betrachten einige SozialwissenschaftlerInnen Wissen, Information und Technologie als Kernelemente gegenwärtiger Finanzmärkte und plädieren für Untersuchungsansätze, die diesem gegenüber Produktionsmärkten sehr viel stärker ausgeprägten Merkmal gerecht werden (z. B. Knorr Cetina 2007). In der Tat kann man Finanzmärkte als paradigmatisches Phänomen der Wissensgesellschaft betrachten. Innerhalb der Soziologie ist man sich weitgehend einig, dass das besondere Kennzeichen von Wissensgesellschaften in einem zunehmenden Bedeutungszuwachs von Expertenwissen und Technologien besteht (Bell 1975). Demnach dringen wissenschaftliches Wissen, aber auch Expertenwissen und damit verflochtene Informations- sowie Kommunikationstechnologien immer mehr in alle Bereiche des sozialen Lebens ein (Drucker 1993; Stehr 1994). Gleichzeitig können zeitgenössische Finanzmärkte auch als Paradefall einer gesamtgesellschaftlichen Mediatisierung gelten, worunter der Prozess der steigenden Prägung von Kultur und Gesellschaft durch Medienkommunikation zu verstehen ist (Finnemann 2011; Krotz 2007). Soziale Welten sind infolgedessen zunehmend mediatisierte Welten, so sich in ihnen die relevanten Formen gesellschaftlicher Praktiken und kultureller Sinngebung untrennbar mit Medientechnologien verschränkt haben.
Abb. 1: Ausschnitt eines Bildschirms im Derivatehandel (eigene Darstellung).
Die vorliegende Arbeit thematisiert die Digitalisierung, Informationalisierung und Mediatisierung von Finanzmärkten im Kontext der tagtäglichen Arbeitspraktiken ihrer Teilnehmenden. Basierend auf einer ethnografischen Studie untersucht sie eine zunächst wenig komplex erscheinende Ausgangsfrage: Wie vollzieht der Finanzhandel die Beobachtung und Bearbeitung von Marktinformation unter den Bedingungen seiner fortschreitenden Mediatisierung?
Angesichts der massiven Präsenz von Bildschirmen wäre es verlockend, digitalen Technologien einen wesentlichen Anteil an der Beobachtung der Märkte zuzuschreiben. In der Tat betont ein wichtiger Strang der finanzsoziologischen Forschung die Relevanz digitaler Technologien in Finanzmärkten. Allerdings wäre es gerade aus soziologischer Sicht ebenso naheliegend, die Beobachtung und Bearbeitung digitaler Finanzmarktinformation am kognitiven Wissen von Personen festzumachen. Der auf Außenstehende chaotisch wirkenden, bildschirmvermittelten Marktrealität essenzielle Informationen zu entlocken, gelänge unter diesem Blickwinkel aufgrund der spezialisierten Wissensvorräte einzelner Finanzhändler.
In diesem Buch gehe ich entgegen vorschnellen Festlegungen davon aus, dass es eine offene und empirisch erst zu klärende Frage ist, wie digitale Finanzinformationen beobachtet und bearbeitet werden. Daher ist zunächst einmal zu prüfen, wer oder was überhaupt die Teilnehmenden dieser Praxis sind. Einen ersten Hinweis darauf, dass die Marktbeobachtungspraxis im Finanzhandel nicht nur Technologien und menschliche Kognition umfasst, liefert ein Ausschnitt aus meinen ethnografischen Feldnotizen. Im Mittelpunkt stehen Beschreibungen des Verhaltens von DerivatehändlerInnen kurz nach dem blitzartigen Absacken der Echtzeit-Preiskurve auf den Oberflächen ihrer Reuters-Monitore:
Heute verbrachte ich den gesamten Vormittag am Desk eines Derivatehändlers. Mitten in unserem Gespräch begann er plötzlich so laut zu brüllen, dass es deutlich im ganzen Handelsraum wahrnehmbar war. „Der Dax! Der Dax!“ Nur Sekundenbruchteile später schrien auch mehrere andere Händler „Dax!“ und „Im Minus“! Auch glaube ich Ausrufe wie „Hoooooi! Hooooi!“ gehört zu haben. Der Händler an meiner Seite sprang aus seinem Stuhl und verfolgte nun stehend die Talfahrt der Preiskurve auf seinem Reuters-Schirm. Seinen Oberkörper und Kopf beugte er vornüber, bis seine Nase nur mehr zehn Zentimeter entfernt vom Bildschirm war. Zwei-, dreimal wippte er dabei mit den Knien. Nach zwei oder drei Sekunden stoppte die Minusbewegung der Preiskurve. Nun hörte ich keine Rufe mehr, der Händler setzte sich wieder auf seinen Stuhl und atmete hörbar durch.
Die Laute und Körperbewegungen, die ich an diesen und an fast allen darauffolgenden Tagen im Handelsraum beobachten konnte, sind Elemente dessen, was ich Aufmerksamkeitsrufe nenne. Aufmerksamkeitsrufe sind ein zentraler Bestandteil des praktischen Vermögens im Derivatehandel, denn sie sind unabdingbar zur Bewältigung der Beobachtung dieses extrem volatilen und temporeichen Finanzmarkts. Wie die Feldnotizen zeigen, sind nicht nur diverse Bildschirmtechnologien an dieser Tätigkeit beteiligt, sondern auch spezifische Laute und Rufe („Der Dax!“) sowie Körperbewegungen. In der oben beschriebenen Szene verfolgt mein Händlerinformant die Finanzpreise auf seinem Reuters-Schirm nicht nur mit seinen Augen, vielmehr beteiligt er auch seinen Körper in beträchtlichem Ausmaß an der Marktbeobachtung. Nicht nur äußert er in Reaktion auf fluktuierende Preise am Bildschirm spezifische Laute, auch seine Bewegungen spiegeln das, was sich abspielt, gestisch wider. Der Händler steht auf, beugt sich nach vorne in Richtung Bildschirm, wippt mit den Knien. Kurz: Sein ganzer Körper ist in die Darstellung des Marktereignisses involviert.
Die Beteiligung der Stimme und des Körpers von Finanzhändlern ist weder eine banale Tatsache noch eine Randerscheinung. Das Besondere am bildschirmvermittelten Finanzhandel ist vielmehr, dass er sich in Informationstechnologien und numerischen Symbolen nicht erschöpft. Die grundlegende These der vorliegenden Untersuchung ist, dass Marktbeobachtung und Informationsgewinnung in modernen Finanzmärkten ein spezifisches praktisches Wissen und Können umfassen, die über teletechnologische Preisdarstellungen hinausgehen. Besonderes Gewicht erhalten im Rahmen der Marktbeobachtungskompetenz der Körper von Finanzhändlern ebenso wie leibliche Emotionen und – nicht zu vergessen – der Markt selbst. In der natürlichen Sprache des Derivatehandels ist der Derivatemarkt eine ganz bestimmte, sich von anderen Finanzmärkten unterscheidende, „nervöse“ und bisweilen „verrückte“ ‚Kreatur‘. Folgt man dem Handelsraumdiskurs, ist diese Kreatur jedenfalls zu wichtig, um sie als Akteur im Rahmen der Beobachtung und Bearbeitung bildschirmvermittelter Finanzpreise zu ignorieren.
1.1Soziologie der Praktiken
Wenn ich bislang von ‚Praxis‘ und ‚Praktiken‘ gesprochen habe, so habe ich das ohne nähere Erläuterung getan. In einem praxistheoretischen Verständnis meint der Ausdruck ‚Praxis‘ entgegen der umgangssprachlichen Bedeutung nicht den Gegensatz von Theorie noch von behaupteten oder beschriebenen, tatsächlich aber unterbliebenen Tätigkeiten.2Aus der Perspektive sozialwissenschaftlicher Praxistheorien sind ‚Praktiken‘ habitualisierte Tätigkeiten, deren Wissen durch die Handelnden buchstäblich inkorporiert ist und die den Gebrauch materieller Artefakte und unsere Beziehungen zu Objekten fundieren. Sozialität entsteht praxistheoretisch gesehen über die Teilhabe an sozialen Praktiken, wobei letztere sowohl Personen als auch nichtmenschliche Akteure beteiligen können: Wer oder was im Rahmen sozialer Praktiken handelt, ist damit eine fall- und kontextabhängige Frage.
Aus dieser kurzen Charakterisierung ergeben sich bereits deutliche Differenzen zu anderen Sozialtheorien. Ein Verständnis des Sozialen als Praxis kann laut Reckwitz (2003: 286) abgegrenzt werden von einem sozialtheoretischen „Mentalismus“, der das Soziale als kognitive Sinnschemata, als Bedeutungszuschreibungen oder als Weltbilder charakterisiert. Das Soziale als Praxis zu verstehen, unterscheidet sich auch von einem sozialtheoretischen „Textualismus“, der das Soziale „auf der Ebene von Texten, von Diskursen, von öffentlichen Symbolen und schließlich von Kommunikation (im Sinne von Luhmann)“ (Reckwitz 2003: 286) begreift. Im Fokus eines praxistheoretischen Verständnisses des Sozialen stehen hingegen soziale Praktiken, die von einem praktischen Wissen und Können (einem Know-how) und der Mitwirkung von materiellen Artefakten und Objekten getragen werden.
Theorien sozialer Praktiken bilden keine einheitliche Sozialtheorie, sondern „eher ein Bündel von Theorien mit Familienähnlichkeit“ (Reckwitz 2003: 283). Gerade ihre Vielfalt und Heterogenität sind eines ihrer identitätsstiftenden Merkmale (vgl. Laube/Schönian 2013). Zum einen sind die historischen Wurzeln der Praxistheorien vielfältig und lassen sich nicht auf einzelne Gründerfiguren zurückführen.3Zum anderen besteht (noch) keine Einigkeit, welche Theorien in der Soziologie praxistheoretische Merkmale im Sinn der oben gegebenen Charakterisierung aufweisen. Bislang wurden als soziologische Praxistheorien v. a. die Ansätze von Bourdieu, Giddens, Foucault, Latour, Garfinkel und Goffman rezipiert (vgl. Reckwitz 2003; Schäfer 2013; Schmidt 2012).
Ihre Heterogenität sowie die enge Verschränkung mit empirischen Forschungsinteressen4sind Besonderheiten, die nahelegen, Theorien sozialer Praktiken in erster Linie als spezifische Forschungshaltung und nicht (nur) als Theorieangebot zu begreifen (vgl. Schmidt 2012: 31). Im Folgenden umreiße ich daher vier Schwerpunkte einer praxistheoretischen Forschungshaltung und skizziere ihre jeweilige Relevanz für die vorliegende Untersuchung:
(a) Der praktische Vollzug sozialen Handelns und seine impliziten Grundlagen sind soziologisch mindestens ebenso aufschlussreich wie die Intentionen der Handelnden oder die expliziten Regeln sozialen Handelns. Dieser erste Schwerpunkt ergibt sich aus der Einsicht, dass Handlungen nicht vollständig von ausdrücklichen Regeln oder ausdrückbarem Wissen bestimmt werden, sondern von impliziten Handlungslogiken. Solche routinisierten „doings and sayings“ (Schatzki 1996: 89) sind nicht das Ergebnis der individuellen Leistungen von Akteuren (z. B. von Finanzhändlern), sondern werden in Relation zu konkreten Situationen und spezifischen Handlungskontexten gleichsam unwillkürlich bzw. ohne strategische Planung vollzogen. Die Art und Weise dieses Vollzugs ist soziologisch aufschlussreich und keine Restgröße von Handlungen. Auf welche Weise Praktiken ausgeführt werden, kann Gegenstand sozialer Konflikte und historischer Transformationen (Pinch/Bijker 1989; Shove et al. 2012) oder Mittelpunkt divergierender soziokultureller Klassifizierungen (vgl. Schmidt 2008) sein. Macht beispielsweise ein gesellschaftlicher Bereich wie der Finanzhandel implizit, aber erheblich von den Körpern seiner Akteure Gebrauch, bildet dies ein Spezifikum, das nicht in den Blick gerät, wenn die soziologische Analyse nur auf dem Handeln vorgelagerte Wissensbestände, Intentionen, Deutungsschemata, soziale Regeln usw. gerichtet ist.
(b) Soziale Welten beherbergen nicht nur menschliche Teilnehmer, sondern auch Objekte, Artefakte und Leiber. Einzelne SozialwissenschaftlerInnen stellten die Annahme, wonach die Sozialwelt nur von menschlichen Teilnehmern bevölkert wird, vergleichsweise früh infrage (Luckmann 1970: 93). Empirische Analysen und konzeptuelle Studien der Bedeutung von nichtmenschlichen Akteuren und Artefakten in sozialen Zusammenhängen verdanken sich bislang insbesondere praxistheoretisch inspirierten Untersuchungen in den Science and Technology Studies (Knorr Cetina 1984; Latour/Woolgar 1986; Traweek 1988). Nimmt man diese Ergebnisse ernst, ist Sozialität jedenfalls als Aktivität mit verschiedenartigen „Partizipanden“ (Hirschauer 2004) zu begreifen: Dazu zählen nicht nur Personen, sondern auch (ihre) Objekte und Körper. Dabei ist zu beachten, dass die Teilnehmenden von Praktiken nicht nur über einen materiellen Körper verfügen, den sie als Handlungsträger mobilisieren können, sondern auch über einen Leib. Aus diesem Grund erweitert die vorliegende Untersuchung die Körpersensibilität der Praxistheorien mit der Unterscheidung zwischen materiellen und leiblichen Praktiken. Leibliche Praktiken beziehen sich nicht auf die physisch-tätige Seite von Handlungsvollzügen, sondern auf die sinnlichen und affektiven Komponenten körperlichen Erlebens (vgl. Katz 1999). Für die Untersuchung der Marktbeobachtungspraxis ist es in diesem Sinn wichtig, den Kreis der relevanten Akteure nicht von vornherein einzuschränken. Es bedarf der Sensibilität für die Beteiligung von Finanzbildschirmen, des Körpers und des Leibs von Finanzhändlern oder auch von Finanzmärkten als quasi-sozialen Akteuren. Ob und inwieweit diese verschiedenartigen Partizipanden im Rahmen des Finanzhandels maßgeblich werden, ob und inwiefern ihnen Handlungsträgerschaft zugeschrieben wird, ist eine zentrale Forschungsfrage der vorliegenden Studie.
(c) Die symbolische Dimension des Sozialen ist verknüpft mit der materiellen und leiblichen Dimension des Sozialen. Ein Verständnis von Kultur als Praxis konzipiert Kultur nicht als Wissen, das die Interpretation von Erfahrungen und die Ausführung von Handlungen oder Entscheidungen anleitet. Es beschreibt hingegen Wissen als einen dem Handeln eingelagerten Prozess und wendet sich gegen eine Marginalisierung der praktischen Ausführung von Handlungen als einer ihnen nachgelagerten Endstufe. So werden Wissen, Symbole und Bedeutungen nicht als getrennt von der materiellen Dimension von Praktiken begriffen, sondern auf vielfältige Weisen mit ihr verknüpft (vgl. Knorr Cetina 2002: 22). Praxistheorien sind damit keineswegs, wie ihnen bisweilen vorgehalten wurde, behavioristisch, indem sie sich nur für äußerlich beobachtbare Verhaltensroutinen interessieren (Schulz-Schaeffer 2010). Vielmehr bieten gerade Praxistheorien Möglichkeiten der Integration von symbolischen und materiellen sowie leiblichen Dimensionen des Sozialen. Für die vorliegende Arbeit stimuliert ein praxistheoretisches Kulturverständnis die Hypothese, dass die im Finanzhandel präsenten symbolischen Klassifikationen von Finanzmärkten spezifische materielle und leibliche Praktiken der Beobachtung dieser Märkte implizieren. Diese Hypothese zu untermauern erfordert, dass das Wissen des Finanzhandels nicht nur auf der Ebene kognitiver Wahrnehmungs- und Deutungsweisen, sondern auch in Relation zu materiellen und leiblichen Dimensionen des Finanzhandels untersucht wird.
(d) Teilnehmerwissen und Teilnehmerkönnerschaft entfalten sich in situierten und kontextspezifischen Praktiken. An die Praxistheorie als Forschungsverfahren wird ein doppelter Anspruch gestellt: zum einen die Kultivierung einer Methode der empirischen Sozialforschung, die geeignet ist, die Situiertheit und Kontextgebundenheit von Praktiken zu erfassen, ohne deren Berücksichtigung die Gefahr von „intellektualistischen Projektionen“ (Schmidt 2006: 316) besteht; zum anderen die Reflexion der Konstruktionsleistung der eigenen wissenschaftlichen Forschungsmethoden. Praxistheoretisches Denken richtet sich gegen eine Konzeption von Wissenschaft, die die Körper, Kontexte und Situiertheiten von Wissenschaftlern ausklammert und so tut, als entstünden wissenschaftliche Erkenntnisse aus einer Vogelperspektive, einem „gaze from nowhere“ (Haraway 1988: 581). Um nicht dieser Idealisierung des wissenschaftlichen Subjekts aufzusitzen, reflektiert Kapitel 2 die der vorliegende Studie zugrunde liegende ethnografische Feldforschung selbst als situierte und kontextgebundene soziale Praxis.
1.2Finanzmärkte als Gegenstand der Soziologie
Abgesehen von sehr frühen Arbeiten (Weber 2000 [1894]) sind Finanzmärkte erst in jüngster Vergangenheit wieder ein Thema soziologischer Forschung. Davon zeugen einschlägige Handbuchpublikationen (Knorr Cetina/Preda 2012), Herausgeberbände in englischer Sprache (Callon et al. 2007; Knorr Cetina/Preda 2005) und in deutscher (Kalthoff/Vormbusch 2012; Kraemer/Nessel 2012; Langenohl/Wetzel 2014) sowie Rezensionen finanzsoziologischer Forschung (Arminen 2010; Carruthers/Kim 2011, Preda 2007a). Daneben zeigen Lehrveranstaltungen5und Professuren, die explizit der Soziologie der Finanzmärkte gewidmet sind, dass die Beschäftigung mit Finanzmärkten innerhalb der Disziplin erste Institutionalisierungserfolge erzielt.
Sowohl Fremd- als auch Selbstzuordnungen der wissenschaftlichen Akteure lassen eine Differenzierung der Finanzsoziologie in zwei Richtungen erkennen: einerseits die Social Studies of Finance und andererseits eine dezidiert wirtschaftssoziologische Finanzmarktforschung. Bei den Social Studies of Finance handelt es sich um ein multidisziplinäres Forschungsgebiet, das beeinflusst von den Science and Technology Studies wissensbezogene Prozesse und Praktiken in Finanzbereichen untersucht. Kontinuitäten zwischen den beiden Feldern ergeben sich hierbei nicht nur durch einzelne Personen (u. a. Michel Callon, Donald MacKenzie, Karin Knorr Cetina), sondern insbesondere durch die praxistheoretische Fundierung der Forschung. Neben den Social Studies of Finance haben in den letzten Jahren aber auch Forschungsarbeiten, die Finanzmärkte explizit m...