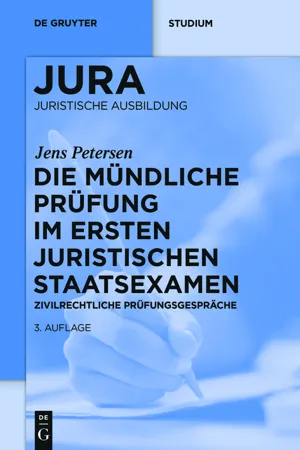
eBook - ePub
Die mündliche Prüfung im ersten juristischen Staatsexamen
Zivilrechtliche Prüfungsgespräche
- 179 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die mündliche Prüfung im ersten juristischen Staatsexamen
Zivilrechtliche Prüfungsgespräche
Über dieses Buch
Dieses Buch dient der Vorbereitung der mündlichen Staatsprüfung.Für alle Arten der mündlichen Prüfung werden konkrete Handlungsempfehlungen aufgezeigt. Skizzierte Prüfungsgespräche ermöglichen zudem die Wiederholung des Pflichtfachstoffs.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die mündliche Prüfung im ersten juristischen Staatsexamen von Jens Petersen im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Law & Law Theory & Practice. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil II:Die Prüfungsgespräche
I.Vorbemerkung zu den folgenden Prüfungsgesprächen
Die im folgenden Teil skizzierten Prüfungsgespräche sind ersichtlich nicht authentisch. Sie mögen sogar in verschiedener Hinsicht etwas Künstliches haben. Zum ersten erscheinen sie der im vorherigen Abschnitt dargestellten Prüfungsatmosphäre nicht im mindesten Rechnung zu tragen, weil sie ausnahmslos eine Zweierbeziehung Prüfer – Kandidat wiedergeben. Das der mündlichen Prüfung im Ersten Juristischen Staatsexamen Eigentümliche scheint damit gar nicht berührt zu werden. Es wäre jedoch darstellungsmäßig unzweckmäßig gewesen, einen fiktiven Dialog mit vier oder fünf Kandidaten vorzustellen. Der Leser würde den Überblick verlieren und man müsste, um die Atmosphäre auch nur einigermaßen authentisch zu machen, Fehler einzelner Kandidaten einstreuen. Da dies jedoch nur zu leicht dazu führen würde, dass man sich auch falsche Gesichtspunkte einprägt, sollen die Antworten des Kandidaten sich auf weitgehend Richtiges und allenfalls gelegentlich Unscharfes beschränken.
Damit ist der zweite Einwand, welcher gegen die vorliegenden Prüfungsgespräche vorgebracht werden könnte, angesprochen. So scheint es in hohem Maße idealisiert zu sein, dass der Kandidat weithin Richtiges äußert. Auch scheint es fern der Wirklichkeit und eher dem platonischen Dialog nachempfunden, praktisch ausnahmslos förderliche Antworten wiederzugeben. Schließlich könnte der Leser zu der Einsicht gelangen, dass er nicht einmal einen Bruchteil dessen wüsste, was Gegenstand der folgenden Gespräche ist, was letztlich geeignet ist, ihn vollständig zu desillusionieren. Dem ist entgegenzuhalten, dass auch und vor allem die Lektüre der Gespräche dort, wo sie bisweilen anstrengend anmuten, weil einer richtigen Antwort die nächste folgt, lehrreich sein kann. Denn der Zweck besteht dort nicht zuletzt darin, in Dialogform ein gewisses Grundwissen zu vermitteln. Natürlich ist die dargestellte Form nicht geeignet für die erstmalige Aneignung dieses Wissens. Daher werden ganz überwiegend Themen behandelt, die zu den eher klassischen gehören. Gerade dort werden nämlich in mündlichen Prüfungen die meisten Fehler gemacht, die deshalb auch als Grundlagenfehler gelten und die Benotung nachhaltig mindern. Ausgangspunkt der Prüfungen sind daher in den meisten Fällen klassische Entscheidungen, die zwar nicht immer im strengen Sinne gutachtlich gelöst werden, deren Lösung doch ganz überwiegend der Anspruchsmethode folgt. Mitunter werden jedoch auch ohne Zugrundeliegen eines Urteils oder Entscheidungsfalls klassische Probleme behandelt, welche zu den Grundproblemen des Zivilrechts gehören und deren Wissen und Kenntnis gemeinhin vorausgesetzt wird. Dabei handelt es sich zumeist um Bereiche, in denen die korrekte Lösung anhand des Gesetzes erfahrungsgemäß besondere Schwierigkeiten bereitet.
Ein besonderes Augenmerk verdienen die in kursiv gehaltenen Bemerkungen, die anders als sonst in juristischen Abhandlungen nicht nur den Zweck verfolgen, Nachweise aus Rechtsprechung und Schrifttum zu bringen. Es geht ihnen vor allem darum, den Leser dort anzusprechen, wo die Prüfung eine besondere Wendung nimmt. Ungeachtet der etwas idealisierten Darstellungsform sind die skizzierten Prüfungsgespräche nämlich von der Bemühung geprägt, einen gleichwohl typischen und authentischen Duktus der Wendungen, die ein Prüfungsgespräch nehmen kann, aufzuzeigen. Dabei sind es mitunter auch kleine Fallen, die vom Prüfer gestellt und vom Kandidaten als solche erkannt werden müssen.
Zum Schluss muss der Hoffnung Ausdruck verliehen werden, dass der Leser den beschriebenen Prüfer, der insoweit auch eher einem Idealtypus entspricht und damit in der Wirklichkeit nie in genau dieser Weise vorkommt, sondern sich immer nur annäherungsweise findet, nicht leichthin mit dem Autor identifiziert. Ebenso wenig, wie sich der Leser selbst mit dem Kandidaten wird identifizieren können, der ihm wohlmöglich aufgrund seiner fortgesetzt richtigen, weiterführenden, durchdachten Antworten ganz und gar unsympathisch ist, ist der Autor bestrebt, mit der Person des Prüfers sich selbst zu skizzieren. Nicht selten beruhen Verhaltensweisen und Nachfragen eher auf Beobachtungen und Erfahrungen anderer Prüfer in der konkreten Situation der mündlichen Prüfung. Nur auf diese Weise können die Gespräche überhaupt so etwas wie einen gemeinsamen Nenner darstellen, der ihre Lektüre lesenswert und instruktiv macht.
Endlich sei um Nachsicht dafür gebeten, dass bisher und im Folgenden nur von dem Kandidaten und dem Prüfer, nicht aber der Kandidatin oder der Prüferin die Rede ist. Das dient allein der einfacheren Lesbarkeit und ist nicht etwa Ausdruck eines verkrusteten Weltbildes.
II.Die Prüfungsgespräche im Einzelnen
1.Prüfungsgespräch
Das Prüfungsgespräch beginnt mit einer vergleichsweise einfachen Fallkonstellation, die jedoch beachtliche rechtliche Probleme birgt. Dabei handelt es sich freilich um Standardprobleme des Allgemeinen Teils des Bürgerlichen Rechts. Angesichts der Tatsache, dass die zugrundeliegende Problematik extrem umstritten ist, hat der Prüfungskandidat einen vergleichsweise weiten Spielraum. Es zeigt sich daran, wie wichtig es ist, die favorisierte Lösung anhand des Gesetzes zu begründen und keine vorgestanzten Meinungsstreitigkeiten wiederzugeben.
Prüfer:Nehmen Sie an, Sie haben jemandem Vollmacht erteilt, damit er bei einem Dritten einen Gegenstand kauft. Erst jetzt fällt Ihnen ein, dass Sie sich bei dem Preis, den sie ihm genannt haben, vertan haben. Was können Sie tun?
Kandidat:Das hängt davon ab, ob der Vertreter das Geschäft mit dem Dritten bereits abgeschlossen hat.
Prüfer:Warum?
Kandidat:Solange der Vertreter mit dem Dritten noch nicht kontrahiert hat, kann die Vollmacht ganz einfach nach § 168 S. 1 BGB widerrufen werden.
Prüfer:Nehmen wir an, er hat mit dem Dritten schon einen Vertrag geschlossen. Wie sieht es dann aus?
Kandidat:In diesem Fall nutzt der Widerruf der Vollmacht nichts, denn er wirkt nur für die Zukunft. In Betracht kommt daher nurmehr die Möglichkeit, dass sich der Vertretene im Wege der Anfechtung von der Erklärung löst.
Prüfer:Sie sagen „von der Erklärung löst“, was meinen Sie damit genau?
Kandidat:Man muss sich zunächst fragen, was genau der Bezugspunkt der Anfechtung ist. Hier ist zu unterscheiden zwischen der Vollmacht als empfangsbedürftiger Willenserklärung, wie sie das Gesetz in § 166 Abs. 2 BGB voraussetzt, und dem Ausführungsgeschäft, das der Vertreter mit dem Dritten vornimmt.
Prüfer:Und was folgt daraus für die Anfechtung?
Kandidat:Daraus folgt, dass der Vertretene zunächst nur die Vollmacht anfechten kann.
Prüfer:Würde ihm das denn helfen?
Kandidat:Na ja, eigentlich möchte sich der Vertretene ja letztlich von dem Ausführungsgeschäft lösen.
Prüfer:Wäre es nicht besser, er würde sich dann gleich bemühen, dieses anzufechten?
Kandidat:Ein derartiges Vorgehen ist an sich nur bei der Außenvollmacht möglich, bei der der Vertretene dem Dritten gegenüber mitgeteilt hat, dass er einen Vertreter bevollmächtigt für ihn zu handeln. Diese Erteilung einer Außenvollmacht stellt eine eigene Willenserklärung des Vertretenen an den Dritten dar und kann folglich problemlos diesem gegenüber angefochten werden.
Gerade die letzte Frage des Prüfers war durchaus tückisch. Der Prüfer lotet den zu diesem Problemkreis vertretenen Meinungsstand aus und fragt zu diesem Zweck den Kandidaten nach allen möglichen Meinungen. Der Kandidat hat sich bisher sehr geschickt verhalten, indem er die Fragen mit der gebotenen Vorsicht, aber gleichermaßen präzise beantwortet hat. Vor allem hat er sich bisher nicht aus der Reserve locken lassen. Dazu nötigt ihn freilich die letzte Frage des Prüfers, so dass die Antwort des Kandidaten regelrecht provoziert war.
Prüfer:Wäre eine solche Gleichstellung mit der Außenvollmacht denn nicht auch für unseren Fall ein angemessenes Vorgehen?
Diese Frage liegt auf der Linie der zuletzt gestellten und ist durchaus maliziös: Da es sich bei diesem Gedankenspiel nämlich durchaus um eine im Schrifttum von maßgeblicher Seite vertretene Ansicht handelt, wäre eine zu harsche Ablehnung durch den Kandidaten gefährlich.
Kandidat:Das wird im Schrifttum durchaus vertreten.12
Der Kandidat hat die Falle offenbar gesehen. Allerdings muss sich der Kandidat hier seiner Sache sicher sein. Ansonsten läuft er Gefahr, als „Blender“ zu gelten, der Meinungen erfindet, um sich aus der Affäre zu ziehen. Im Regelfall ist es vorzugswürdig, die Argumente ohne konkrete Zuordnung zu einer bestimmten Ansicht vorzubringen.
Prüfer:Was halten Sie von dieser Ansicht?
Kandidat:Sie führt zu einem angemessenen Interessenausgleich, weil der Vertretene direkt gegenüber dem Dritten anfechten kann und diesem im Gegenzug Ersatz seines Vertrauensschadens nach § 122 BGB schuldet. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass so über den Vertreter gleichsam hinweg geschaut wird, obwohl dieser rechtlich eine eigene Willenserklärung abgibt, wie es § 164 Abs. 1 BGB verlangt. Damit wird der Vertreter aber gleichsam zum Boten degradiert, der eine fremde Willenserklärung überbringt.
Diese etwas holzschnittartige Verkürzung ist in der mündlichen Prüfung ein durchaus probates Mittel, das Problem zu lösen. Der Prüfer möchte hier weniger positives Wissen über einen besonderen Streitstand als vielmehr eigene Argumentationsfähigkeit des Kandidaten testen. Dafür ist der Hinweis auf die Grundregelung des § 164 BGB aber durchaus tauglich.
Prüfer:Ich verstehe Sie demnach richtig, dass Sie den Weg über die Gleichstellung mit der Außenvollmacht nicht gerade favorisieren. Aber was kann der Vertretene dann machen?
Kandidat:Der Vertretene müsste die Vollmacht selbst anfechten. Schließlich ist dies die Willenserklärung, die er selbst abgegeben hat. Den Vertragsschluss an sich hat er dem Vertreter überantwortet.
Prüfer:Ist das so ganz unproblematisch? Welche Konsequenzen könnte das denn für den Vertreter haben?
Kandidat:Wenn der Vertretene die Vollmacht anficht, wäre diese na...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Einleitung
- Teil I: Zur mündlichen Prüfung im Allgemeinen
- Teil II: Die Prüfungsgespräche
- Teil III: Der Kurzvortrag
- Fußnoten