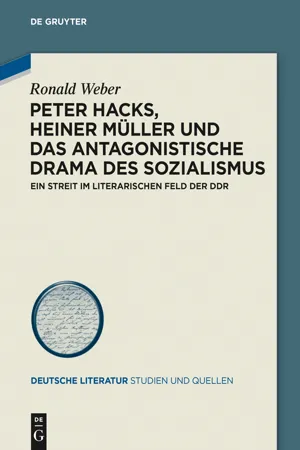![]()
1 Einleitung
Es beginnt mit einem Brief und es endet mit einem Brief. 1957 bestätigt Peter Hacks Heiner Müller in einem Schreiben zur Vorlage beim Schriftstellerverband, dass dessen Stück Der Lohndrücker „das beste Theaterstück“ sei, „das in der DDR geschrieben wurde“, und er „bedeutende Hoffnung“ in Müller setze. 1997 kommt Hacks in einem Brief an seinen Freund André Müller sen. auf den 1995 verstorbenen Müller und den kurz zuvor verstorbenen Stephan Hermlin zu sprechen und bemerkt: „Ich meine, es ist wirklich besser, wir freuen uns an ihren Gräbern als sie an unsern.“1 Der Zeitraum von vierzig Jahren zwischen beiden Aussagen markiert den Gegenstandsbereich der vorliegenden Arbeit über Hacks’ und Müllers antagonistische Dramenkonzepte und deren ästhetische Kontroverse, die sich in den 1970er Jahren zu einer das literarische Feld der DDR prägenden Feindschaft entwickelte. Zwischen beiden Aussagen liegt die Geschichte des DDR-Dramas, die Geschichte der Brecht-Schule, der sowohl Hacks als auch Müller angehören, sowie die Geschichte des deutschen Sozialismus überhaupt, dem Hacks und Müller sich trotz aller Differenz verpflichtet fühlten.
Der Streit zwischen Peter Hacks und Heiner Müller gehört nicht zu den vergessenen Auseinandersetzungen der Literaturgeschichte. Zwar stellt er keinen der großen medialen Streitfälle der Nachkriegsliteratur dar. Er konnte den ZeitgenossInnen, denen er eine Richtungsentscheidung pro Hacks oder pro Müller abverlangte, aber allein schon deshalb nicht entgehen, weil er den für die DDR typischen „rhetorischen Zirkel verpflichtender Gemeinschaftlichkeit“2 durchbrach. Eine umfassende Darstellung hat er jenseits der Erwähnung in zahlreichen autobiographischen und wissenschaftlichen Publikationen bis dato jedoch nicht gefunden. Zudem wird der Streit, wo er explizit thematisiert wird, allzu oft auf ein Motiv der Konkurrenz verkürzt. Die Auseinandersetzung erscheint dann als „Diadochenkampf um die Brechtnachfolge“3, als Wettkampf um den vom eigentlichen Begründer des DDR-Dramas verwaist zurückgelassenen Thron. Auch eine dem Prominenten-Status des späten Heiner Müller angemessene Variante, die den Streit auf das Motiv der Nebenbuhlerschaft zurückführt, ist in Umlauf: Hacks habe Müllers Frau Inge geliebt, diese ihn aber zurückgewiesen, war im August 2003, kurz nach Hacks’ Tod, auf Spiegel Online zu lesen.4
Verschafft man sich einen Überblick über die zu Peter Hacks und Heiner Müller erschienene Literatur, so stellt man fest, dass die beiden wichtigsten Dramatiker der DDR kaum je gemeinsam betrachtet wurden und die Auseinandersetzung zwischen beiden – obwohl unstrittig ist, dass sie „innerhalb des DDR-Theaters schulbildend gewirkt“ haben – als „ein folgenloser Streit“ gilt.5 Zudem wurden die ästhetischen Positionen Hacks’ und Müllers oftmals auf wenige Kernpunkte reduziert, was zu mitunter eklatanten Missverständnissen, vor allem aber zu vereinfachten Aussagen geführt hat, wie etwa der, dass Hacks „die Wirklichkeit nur noch ästhetisieren“ wolle, während Müller dieselbe einzig „als ein verbissenes Spiel ums Überleben“ zeige.6 Auch die in den 1970er Jahren einsetzende Romantik-Rezeption in Verbindung mit Hacks’ Kampf gegen die als überhistorische Erscheinung aufgefasste Romantik – ein Versuch der Einflussnahme auf die Entwicklungen innerhalb der DDR-Literatur, in dessen Zusammenhang auch die Auseinandersetzung mit Müller zu verstehen ist, der sich zu dieser Zeit immer intensiver an der ästhetischen Moderne orientierent – spielt in der Forschung kaum eine Rolle.7 Erst vor dem Hintergrund der Gruppenbildungsprozesse zu Beginn der 1970er Jahre, die mit der Öffnung des vormals relativ strikt regulierten Kanons einsetzen, erklärt sich aber die Spaltung der DDR-Literatur, die mit den Protesten gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns ihre Vollendung fand und das kulturelle Leben der DDR bis zu ihrem Ende prägte.8 Der selbsternannte Klassiker Peter Hacks, den Sven Hanuschek treffend als seltenes Exemplar eines „marxistischen Ästheten“ bezeichnet hat, 9 und sein ‚modernistischer‘, postdramatischer Gegenspieler Heiner Müller stehen beispielhaft für diesen Spaltungsprozess. Die vorliegende Arbeit füllt insofern eine Forschungslücke, als sie einer zu schreibenden, umfassenden Literatur- und Kulturgeschichte der DDR einen weiteren Mosaikstein hinzufügt.10
Wenn im Folgenden von der Geschichte des Streits zwischen Hacks und Müller die Rede ist, so wird also auch die Geschichte der Lagerbildung und Spaltung der DDR-Literatur erzählt, die sich hier in erster Linie als Schisma der Brecht-Schule darstellt, als Spaltung derjenigen AutorInnen, deren unmittelbarer Eintritt in das literarische Leben mit dem Studium der Texte Brechts verbunden war und die dem ,Lehrer‘ zumeist Zeit ihres Lebens anhingen.11 Der Müller-Freund Bernd Klaus Tragelehn hat die Geschichte der Brecht-Schule mit polemischem Unterton gegen die ,Rechts-Brechtianer‘ mit der Nachgeschichte Hegels verglichen: „Auf der einen Seite die staatstragenden Preußen und auf der anderen Seite die Linkshegelianer und weiter bis hin zu Marx. Genauso hat die Brecht-Schule sich gespalten.“12 Peter Hacks, der sich als einziger der Brecht-Schüler im Zuge seines Übergangs zur ,sozialistischen Klassik‘ ab den 1960er Jahren vehement von Brecht distanzierte und für sich beanspruchte, diesen überwunden zu haben, hätte Tragelehns Schema sicherlich widersprochen; mit Leuten wie Manfred Wekwerth, Brecht-Schüler und ab 1960 Chefregisseur am Berliner Ensemble, wollte er nichts gemein haben. Das Bild trifft, siedelt man das Primat der Fabel auf der Brecht’schen Rechten und das Primat der Figur und der dramatischen Situation auf der Brecht’schen Linken an, gleichwohl den Gegenstand, zumal emplotment und enactment genau jene Brecht’schen Fluchtlinien kennzeichnen, an denen Hacks und Müller sich orientierten. Es erweist sich aber noch in einem weiteren Sinne als treffend, nämlich hinsichtlich der Frage nach dem Staat. Denn unabhängig von der konkreten Loyalität gegenüber der DDR, die beide Dramatiker teilten, gehört der Hegelianer Hacks ins Lager der expliziten Etatisten, während Müller in Anknüpfung an den linksradikalen Brecht als Anti-Etatist bezeichnet werden kann. So sehr die Auseinandersetzung zwischen Hacks und Müller eine genuin ästhetische ist, ist sie dergestalt zugleich auch eine politische. Werner Mittenzwei hat das bereits 1978 auf den Punkt gebracht:
Ihre unterschiedlichen Standpunkte haben ihren Grund nicht im Persönlichen, noch ausschließlich im Politischen, sie verweisen auf das Ästhetische, obwohl sich in das Ästhetische – wie könnte es anders sein – das Politische mischt. Es sind Unterschiede und auch Gegensätze unter Marxisten.13
Wenn vom Streit zwischen Hacks und Müller die Rede ist, ist also das Politische im Auge zu behalten; und das nicht allein, weil beide eminent politische Autoren sind, sondern auch weil das Feld, in dem sich die Auseinandersetzung zwischen beiden abspielt, hochgradig politisch aufgeladen ist; in der DDR zu schreiben, hieß immer auch die sozialistische Gretchenfrage beantworten ,Wie hältst du’s mit dem Staat?‘, in welche die eigentliche Frage ‚Wie hältst du’s mit der Partei?‘ eingeschlagen war. Was die Auseinandersetzung zwischen Hacks und Müller auszeichnet, ist (unabhängig davon, dass beide mit der Antwort auf diese Frage wie viele andere DDR-AutorInnen ihre Probleme hatten) jedoch der Umstand, dass die bis in die 1970er Jahre hinein so omnipräsente Kulturpolitik in dieser gerade keine aktive Rolle spielt. Damit aber fiel sie durch das Raster der DDR-Literaturgeschichtsschreibung, die seit jeher auf das Gegenüber von AutorInnen und Kulturpolitik fokussierte, wenn sie nicht die AutorInnen der DDR samt und sonders zu „staatlich besoldete[n] Funktionäre[n]“ erklärte, ein Vorgehen, das in Zeiten des Kalten Krieges keine Seltenheit darstellte und mitunter auch heute noch anzutreffen ist.14 Die (Kultur-)Politik der SED stand lange Zeit im Mittelpunkt der Literaturgeschichtsschreibung. Ihren Beschlüssen und Entscheidungen folgten nicht nur die Periodisierungen der DDR-Literaturgeschichte, diese galten auch als Initiale des literarischen Prozesses. Am sinnfälligsten drückt sich das in Hans-Jürgen Schmitts Vorbemerkung zum 1983 vorgelegten DDR-Band von Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur aus. Dort heißt es:
Keine andere Epoche deutscher Literatur ist mit dem kulturpolitischen Programm einer Partei in einer so ambivalenten Verbindung zu sehen wie die Literatur der DDR […]. Im Gegensatz zu anderen Epochen stellt sich nicht die Schwierigkeit, ein sozialgeschichtliches Modell erst herausfinden zu müssen, in dem dann der Wirkungszusammenhang der Literatur begründet werden kann; es gibt vielmehr programmatische Vorgaben der Kulturpolitik, die Institutionen geprägt und Schreibprozesse beeinflußt haben.15
Der blinde Fleck, den der innerliterarische Entwicklungsgang der DDR-Literatur in der Literaturgeschichtsschreibung darstellt, findet seine Erklärung allerdings nicht allein im sozialgeschichtlichen Forschungsparadigma der 1970er, das die meisten vor 1989 erschienenen Literaturgeschichten prägte.16 Dass die AutorInnen in den Modularisierungen der DDR-Literaturgeschichtsschreibung zumeist als mehr oder weniger einheitliche Gruppe aufgefasst werden (und die sogenannten ,parteikonformen‘ AutorInnen wie selbstverständlich außer Betracht sind), geht vielmehr auf die grundsätzliche Annahme eines Widerspruchs zwischen politischem und literarischem Feld zurück. Als Grundbedingung der DDR-Literatur erscheint so die andauernde Auseinandersetzung zwischen den AutorInnen und den kulturpolitischen Ansprüchen der SED, ein Widerspruch, der sich im Laufe der Existenz der DDR von einem Verhältnis der Heteronomie zu einem der Autonomie entwickelt habe. Das vorherrschende Narrativ der Literaturgeschichtsschreibung ist demnach eines der ästhetischen und politischen Emanzipation.17 Die dichotome Vorstellung, die nicht zuletzt mit der kaum reflektierten „Rolle des Westens“ bei der narrativen Schöpfung einer „Kultur der Dissidenz“18 zusammenhängt, greift in mancherlei Hinsicht zu kurz. Sie verstellt nicht nur den Blick für die Widersprüche innerhalb der (Kultur-)Politik selbst, sondern konstruiert vor allem ein „Bild von der permanenten Opferrolle der DDR-Schriftsteller“, die „in ihrer Selbstbehauptung gegen den Druck von oben […] eine Einheit gebildet hätten“, was zur Konsequenz hat, dass ein erheblicher Teil der DDR-Literatur, nämlich der somit als systemkonform abgewertete, ausgeklammert wird und „die tatsächliche Pluralität der Poetiken und politischen Positionen in der DDR-Literatur“ außerhalb der Betrachtung bleibt.19 Wie notwendig es ist, diese Pluralität in den Blick zu nehmen, zeigt der Streit zwischen Hacks und Müller, der eine neue Perspektive auf die Literaturlandschaft der DDR und ihre innerliterarischen Kämpfe eröffnet: auf die verschiedenen Parteiungen und Kreise sowie die divergierenden ästhetischen Richtungen.
Einer der Kupferstiche der ersten, zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts erschienenen deutschsprachigen Literaturgeschichten, Jacob Friedrich Reimmanns Versuch einer Einleitung in die Historiam Literariam, zeigt einen Irrgarten, an dessen Eingang der Historiker steht und einen Ariadnefaden in der Hand hält. „Dem Faden nach“ steht darunter.20 Das Bild impliziert, der Geschichte des Theseus gemäß, dass der Literaturhistoriker den Faden zunächst abrollen muss, indem er sich einen Weg durch das Labyrinth bahnt. Die Vorstellung der Konstruktion, die hierin enthalten ist, wich später der Suche nach den objektiven Zusammenhängen, „nach dem schon existierenden Leitfaden der Literatur vor der Literaturgeschichte“.21 Es gilt gerade den Aspekt der Konstruktion zu bedenken. Man muss und sollte dabei nicht so weit gehen wie Hayden White, der Geschichtsschreibung grundsätzlich als Sinngebung auffasst, die dem kontingenten Ereignisstrom mittels „poetischer Mittel eine diskursive Form auferlegt“.22 Aber die Dominanz eines Oben-/Unten-Narrativs in der DDR-Literaturgeschichtsschreibung verrät doch einiges darüber, dass die Interpretation von Geschichte immer auch das Konstrukt eines Wissenschaftlers ist und die historische Situation, in der er steht, mitreflektiert.23 Damit ist nicht gesagt, die bisherige Erzählung der Literaturgeschichte sei falsch. Betont wird damit lediglich, dass sie zu kurz greift. Sie ist nicht differenziert genug, um Phänomene wie den Streit zwischen Hacks und Müller werten zu können, ohne diesen auf eine Lesart zu verkürzen, die dessen Abhängigkeit von der Kulturpolitik behauptet. Dass dieser in einer Verbindung mit der (kultur-)politischen Geschichte der DDR steht, ist gleichwohl offensichtlich. Zu fragen ist, wie diese Verbindung beschaffen ist, in welcher Vermittlung ästhetische Debatte und Kulturpolitik zueinander stehen.
Der Streit zwischen Hacks und Müller hat mit der Kulturpolitik vor allem die Gemeinsamkeit, dass die dahinter stehenden Auffassungen die Position der Kulturpolitik in doppelter Weise negieren; sowohl Hacks’ sozialistische Klassik als auch Müllers Versuch einer Aktualisierung des Brecht’schen Lehrstücks stehen den kulturpolitischen Konzepten distanziert gegenüber. Dabei streiten Hacks und Müller freilich über die gleichen, die marxistische ästhetische Diskussion von Beginn an begleitenden Ausgangsfragen: die Fragen von Realismus und Repräsentation.24 Will man den Gegenstand des Streits zuspitzen, so könnte man sagen, Hacks und Müller stritten als künstlerische „Historiker des entstehenden Sozialismus“ darüber, welche ...