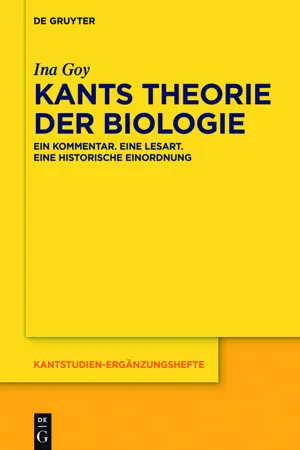1.1Zur Genese der Theorie organisierter Wesen in Kants Schriften
Vor 1790 verzweigen sich Kants Gedanken zur zweckmäßig organisierten Natur in einzelnen kleineren Schriften oder Teilen von Schriften.3 Zwischen ihnen finden thematische Sprünge und Verschiebungen statt, die nicht nahtlos aneinander passen. Schon früh, in der Theorie des Himmels (1755) und im Beweisgrund (1763), wird greifbar, dass Kant ein Bewusstsein von einem Unterschied hat, der zwischen organisierten Wesen und anderen Gegenständen, etwa physikalischen natürlichen Objekten oder Kunstprodukten, besteht. Ab 1775 tritt die Analyse der Entstehungsprinzipien organisierter Wesen stärker in den Vordergrund. Eine der wesentlichen Aussagen in den Rassenschriften ist Kants Theorem von der Erzeugung organisierter Wesen aus Keimen und Anlagen. Die Grundgedanken der Organisation als Prinzip organisierter Wesen und der Ausrichtung organisierter Wesen auf Zwecke sowie die Annahme, dass organisierte Wesen durch teleologische Erklärungen repräsentiert werden, tauchen im engen Zusammenhang mit der organisierten Natur zum ersten Mal 1785, am Ende der zweiten Rassenschrift, auf. Parallel wendet Kant die Zwecklehre auf die Theorie der Ideen in der ersten Kritik (1781/7), auf die Zweckformeln des kategorischen Imperativs in der GMS (1785) und auf die Lehre vom höchsten Gut der zweiten Kritik (1788) in der theoretischen und der praktischen Philosophie an; sie hält darüber hinaus Einzug in Kants geschichtsphilosophisches und, in diesem Zusammenhang, auch in Kants anthropologisches und politisches Denken. Gleichzeitig arbeitet Kant 1786 in den MAN die Darlegung seiner physikalisch mechanischen Naturlehre aus, die er als einen Bereich der speziellen Metaphysik versteht. Im Jahre 1788 erlangt Kant Klarheit darüber, dass teleologische Prinzipien den Rang transzendentaler Prinzipien haben, die, wie die transzendentalen Erkenntnisprinzipien der ersten Kritik, einen gegenstandsindikativen, wenn auch keinen gegenstandskonstitutiven Status für eine bestimmte Gruppe von Gegenständen, nämlich organisierte Wesen, haben. Im Jahre 1790 führt Kant diese verschiedenen Denkbewegungen in der KU zusammen und trägt eine Theorie organisierter Wesen vor, die auf drei Arten von Kräften und Gesetzen – den mechanischen, physisch teleologischen und moralteleologischen Kräften und Gesetzen – und deren Einheit in der regulativen Idee eines göttlichen Bewusstseins beruht. In der KU findet Kant zum einen die gesuchte Theorie organisierter Wesen, zum anderen erkennt er, dass organisierte Wesen, neben ästhetisch zweckmäßigen Objekten, eine entscheidende Rolle für die Einheit des Systems der Philosophie und ihrer beiden Teile, der theoretischen und der praktischen Philosophie, spielen. Denn neben den zweckmäßig schönen Dingen sind es vor allem zweckmäßig organisierte Wesen – Pflanzen, Tiere und Menschen als Naturwesen – die den Menschen an die Einheit der Philosophie, und an einen möglichen Übergang von der Philosophie der Natur zur Philosophie der Freiheit glauben lassen.
Über organisierte Wesen schreibt Kant bekanntlich in einer Zeit, in der die Biologie als wissenschaftliche Disziplin noch nicht unter einem eigenen Namen etabliert ist. Die Biologie als Einzelwissenschaft im modernen Sinne erwähnen erstmals Gottfried Reinhold Treviranus in seinem Buch Biologie oder Philosophie der lebenden Natur (1802) und Jean-Baptiste Lamarck in der Hydrogéologie (1802). Das Wort ‚Biologie‘ ist aber schon im Titel des dritten Bandes von Michael Christoph Hanovs Philosophiae naturalis sive physicae dogmaticae: Geologia, biologia, phytologia generalis et dendrologia aus dem Jahre 1766 enthalten und wird von Theodor Gustav Roose im Jahre 1797 im Vorwort seiner Schrift Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft verwendet. Der Sache nach gehörte die Untersuchung von Lebewesen vor und in Kants Zeit zu verschiedenen anderen akademischen Disziplinen, etwa der Naturgeschichte und Naturbeschreibung, der Physiologie, der Physik, der Medizin, der Anatomie und der Theologie. Bedeutende Ergebnisse in der Naturforschung wurden aber nicht nur von Wissenschaftlern, sondern vereinzelt auch von Laien erzielt,4 die sich, fernab institutioneller Forschung und akademischer Disziplinen, der Erforschung der Natur aus religiösen Motiven zuwandten, etwa dem, Gottes Wunderwerke in der Schöpfung zu preisen.
1.1.1Die Theorie des Himmels
Die Theorie des Himmels (1755) ist eine Abhandlung über die Entstehung und das physikalische Wesen des Kosmos sowie der mechanischen Bewegungen der Himmelskörper, die zugleich einen physikotheologischen Gottesbeweis enthält. Als Kant sie schreibt, ist er dreißig Jahre alt und begeisterter Anhänger der Lehre Isaac Newtons (1643–1727). In dieser Frühschrift findet sich eine erste wichtige systematische Bemerkung über organisierte Wesen. In einer Reflexion über die mechanische Bildung des Kosmos im Großen erwähnt Kant Pflanzen und Tiere als Objekte, die nicht allein mechanischen Gesetzen der Bewegung zu folgen scheinen. Die Andersartigkeit dieser Wesen bleibt für Kant 1755 unerklärbar:
Mich dünkt, man könne hier in gewissem Verstande ohne Vermessenheit sagen: Gebet mir Materie, ich will eine Welt daraus bauen! das ist, gebet mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine Welt daraus entstehen soll. Denn wenn Materie vorhanden ist, welche mit einer wesentlichen Attractionskraft begabt ist, so ist es nicht schwer diejenigen Ursachen zu bestimmen, die zu der Einrichtung des Weltsystems, im Großen betrachtet, haben beitragen können. […] Kann man aber wohl von den geringsten Pflanzen oder Insect sich solcher Vortheile rühmen? Ist man im Stande zu sagen: Gebt mir Materie, ich will euch zeigen, wie eine Raupe erzeugt werden könne? Bleibt man hier nicht bei dem ersten Schritte aus Unwissenheit der wahren innern Beschaffenheit des Objects und der Verwickelung der in demselben vorhandenen Mannigfaltigkeit stecken? Man darf es sich also nicht befremden lassen, wenn ich mich unterstehe zu sagen: daß eher die Bildung aller Himmelskörper, die Ursache ihrer Bewegungen, kurz, der Ursprung der ganzen gegenwärtigen Verfassung des Weltbaues werde können eingesehen werden, ehe die Erzeugung eines einzigen Krauts oder einer Raupe aus mechanischen Gründen deutlich und vollständig kund werden wird (ANTH 1:229.37–230.26).
Dass sich organisierte Wesen durch mechanische, aber nicht allein durch mechanische Erklärungen charakterisieren lassen, ist ein Gedanke, der sich bis ans Ende der kritischen Philosophie erhält; es ist bemerkenswert, dass Kant diese Vorstellung bereits 1755 niederschreibt.
1.1.2Der Beweisgrund Essay
Ein ähnlicher Gedanke taucht acht Jahre später, beinahe unverändert, im 1763 verfassten Beweisgrund Essay auf. Der Mensch sei, schreibt Kant nun,
nicht vermögend die Naturursachen deutlich zu machen, wodurch das verächtlichste Kraut nach völlig begreiflichen mechanischen Gesetzen erzeugt werde, und man wagt sich an die Erklärung von dem Ursprunge eines Weltsystems im Großen. Allein ist jemals ein Philosoph auch im Stande gewesen, nur die Gesetze, wornach der Wachsthum oder die innere Bewegung in einer schon vorhandenen Pflanze geschieht, dermaßen deutlich und mathematisch sicher zu machen, wie diejenige gemacht sind, welchen alle Bewegungen der Weltkörper gemäß sind. Die Natur der Gegenstände ist hier ganz verändert. Das Große, das Erstaunliche ist hier unendlich begreiflicher als das Kleine und Bewundernswürdige (Beweisgrund 2:138.21–31).
Diese zweite wichtige Passage aus der Frühphilosophie findet sich in der siebten Betrachtung der zweiten Abteilung des Beweisgrund Essays. Wie in der Theorie des Himmels entwickelt Kant dort eine kosmogonisch-kosmologische Hypothese von der Bildung der Welt im Großen, nach welcher der Ursprung der Himmelskörper und die Ursache ihrer Bewegungen mechanisch erklärt werden kann. Diese Hypothese wird wie in der Theorie des Himmels mit einem physikotheologischen Gottesbeweis verbunden. Während sich die Welt im Großen nach mechanischen Gesetzen erklären lässt, gesteht sich Kant die Unwissenheit des Menschen in Bezug auf die Welt im Kleinen ein. Die gesetzlichen Ordnungen organisierter Wesen zu verstehen ist Kant auch 1763 noch nicht möglich.
Im Beweisgrund Essay diskutiert Kant einen ontologischen und einen physikotheologischen Gottesbeweis; er ist in diesen Jahren von der philosophischen Beweisbarkeit der Existenz Gottes überzeugt. Kant stellt das ontologische Argument als den einzigen gültigen Beweisgrund Gottes über das physikotheologische Argument, gibt aber der Diskussion des physikotheologischen Argumentes in der zweiten Abteilung des Essays ungleich größeren Raum. Dies ist für die dritte Kritik insofern von großer Bedeutung, als Kant neben der oben genannten, wichtigen Stelle vor dem Hintergrund des physikotheologischen Argumentes Analysen zum Verhältnis zwischen göttlicher und natürlicher Ordnung durchführt, die zu den ausführlichsten zählen, die Kant Zeit seines Lebens vorgenommen hat.
In der zweiten Abteilung des Beweisgrundes trägt Kant ein gegenüber der Tradition verbessertes physikotheologisches Argument vor. Er unterscheidet verschiedene Zusammenhänge zwischen der göttlichen und der natürlichen Ordnung und differenziert zunächst zwischen einer moralischen und einer unmoralischen Abhängigkeit der Dinge von Gott. Die Abhängigkeit der Dinge von Gott ist eine moralische, wenn Gottes Wille und Wahl der Grund für das Dasein der Dinge sind. Die Abhängigkeit der Dinge von Gott dagegen ist eine unmoralische, wenn die innere Möglichkeit der Dinge und ihre Tauglichkeit zur Übereinstimmung und Einheit im Ganzen von Gottes Weisheit abhängig sind. Denn die Übereinstimmung zur Einheit im Ganzen enthält dann nichts Zufälliges und ist durch die Weisheit Gottes, nicht aber durch den Willen und eine Wahl Gottes bedingt (Beweisgrund 2:103.20–8).
Kant erwägt weiterhin, ob und in welcher Form Dinge durch übernatürliche oder durch natürliche Ursachen bewirkt werden, ob übernatürliche Ursachen einer Mitwirkung der Natur bedürfen, und wenn ja, in welcher Form. Gegenstände gehören der übernatürlichen Ordnung an, wenn sie entweder im materialen oder im formalen Sinne von Gott abhängig sind. Im materialen Sinne übernatürlich sind Gegenstände dann, wenn ihre nächste wirkende Ursache außerhalb der Natur ist. Im formalen Sinne übernatürlich sind Gegenstände, wenn die Art und Weise, wie die Kräfte der Natur auf die Hervorbringung einer Wirkung gerichtet sind, nicht durch natürliche Ursachen begründet werden kann, sondern Gott voraussetzen. Wenn Gegenstände der Natur im formalen Sinne übernatürlich sind, kann Gott natürliche Ursachen als Mitursachen verwenden, um Wirkungen hervorzubringen. Nicht zur übernatürlichen, sondern zur natürlichen Ordnung gehören Gegenstände, wenn sie in den Kräften der Natur entweder hinreichend begründet sind, oder wenn sie durch natürliche Kräfte in der Art und Weise bestimmt sind, wie sie auf eine Wirkung gerichtet sind (Beweisgrund 2:103.27–104.7).
Außerdem differenziert Kant zwischen Gegenständen, die einer zufälligen, und Gegenständen, die einer notwendigen Ordnung der Natur angehören. Der zufälligen Ordnung der Natur gehören Naturdinge dann an, wenn der natürliche Grund, der eine ähnliche Art von Wirkungen nach einem Gesetz hervorbringt, nicht zugleich der Grund von anders gearteten Wirkungen ist, die einem anderen Gesetz folgen. Einer notwendigen Ordnung der Natur gehören Naturgegenstände an, wenn viele, an ihnen wirkende Naturgesetze eine notwendige Einheit zeigen und derselbe Grund, der sie zur Übereinstimmung mit einem Naturgesetz zwingt, auch die Übereinstimmung mit einem anderen Naturgesetz veranlasst (Beweisgrund 2:106.12–25). Beide Arten der Naturordnung können in Verknüpfung mit einer übernatürlichen Ordnung vorgestellt werden.
Kants Analysen möglicher Zusammenhänge zwischen göttlicher und natürlicher Ordnung mü...