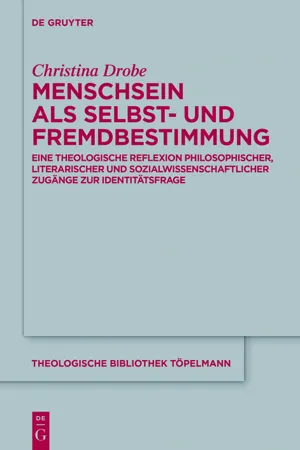![]()
1Philosophische Zugänge zur Identitätsfrage
Der Begriff „Identität“ geht aus dem lateinischen identitas, was „Selbigkeit“ bedeutet, hervor und bildet die Nominalisierung des „dasselbe“ bezeichnenden Pronomens idem.26 Seine ursprüngliche Verwendungsweise liegt im Bereich der philosophischen Erkenntnistheorie und der Logik,27 die mit „Identität“ eine „ausgezeichnete zweistellige Relation, nämlich diejenige, in der jeder Gegenstand allein zu sich selbst steht“28, eine in diesem Sinne reflexive Relation beschreibt.29 Zusammen mit dem Oppositum „Differenz“ erweist sich „Identität“ seit dem „Ursprung in der griechischen Philosophie [als] ein Relationsbegriff, der nach Plato (Parmenides 139b ff, 146a ff) in zwei Formen begegnet: als Identität mit sich und als Identität mit anderem, desgleichen als Verschiedenheit von sich und als Verschiedenheit von anderem.“30 Somit setzt eine solche Verwendung des Identitätsbegriffes grundsätzlich voraus, „daß die in der Identitätsbeziehung implizierten Relata […] different sind, sei es nach Schriftbild, Aussprache oder […] nach lokaler oder temporaler Position […], und gleichwohl eine Identität bilden.“31 Seit Frege und Peirce wird in eben jenem Zusammenhang „zwischen einem Gegenstand und der Art seines Gegebenseins (z. B. durch seinen Eigennamen)“32 in Bezug auf Leibniz’ principium identitatis indiscernibilium unterschieden, das in seiner logischen Fassung wie folgt lautet: „eadem sunt quorum unum in alterius locum substitui potest, salva veritate[] (identisch sind diejenigen [Termini], deren einer für den anderen mit Erhaltenbleiben der Wahrheit [d. h. des Wahrheitswertes] eingesetzt werden kann (Specimen calculi universalis, Philos. Schr.VII, 219).“33 Die Frage, ob es sich bei einem bezeichneten Referenzobjekt um denselben Gegenstand handelt, erfordert zur Feststellung der Identitätsrelation zweierlei Kriterien: „1. Kriterien der Distinktheit bzw. Individuation […], gelegentlich auch als Kriterien der synchronen I. bez.; 2. Kriterien der Reidentifikation bzw. der diachronen I. […].“34 Die Verwendung synchroner und diachroner Identitätskriterien beruht dabei zum einen auf der ontologischen These, „daß alles Seiende eine gewisse Konstanz des Seins hat“35 und zum anderen auf der Voraussetzung des Satzes von der Identität, der „neben dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch, dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten und dem Satz der Kontravalenz zu den elementaren Gesetzen der Logik [zählt]. Er besagt in inhaltlicher Sprechweise, daß ein jeder Sachverhalt sich selbst zur (hinreichenden) Bedingung hat, daß er also besteht, falls er besteht.“36 Wenn nun in Anlehnung an Frege und Peirce ein Gegenstand von der Art seines Gegebenseins unterschieden werden muss, dann ist zur Verwendung von Kriterien synchroner und diachroner Identität zu klären, „was es heißt, einen Gegenstand zu erkennen oder wiederzuerkennen, insbesondere also einen Gegenstand – bestimmt oder unbestimmt – benennen zu können,“37 und dementsprechend „die Gliederung von Gegenstandsbereichen in einzelne identifizierbare Einheiten, die Individuen, erforderlich.“38 Die Frage nach der Identität eines Gegenstandes lässt sich demnach nicht von der Frage nach den Voraussetzungen für dessen Identifikation trennen, so dass nur „unter Wahrung der Untrennbarkeit ontologischer von epistemlogischen Fragestellungen […] eine Untersuchung der gegenstandstheoretischen Grundlagen aussichtsreich [bleibt].“39 Eine solche Gliederung von Gegenstandsbereichen, mittels deren die Identifikation eines Gegenstandes möglich wird, erfolgt über sortierende Terme oder auch sortale Prädikate, welche „die räumliche Konfiguration von Gegenständen einer bestimmten Art an[geben] und dadurch Identitäts- und Zählbarkeitskriterien für Gegenstände dieser Art bestimm[en].“40 Da am Ende des 19. Jahrhunderts „gesellschaftliche Strukturen und Normen an Plausibilität eingebüßt haben“41 , entwickelt sich zu diesem Zeitpunkt „Identität“ dadurch zu einem „Schlüsselbegriff verschiedener Wissenschaften“42 , dass „persönliche und soziale Identität nicht mehr selbstverständlich deckungsgleich sind [und] die Erfahrung ihrer Diskrepanz mithin zur Reflexion auf ihre Zuordnungsmöglichkeiten nötigt.“43 So muss die im Rahmen von Psychologie, Anthropologie oder auch Soziologie gestellte Frage „nach der Selbstidentität oder Ichidentität, d.h. nach der I. eines Menschen mit sich selbst […], zum Problem der Konstitution von Individuenbereichen bzw. von einzelnen Individuen – beim Menschen: einer Person – gezählt werden“44 , indem es zu klären gilt, wann ein Individuum die Kriterien synchroner und diachroner Identität erfüllt, um als „Person“ bezeichnet und als solche identifiziert zu werden.45 Hier lassen sich im wesentlichen zwei Zugänge unterscheiden:
„Nach dem Körperkriterium besteht die Identität einer Person zu zwei verschiedenen Zeitpunkten in der Kontinuität des Körpers während dieses Zeitraums (nach modifizierter Auffassung in der Kontinuität des Gehirns als ausgezeichnetem Teil des Körpers). Dem psychischen Kriterium zufolge läßt sich p. I. analysieren als Kontinuität zwischen den psychischen Zuständen zu verschiedenen Zeitpunkten, vor allem von Erinnerungen und Erlebnissen.“46
Daraus ergibt sich im Hinblick auf die Identität einer Person grundsätzlich die Frage, in welcher Weise im Sinne des Leib-Seele-Problems physische und psychische Zustände aufeinander bezogen werden können, also „ob mentalen Phänomenen ein eigener ontologischer Status zuzubilligen ist oder ob sie in Wirklichkeit physischer Natur sind.“47 In diesem Zusammenhang sind formal insofern ein reduktiver und ein nicht-reduktiver Zugang denkbar, als ein eigener ontologischer Status mentaler Phänomene entweder abgelehnt oder angenommen werden kann. So behaupten Vertreter eines reduktiven Ansatzes wie David M. Armstrong, John J.C. Smart und Herbert Feigl in unterschiedlichen Akzentsetzungen „die ontisch-faktische Identität von physischen und psychischen Zuständen bzw. Prozessen […], jedoch eine Verschiedenheit in der jeweiligen Weise des Gegebenseins“48, so dass ein Ereignis zwar verschieden rezipiert zu werden vermag, „nämlich zum einen als psychisches, zum anderen als physikalisches Ereignis, es sich aber ‚in Wirklichkeit‘ ausschließlich um ein physikalisches Ereignis handeln soll.“49 Dagegen unterziehen Verfechter eines nicht-reduktiven Ansatzes wie Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Paul Ricoeur und Robert Spaemann Identitätsverständnisse, die den Identitätsbegriff in Bezug auf die Identität einer Person nur „in gegenständlicher bzw. naturalistischer Perspektive“50 verwenden, einer eingehenden Kritik, weil dergestalt
„das eigene Selbstverständnis von seinem Selbst, das für jede Person wesentlich ist, unberücksichtigt [bleibt]. […] Die [von einem nicht-reduktiven Ansatz aus] kritisierten Konzeptionen thematisieren die p. I. aus der Perspektive der Selbigkeit (d.i. der gegenständlichen Identität), ohne den subjektiven Charakter (d.i. das subjektive Bewußtsein von sich als einem Selbst) hinreichend in den Blick zu bekommen.“51
Deshalb stellt sich im Zusammenhang eines nicht-reduktiven Ansatzes in Bezug auf das Verständnis personaler Identität die Frage nach der Kontinuität von psychischen Zuständen im Sinne der Selbst- oder Ich-Identität, wie sie innerhalb der Psychologie unter anderem in der Tradition von William James, Sigmund Freud, Erik H. Erikson und in der Soziologie beispielsweise ausgehend von George H. Mead, Anselm Strauss, Lothar Krappmann, Erving Goffman und Jürgen Habermas verhandelt wird, da die Bedingungen und Kriterien für die „Identität der leiblich-geistigen Person über die Zeit hinweg sowie in Auseinandersetzung mit der Gesellschaft“52 zu klären sind: „Geht es im ersten Fall um das Problem der Kontinuierung der Person auch über die Zustände der Bewußtlosigkeit: des Tiefschlafs, Komas, der Ohnmacht hinweg […], so im zweiten Fall um das Problem der Konstitution der Person in Interaktion mit der Sozietät.“53 Dementsprechend steht eine sozialpsychologische Theorie im Angesicht des zweiten Problems zum Beispiel vor der Herausforderung, einen „Ausgleich zwischen individueller und sozialer (Gruppen‐)Identität“54 denken zu müssen und zu klären, „wie die Person die Vielzahl ihr zugemuteter Rollen zu einem zwar differenzierten, aber noch konsistenten Ich“55 zu integrieren vermag.
Wenn nun „Identität“ im Sinne von „Selbigkeit“ als reflexiver Relationsbegriff zu verstehen ist, mittels dessen ein Gegenstand aufgrund seiner Distinktheit von anderen Gegenständen identifiziert und durch seine Kontinuität reidentifiziert wird, dann stellen sich im Zusammenhang der Problematik, was sich unter der Identität einer Person fassen lässt, grundsätzlich folgende Fragen:
–Was bedeutet im Hinblick auf die Unterscheidung eines Gegenstandes von seiner Gegebenheitsweise die Rede von der Identität eines Gegenstandes?
–Auf welche Weise lässt sich daran anschließend im Sinne der Kontinuität psychischer Zustände von der Identität des Bewusstseins, des Ich, des Selbst oder auch des Subjekts sprechen?
–Was kann unter Berücksichtigung sowohl des Körperkriteriums als auch des psychischen Kriteriums als Identität der Person begriffen werden?
Diese Fragen sollen im Folgenden exemplarisch anhand einer darstellenden Analyse der philosophischen Identitätskonzeptionen von Dieter Henrich, Jean- Paul Sartre und Helmuth Plessner erörtert werden, wobei sich die Betrachtung von Henrichs Ausführungen zur Identitätsfrage vor dem Hintergrund der logischen Verwendungsweise des Begriffes „Identität“ auf die Explikation der Rede von der Identität eines Gegenstandes konzentriert, die Auseinandersetzung mit Sartre im wesentlichen das Verhältnis von Identität und Subjektivität zum Gegenstand hat und die Darlegung von Plessners philosophischer Anthropologie sein Verständnis der Identität von Personen in den Blick nimmt, was der Vorbereitung einer im Anschluss daran vorzunehmenden systematischen Untersuchung der Bedingungen, auf denen die Rede von der Identität eines Gegenstandes, eines Subjektes und einer Person beruht, und der Kriterien, die sie verwendet, dient.
1.1Dieter Henrich: Identität als Eigenschaft von Einzelnem
Eines der zentralen Themen von Dieter Henrichs (*1927) Philosophie ist die Frage nach der Beschaffenheit des menschlichen Selbstbewusstseins und dessen Bezug zu allem, das nicht es selbst ist, zu dem, was ihm als Welt gegeben ist. In Veröffentlichungen mit Titeln wie Über die Einheit der Subjektivität (1955), Das Selbstbewußtsein und seine Selbstdeutungen (1982), Bewußtes Leben (1999), Versuch über Kunst und Leben. Subjektivität – Weltverstehen – Kunst (2001), sowie dem jüngst erschienenen Denken und Selbstsein. Vorlesungen über Subjektivität (2007)56 liefert er eine detaillierte Analyse der Implikationen von menschlicher Subjektivität. Anders als es unser gegenwärtiger Sprachgebrauch erwarten lässt, vermeidet Henrich neben zentralen Termini wie „wissende Selbstbeziehung“, „Selbst-und Weltdeutung“ sowie „Selbstkontinuierung“ in diesem Zusammenhang weitestgehend den Gebrauch von „Identität“, ein Terminus, der im allgemeinen Sprachgebrauch bei Fragen in Bezug auf den eigenen Lebensentwurf unverzichtbar zu sein scheint, weil er im Zusammenhang mit dem Selbstverständnis eines Menschen verwendet wird. Von einer solchen Verwendung von „Identität“ distanziert sich He...