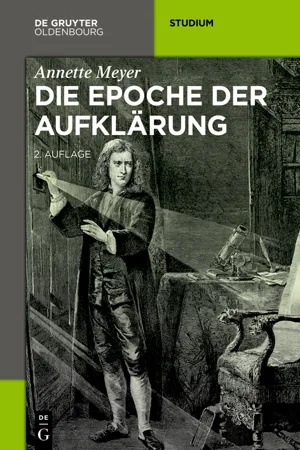
- 248 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Epoche der Aufklärung
Über dieses Buch
Überarbeitete Neuauflage des konzisen und facettenreichen Überblicks zur Frühen Neuzeit vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zur Französischen Revolution: Aufklärung - abgeschlossene Epoche oder offenes politisches Projekt?; Bewusstseinswandel am Beginn der Moderne; Entstehung der Wissensgesellschaft; Staatensysteme, Kolonialismus, Diskurse von Macht und Herrschaft; Orte, Protagonisten und Denkfiguren der europäischen Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Epoche der Aufklärung von Annette Meyer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Europäische Geschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1Die Aufklärung: Epoche oder Projekt?


Abbildung 1: Unbekannter Künstler: Isaac Newton using a prism to analyze the colors in a ray of light (Isaac Newton benutzt ein Prisma, um die Farben in einem Lichtstrahl zu untersuchen) (o. J.)
Der berühmte englische Dichter Alexander Pope (1688–1744) verfasste diese Grabinschrift für den Naturphilosophen Isaac Newton. Seine Zeilen versammeln in verdichteter Form zentrale Elemente der Selbststilisierung der Aufklärungsbewegung: Die Dunkelheit wird mit dem ehedem ausschließlich wahrgenommenen Schein der Dinge gleichgesetzt, während eine neue wissenschaftliche Perspektive schlagartig Licht auf die wahre, eigentliche Natur der Dinge wirft. Die Schöpfung wird durch die Möglichkeit der Erkenntnis ihrer selbst vollendet und in der Person Newtons allegorisiert. Der Newton-Kult ist Ausdruck des Selbstbildes des 18. Jahrhunderts: Newton hat die grundlegende Wende eines lange bestimmenden Weltbildes befördert; nun gilt es, das Licht der Erkenntnis in alle Bereiche weiterzutragen, die Aufklärung auf Dauer zu stellen.
Die Erfolgsgeschichte des Epochenbegriffs „Aufklärung“ ist in mehrerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens wurde der Begriff, anders als die meisten anderen geistesgeschichtlichen Epochenbezeichnungen (Humanismus, Barock etc.), nicht im Rückblick von Historikern auf die Epoche übertragen, sondern als Gegenwartsbeschreibung von den Zeitgenossen geprägt. Die Bezeichnung „Aufklärung“ vermochte es zweitens, sich langsam als Bestimmung eines historischen Zeitalters zu etablieren. In klassischen Handbüchern der Geschichtswissenschaft wird die Frühe Neuzeit meist in das Zeitalter der Reformation und das des Absolutismus unterteilt; beginnend ca. 1500 und endend ca. 1800. Dagegen wird in neueren geschichtswissenschaftlichen Publikationen das „Zeitalter der Aufklärung“ vermehrt als eigenständiger und tragfähiger historisch-politischer Epochenbegriff innerhalb der Neuzeit aufgefasst. Allerdings geht diese Praxis mit erheblichen Problemen der Datierung und der Abgrenzung von anderen Deutungsschemata einher. Ist eine philosophische Metapher dazu geeignet, eine Epoche zu charakterisieren? Lassen sich geistesgeschichtliche Strömungen wie die Aufklärung genau datieren, etwa durch das Erscheinen markanter Werke? War die Aufklärung überhaupt eine rein philosophische Bewegung? Wann beginnt die Epoche der Aufklärung?
1.1Die Epoche der Aufklärung
1.2Anfang und Ende der Moderne
1.3Konjunkturen und Entwicklung der Aufklärungsforschung
1.1Die Epoche der Aufklärung
Epochenbezeichnungen
Die Einteilung in Perioden zählt zu den zentralen Aufgaben innerhalb der Geschichtswissenschaft, und die Erläuterung von Zäsuren und Epochenbezeichnungen gehört zu den Grundüberlegungen des Historikers bei der Annäherung an seinen Gegenstand. Eine Analyse der gewählten Datierungen kann wiederum viel über Standort und Methode eines historischen Werkes aussagen.
heuritischer Nutzen
Dabei darf nicht aus dem Blick verloren werden, dass Epochenbezeichnungen einen idealtypischen Charakter haben. Es wird nicht behauptet, dass ein gewählter Begriff eine präzise Abbildung des Zeitalters darstellt, aber doch, dass er eine dominierende Tendenz repräsentiert. Die Debatte um den methodischen, heuristischen Nutzen einer in der Forschung etablierten Epochenbezeichnung kann allerdings so weit gehen, dass deren Tragfähigkeit grundsätzlich infrage gestellt wird. Derzeit wird etwa intensiv diskutiert, ob der Begriff des Absolutismus geeignet ist, die Epoche der Frühen Neuzeit angemessen zu erfassen; eine Debatte, die für die Bezeichnung des Zeitalters der Aufklärung bzw. des aufgeklärten Absolutismus nicht ohne Bedeutung ist (Asch 2005, S. 15f.). Häufig entzünden sich diese Debatten an der Frage der Repräsentativität eines gesellschaftlichen Teilbereichs für alle anderen: Kann ein politischer Herrschaftsstil (z. B. Absolutismus) oder eine kunsthistorische Richtung (z. B. Barock) den gesamtgesellschaftlichen Zustand eines Zeitalters umschreiben?
Kritik an universalem Geltungsanspruch
Kritisiert wird auch der Anspruch von Epochenbegriffen auf universelle Gültigkeit: Kann ein Konflikt, der für eine bestimmte Region markant ist (z. B. Konfessionalisierung), umstandslos auf eine andere übertragen werden? Sind nicht nahezu alle Epochenbegriffe – wie Antike, Mittelalter oder Neuzeit – aus einer eurozentrischen Perspektive entwickelt und daher ungültig für andere Teile der Welt?
Metapher Aufklärung
Wandel der Wahrnehmung
Die Unbestimmtheit der Metapher „Aufklärung“ und ihre Umstrittenheit seit ihrer zeitgenössischen Prägung im 18. Jahrhundert machen ihr heuristisches Potenzial aus, um eine spezifische Phase der Neuzeit zu fassen, was sich in der Historiografie nun auch seit einiger Zeit etabliert hat (vgl. Stollberg-Rilinger 2011; Müller 2002; Borgstedt 2004). Epochenbezeichnungen dienen häufig dazu, Aggregatzustände innerhalb von Veränderungsprozessen aufzuzeigen oder – vorsichtiger formuliert – Sandbänke in einem fließenden Gewässer auszuloten. Das Bild der Aufklärung ist nicht das eines aggregierten Zustandes, wie bei den Begriffen Humanismus, Absolutismus und Nationalismus, sondern das des Wandels selbst. Die damit verbundene Vorstellung von Veränderung bezieht sich allerdings nicht auf konkrete politisch-historische Ereignisse, wie sie etwa in Prozessbegriffen der Säkularisierung oder der Konfessionalisierung gefasst werden sollen, sondern auf einen Wandel der Wahrnehmung, dem die Zeitgenossen metaphorisch Ausdruck verliehen. Seit den 1720er-Jahren tauchen vermehrt Begriffsbildungen auf wie e´clairer oder e´claircissement bei dem Gelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz oder das aus englischen Wochenschriften übernommene Verbum to enlighten für „aufklären“ bei dem Schriftsteller Johann Christoph Gottsched (Stuke 1974, S. 247ff.). All diese Begriffe verweisen auf den Prozess des Erhellens, der Erleuchtung und damit einer veränderten Erkenntnis schlechthin: Sie sind Ausdruck eines neuen Blicks auf die Welt.
Epochenbruch Mittelalter – Frühe Neuzeit
Mit der Wendung „Aufklärung“ wird dann seit den 1770er-Jahren das Faktum eines Wahrnehmungswandels auf den Begriff gebracht. Die Wahrnehmung der Zeitgenossen korrespondiert mit der Zäsurbildung in der heutigen Forschung. Der Epochenbruch zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit wird nach herrschender Forschungsmeinung um 1500 datiert und durch Phänomene beschrieben, die Anlass gaben, das universale christliche Weltbild zu erschüttern: die Eroberung Konstantinopels durch die Türken (1453), die Entdeckung der Neuen Welt (1492) und der Auftakt der deutschen Reformation (1517). Als andauernde Faktoren einer fundamentalen Veränderung gegenüber der mittelalterlichen Gesellschaft wurden neben der Auflösung der einheitlichen Christenheit der entstehende Frühkapitalismus und der frühmoderne Verwaltungsstaat angegeben. Eine grundlegende Voraussetzung des Weltbildwandels breiterer Schichten bestand in einer neuen Formierung der Öffentlichkeit, die durch die erhebliche Verbesserung des mechanischen Buchdrucks durch Johannes Gutenbergs Einsatz von beweglichen Lettern entstanden war (Schulze 2002, S. 29; → ASB MüLLER, KAPITEL 12).
Infragestellung oder Bibel als Quelle
Insbesondere der Streit um die Deutungshoheit der christlichen Heilslehre in konfessionellen Konflikten sowie die Unterminierung bzw. Infragestellung der Bibel als einziger Erkenntnisquelle und universal gültigem Geschichtsbuch durch die Entdeckung fremder Welten nährten die Skepsis gegenüber überliefertem Wissen. Während im Verlauf der Frühen Neuzeit die Versuche der Versöhnung neuer Erkenntnisse mit der christlichen Lehre im Verfahren der Akkommodation langsam abnahmen, wurden vermehrt Versuche unternommen, einen neuen, unverstellten Blick auf Welt und Kosmos einzunehmen: Zentrale Werke, die diesen Prozess markieren, sind Johannes Keplers Astronomia Nova (Neue Astronomie, 1609), Francis Bacons Novum Organon Scientarum (Neues Organon der Wissenschaften, 1620) und Galileo Galileis Due nuove scienze (Zwei neue Wissenschaften, 1638).
Imperativ stetigen Zweifels
Die Gelehrten des 18. Jahrhunderts blickten auf diesen Prozess wachsender Skepsis gegenüber verordneten Weltbildern und Traditionen zurück und verdichteten die Erfahrung einer täuschungsgefährdeten menschlichen Wahrnehmung zum Imperativ des stetigen Zweifels. Damit standen sie in der Tradition von Rene ´ Descartes’ Discours de la me´thode (Abhandlung über die Methode, 1637), Baruch Spinozas Tractatus theologico-politicus (Theologisch-politischer Traktat, 1670) und John Lockes Essay Concerning Human Understanding (Versuch über den menschlichen Verstand, 1690). Alle Glaubenssätze, Gewohnheiten und unhinterfragten Gewissheiten kamen auf den Prüfstand der Kritik und konnten jederzeit mittels der natürlichen Vernunft als Aberglaube, Irrtum oder Unkenntnis entlarvt werden.
Aufklärung als doppelter Reflexionsbegriff
Aufklärung ist folglich insofern ein doppelter Reflexionsbegriff, als er erstens einen Wahrnehmungswandel metaphorisch zu beschreiben sucht, der schon geraume Zeit andauerte und im 16. und 17. Jahrhundert als Anspruch eines neuen Wissens um die Welt artikuliert wurde. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wird dieser Anspruch reflektiert, auf den Begriff gebracht und zweitens zu einem Programm, manchmal sogar zur Vorstellung einer naturhaft ablaufenden Programmierung der Menschheitsgeschichte, erhoben: Seit den 1770er-Jahren entsteht der praktische Aufklärungsbegriff als Wissenschafts-, Erziehungs- und Bildungsprojekt. Und spätestens in der Auseinandersetzung um „wahre“ und „falsche“ Aufklärung zur Zeit der Französischen Revolution gerät der ideologiekritische Aufklärungsbegriff selbst in den Verdacht, Ideologie zu sein.
Fortsetzung von Traditionen
Wille zur Veränderung
Wie lässt sich ein solcher komplexer Reflexionsbegriff mit einem Kulturraum und einer Epoche in Übereinstimmung bringen? Vorstehende Überlegungen zeigen, dass das Zeitalter der Aufklärung nicht präzise mit dem 18. Jahrhundert gleichgesetzt werden kann. Die zeitgenössischen Kommentatoren des 18. Jahrhunderts sahen sich vielmehr als Erben einer lange verfemten philosophisch-wissenschaftlichen Avantgarde. Es schienen sich ihnen zahlreiche neue wissenschaftliche, soziale und politische Möglichkeiten zu eröffnen, um Ansätze einer freieren Selbstverortung und Selbstbestimmung des Menschen zu verbreiten, die zuvor lediglich in kleinen Gelehrtenzirkeln debattiert worden waren. Die Gelehrten des 18. Jahrhunderts setzten damit die philosophische Tradition der Frühaufklärung fort, und es wurde ihnen sogar vorgeworfen, dass sie diesem Gedankengut wenig Neues hinzugefügt hätten. Was sie aber taten war, ältere Ideen zu bündeln, zu popularisieren sowie – und das ist das dramatisch Neue – sie in die Praxis des täglichen Lebens zu übersetzen. Wenn das nicht sofort möglich war, dann sollte zumindest gesichert sein, dass es in der Zukunft gelänge. Diese Gruppe der Aufklärer, verteilt über die Nationen Europas und Nordamerika, war deshalb eifrig darum bemüht, ihre eigene Gegenwart und Gesellschaft unverhüllt und unvoreingenommen – aus ihrer Genese mit den Mitteln der Vernunft – zu beschreiben und zu durchdringen, um sie zu verändern. In der angelsächsischen Forschung gibt es entsprechend eine Tendenz, die Aufklärung nicht als philosophische Strömung zu betrachten, was durch die Heterogenität der Bewegung auch in der Tat problematisch ist, sondern als Gruppe von Personen, die durch verschiedene Mittel eine „Kampagne zur Veränderung des Bewusstseins“ lancierte (Darnton 1996, S. 5).
1.2Anfang und Ende der Moderne
Was ist Aufklärung?
Als diese „Kampagne“ ihren Höhepunkt erreicht hatte, wurden Stimmen laut, die den Gestus der Kritik in Zweifel zogen und eine Offenlegung der versteckten Agenda der Aufklärung forderten. Diese Forderung nahm die Berliner Monatsschrift 1783 zum Anlass, die Preisfrage „Was ist Aufklärung?“ auszuloben.
Antworten von Kant und Mendelssohn
Die Beantwortung der Frage durch den Philosophen Immanuel Kant (1724–1804) ist zu einem Schlüsseltext der Aufklärungsforschung geworden. Weniger bekannt ist, dass der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn (1729–86) für seine Antwort „Über die Frage: Was heißt aufklären?“ den ersten Preis erhielt. Eine kombinierte Lektüre beider Texte zeigt deutlich den zweifachen Charakter des Aufklärungsbegriffs: Während bei Mendelssohn die konkrete Beförderung des Bewusstseinswandels durch Bildung und Kultur im Vordergrund steht, legt Kant den Schwerpunkt seiner Argumentation auf das andauernde Projekt der Aufklärung. „Der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Kant 1990, S. 9) ist ein fortschreitender Emanzipationsprozess, der erst in der Zukunft vollendet werden wird.
Verzeitlichung des Denkens
Modernes Weltbild
Kollektivsingulare
Die Zukunftsvorstellung wurde nicht mehr mit der christlichen Heilserwartung gleichgesetzt, sondern in ein neues theoretisches Modell der Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsanalyse überführt. Diese Verzeitlichung des Denkens ist als Inbegriff modernen Bewusstseins interpretiert worden: Die Bestimmung des Menschen ist demnach nicht mehr von Gott gelenkt, sondern ein immane...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Die Epoche der Aufklärung
- 1 Die Aufklärung: Epoche oder Projekt?
- 2 Die Erweiterung des Horizonts
- 3 Die Erfahrung der Welt
- 4 Die Entdeckung der Ungleichheit
- 5 Das europäische Mächtesystem
- 6 Kolonialismus und Kosmopolitismus
- 7 Diskurse von Macht und Herrschaft
- 8 Orte der Aufklärung: Öffentlichkeit und Untergrund
- 9 Protagonisten der Aufklärung: Die Erfindung des Intellektuellen
- 10 Denkfiguren der Aufklärung: Toleranz und Kritik
- 11 Erkenntniswege der Aufklärung: Vernunft, Sinne, Übersinn
- 12 Reaktionen der Aufklärung
- 13 Maximen der Aufklärung: Bildung, Erziehung, Emanzipation
- 14 Kunstgriffe der Aufklärung: Revolution, Fortschritt, Geschichte
- 15 Serviceteil
- 16 Anhang