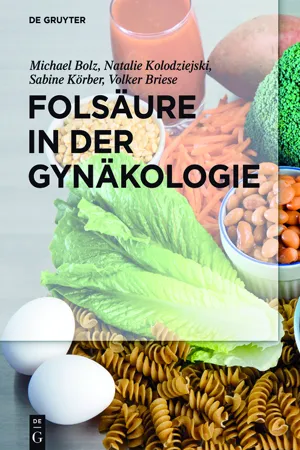![]()
1Einleitung
Schon in den 60er Jahren stellte die Problematik Folsäure und Schwangerschaft eine wichtige wissenschaftliche Fragestellung dar (Hibbard et al., 1965). Es wurde festgestellt, dass das Wiederholungsrisiko bei Frauen, die bereits ein Kind mit einem Neuralrohrdefekt (NRD) geboren hatten, durch eine perikonzeptionelle Folsäuresupplementierung gesenkt werden kann (Smithells et al., 1981). Später bestätigte sich auch die Vermutung, dass das erste Auftreten einer derartigen Fehlbildung ebenfalls durch eine adäquate Folsäureversorgung reduziert werden kann (Czeizel, Dudas, 1992).
Danach befassten sich weitere Studien mit dem Thema der optimalen Dosis und dem Zeitraum, in dem Folsäure substituiert werden sollte. Der embryonale Neuralrohrverschluss erfolgt zwischen dem 21.–28. Tag nach der Konzeption – einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Frauen noch keine Kenntnis von ihrer Schwangerschaft haben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Frauen im gebärfähigen Alter eine gute Folsäureversorgung aufweisen.
Trotz der Empfehlungen zur Folsäuresupplementierung ist die Folsäureversorgung in der Bevölkerung zu einem großen Teil mangelhaft und auch der Wissensstand zu diesem Thema fällt unbefriedigend aus (Stengl et al., 2000).
Gesundheitspolitisch ist dieses Thema deshalb von großer Bedeutung und stellt nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene eine enorme Herausforderung dar.
Derzeit bestehen folgende drei Optionen, mit denen verschiedene Länder versuchen, die Folsäureversorgung in ihrer Bevölkerung zu verbessern (Eichholzer et al., 2006):
- Folsäuresupplementierung in Form von Nahrungsergänzungsmitteln in Kombination mit einer ausgewogenen und folatreichen Ernährungsweise,
- Nahrungsmittelanreicherung auf freiwilliger Basis,
- verpflichtende Folsäureanreicherung (FSA) von (Grund-)Nahrungsmitteln.
In der vorliegenden Publikation werden diese Möglichkeiten ausführlich diskutiert und evaluiert. Es wird überprüft, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Strategien mit sich bringen.
Neue Ansatzpunkte zur Verbesserung der Folsäureversorgung in der Bevölkerung und insbesondere unter den Frauen im gebärfähigen Alter werden analysiert.
In dieser systematischen Übersichtsarbeit erfolgt zudem eine evidenzbasierte Stellungnahme zur Studienlage bezüglich der Folsäureprävention in der perikonzeptionellen Periode.
Unter Einbeziehung der bisher bestehenden Leitlinien zur täglichen Dosis der Folsäureeinnahme und der intensiven Studienauswertung werden die Empfehlungen zur Folsäuresupplementierung entsprechend neu aufgearbeitet und gegebenenfalls optimiert. Bestimmte vorbestehende Risikofaktoren bei Frauen, die das Auftreten eines Folsäuremangels verstärken und damit das Risiko für kongenitale Fehlbildungen bei den Nachkommen erhöhen können, sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden (z. B. Einnahme von Antiepileptika, Diabetes mellitus, Adipositas, sozioökonomischer Status).
![]()
2Folsäure und Folate
FS gehört zu den wasserlöslichen Vitaminen der Gruppe der B-Vitamine (Vitamin B9) (Stover, 2004). Sie wurde erstmals 1941 aus den Blättern von vier Tonnen Spinat durch Esmond Emerson Snell chemisch rein isoliert. Folglich leitet sich auch der Name aus dem Lateinischen von Blatt = folium ab (Friedrich, 1987).
Im Jahr 1946 gelangen Aigner und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern die Struktur- und Totalsynthese (Zoch, 2004).
Das Grundgerüst der FS besteht aus einem Pteridinring, einer para-Aminobenzoesäure und Glutamat (Pfeiffer et al., 1994) (Abb. 2.1).
Abb. 2.1: Strukturformel der Folsäure (Pteroylmonoglutamat).
Die Substanzklasse der FS beinhaltet etwa 140 verschiedene Derivate (= Gesamt-Folate). Sie unterscheiden sich an folgenden drei Stellen des Grundmoleküls (Pfeiffer et al., 1994):
- Oxidationsstufe des Pteridinrings,
- Art der Substitution an den Atomen N5 und N10 (z. B. C1-Einheiten),
- Anzahl der Bindung von Glutamylresten (zwei bis sieben).
In Abb. 2.2 ist das Grundgerüst mit den Ansatzstellen für Derivate dargestellt.
Abb. 2.2: Folat-Grundgerüst mit Ansatzstellen für Derivate.
Daraus ergeben sich folgende wichtige Strukturen (Tab. 2.1):
Tab. 2.1: Strukturen und Konfigurationen der natürlichen Folatderivate (Pfeiffer 1994).
Die biologisch aktiven Formen dieses Vitamins sind die 5,6,7,8-Tetrahydrofolsäure (THF) und ihre C1-substituierten Derivate in polyglutaminierter Form. Die Coenzymfunktion der Folate im Organismus beruht auf der Fähigkeit, solche C1-Substituenten binden zu können.
Natürlich vorkommende Folate in der Nahrung und Folate im menschlichen Gewebe bestehen hauptsächlich aus Polyglutamaten. Diese nehmen sowohl die Speicher- als auch die eigentliche Coenzymfunktion ein.
Monoglutamate hingegen stellen die Transportform der Folate dar, da die Zellmembran nur von diesen passiert werden kann. Ausschließlich die Pteroylmonoglutaminsäure (PGA) kann im Plasma und Urin nachgewiesen werden (Shane, 1989).
Hiervon abzugrenzen ist die synthetische Folsäure, bei der am Carboxylende lediglich ein Monoglutamatrest gebunden ist. Diese Form wird zur Anreicherung von Nahrungsmitteln und in Vitaminpräparaten verwendet.
Zur besseren Verständlichkeit wird an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen, dass sich im Weiteren die Bezeichnung Folat auf das in der Nahrung vorkommende Vitamin bezieht, während die FS nur die PGA bezeichnet.
2.1Physiologie – Resorption, Transport, Speicherung und Ausscheidung
Der komplexe Folatstoffwechsel ist durch eine Vielzahl von Enzymen, Transportproteinen und Rückkopplungsschleifen charakterisiert.
Die über die Nahrung aufgenommenen Folate (60–80 % Pteroylpolyglutamate) werden im Dünndarm zunächst durch die Υ-Glutamyl-Carboxypeptidase zu Monoglutamaten hydrolysiert (Rosenberg et al., 1969). Das Enzym in der jejunalen Bürstensaummembran stellt eine Exopeptidase mit neutralem ph-Optimum und mit gleicher Affinität für Polyglutamate unterschiedlicher Kettenlänge dar. Medikamente und Alkohol können sie beeinflussen. Im proximalen Jejunum wurde das stärkste Ausmaß intestinaler Folatresorption beobachtet. Durch die Mukosamembran erfolgt der Transport überwiegend aktiv. Er wird durch Glucose und Natrium stimuliert und folgt einer Sättigungskinetik. Daneben werden etwa 20–30 % der Folate über passive Diffusion aufgenommen (Baessler, 2002).
Im nächsten Schritt erfolgt in den Mucosazellen eine Reduktion sowie ggf. auch schon eine Methylierung der Folate (→ etwa 80 % 5-Methyl-Tetrahydrofolsäure (5-Me-THF)).
Die 5-Me-THF wird über das Blut zur Leber transportiert. Die Umwandlungskapazität von FS zur 5-Me-THF ist beschränkt und bei einer höheren Zufuhr (> 260 μg FS als Einzeldosis) gelangt auch nicht verstoffwechselte FS über den Blutkreislauf zur Leber. Diese wird im Körper in Dihydrofolat umgewandelt (Kelly et al., 1997).
Die Leber stellt das Hauptstoffwechsel- und Hauptspeicherorgan von Folaten dar. Etwa 10–20 % der von ihr aufgenommenen Folate (in Form von nichtmethylierten Polyglutamaten) werden gespeichert und der Rest über die peripheren Blutbahnen zu den verschiedenen Geweben weitertransportiert. Neben der Speicherung erfolgt in der Leber auch die Reduktion zu biologisch verwertbaren THF-Verbindungen (Friedrich, 1987). Der Serumspiegel wird längerfristig über diesen Auf- und Abbau der nichtmethylierten Polyglutamate aufrechterhalten. Er unterliegt ernährungsbedingten Schwankungen und stellt somit einen sensiblen Indikator für die aktuelle Folatbilanz im Organismus dar (Green, 2011). Reife Erythrozyten besitzen fast ausschließlich eine Speicherfunktion und enthalten deshalb eine höhere Konzentration a...