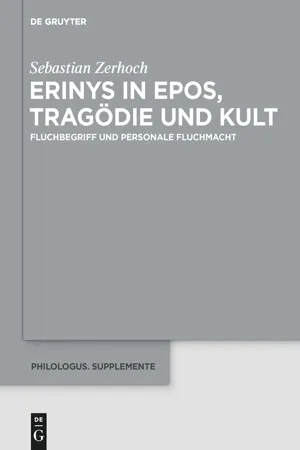![]()
1. Einleitung
In der vorliegenden Studie sollen die Bedeutung und Funktion von έρινύς in der griechischen Literatur und Religion von Homer bis zu Euripides grundlegend aufgearbeitet werden. Erstaunlicherweise gibt es bislang keine Arbeit, in der die methodologischen und interpretatorischen Schwierigkeiten, vor denen die Forschung bei diesem Thema steht, systematisch untersucht werden. Es fehlt eine Studie, in der versucht wird, die unterschiedlichen Verwendungsweisen von erinys als Appellativ in abstrakter Bedeutung, als Bezeichnung zur Charakterisierung menschlicher Personen, als Eigenname einer Einzelgottheit, als Bezeichnung kollektiver Mächte sowie als Kultepiklese zu erklären und zueinander in Beziehung zu setzen.
Stattdessen gibt es zahlreiche Bemerkungen zu einzelnen Stellen und Texten in Kommentaren sowie kurze Überblicksdarstellungen in mythologischen Handbüchern und religionshistorischen Werken. Die Forschungsergebnisse sind insofern unbefriedigend, als die Einzelbeobachtungen auf die jeweilige Stelle bzw. den jeweiligen Text fokussiert sind und die religionshistorisch ausgerichteten Überblicke nicht auf einer detaillierten Analyse der literarischen Stellen basieren. In der Monographie Götter, Geister und Dämonen. Unheilsmächte bei Aischylos, die Franziska Geisser im Jahr 2002 vorgelegt hat, werden wichtige Aspekte und Schwierigkeiten der Verwendung von erinys angesprochen, aber auch Geisser leistet im Rahmen ihrer Arbeit keine grundlegende Aufarbeitung des gesamten Themenkomplexes.
In der Forschung wird gewöhnlich wie selbstverständlich vorausgesetzt, dass in den Texten mit έρινύς im Singular und Plural immer beseelte göttliche Mächte gemeint sind. Auf dieser Basis werden dann eine Vielzahl von Aufgaben und die göttliche Qualität ,der Erinyen‘ bestimmt.1 Gewöhnlich werden sie ganz allgemein den chthonischen Mächten oder den sogenannten kleineren Göttern zugerechnet und als Dämonen oder Geister bezeichnet, in einzelnen Fällen aber auch als Göttinnen angesehen.
Diese Zuordnungen sind jedoch problematisch und werden der komplexen Verwendungsweise von erinys nicht gerecht. Erinys bzw. Erinyes erscheinen zwar an einer Reihe von Stellen als wirkende Mächte und vereinzelt ist im Singular auch von Erinys als Θεá oder Θεός und im Plural von Erinyes als Θεαί oder δαίμονες die Rede, häufig wird έρινύς aber auch als Appellativ verwendet und mit einem Genitiv der Person verbunden: In welchem Sinne aber können die ,erinys des Oidipus‘ oder die ,erinyes einer Mutter‘ Gottheiten sein?2
Die Charakterisierung als chthonische Mächte wird zwar dadurch suggeriert, dass an einigen Textstellen als Wohnort der Erinys bzw. der Erinyes die Unterwelt angegeben und eine Beziehung zu den Mächten des Todes hergestellt wird; der zweifellos vorhandene chthonische Aspekt spielt aber sehr häufig gar keine Rolle. Erinys bzw. Erinyes wirken fast immer auf der Erde und sind viel häufiger mit Moira, Dike und Ará assoziiert als mit chthonischen Mächten. Es erscheint daher zweckmäßig, Erinys bzw. Erinyes nicht grundsätzlich und ausschließlich den chthonischen Gottheiten zuzurechnen und nicht alle Eigenschaften und Besonderheiten darauf zurückzuführen, sondern vielmehr ganz gezielt zu fragen,warum und in welchem Sinn der chthonische Aspekt in bestimmten Zusammenhängen eine Rolle spielt und in anderen nicht.3
Die Kategorisierung ,der Erinyen‘ als kleinere Gottheiten bzw. Dämonen oder Geister ist sinnvoll, wenn es darum geht hervorzuheben, dass Erinys bzw. Erinyes nicht auf der gleichen Stufe wie die Olympier stehen, sondern weder deren personale Individualität besitzen noch im Kult eine vergleichbare Rolle spielen. Sie ist jedoch unzureichend, weil die ,minor gods‘ eine höchst heterogene Gruppe bilden, zu der Naturgottheiten wie die Nymphen oder Pan ebenso zählen wie Konzepte und Personifikationen wie Moira bzw. Moirai, Ker bzw. Keres, Ará bzw. Aral, Dike, Eris, Phobos oder Thanatos.4 Es ist also wichtig zu klären, welcher Art von kleineren Gottheiten Erinys bzw. Erinyes zugerechnet werden können, und ihren Wirkungsbereich so genau wie möglich zu bestimmen. Ansätze dazu sind durchaus vorhanden. So beschreibt Sommerstein in der Einleitung zu seinem Eumeniden-Kommentar die Aufgaben ,der Erinyen‘ folgendermaßen:
Erinyes, then, to an educated Athenian in 458 B.C., were avengers of murders, perjury and other wrongs, who might exact their vengeance from the wrongdoer himself or from his descendants. They were champions of the right of senior kinsfolk and especially of parents. They were guardians of δίκη in the broadest sense, in the natural as well as the social universe. They could be thought of as the embodiment of a curse; they could be thought of as the causers of that ruinous mental blindness called ἄτη. They were merciless and implacable, and unless specially assisted by a god (as the Stesichorean Orestes was) man was helpless against them.When they were conceived as having a bodily form, it was that of serpents; but they could sometimes be all but identified with the Keres, bloodsucking, bestial death-spirits. […] in particular the idea that the Erinyes deter violations of δίκη, with its paradoxical implication that though they work in horrendous and barbaric fashion yet an ordered society could not exist without them […], can be traced back to Homer.5
In dieser Zusammenfassung sind zwar fast alle Aufgaben von Erinys bzw. Erinyes berücksichtigt, die von Homer bis zur Tragödie vorkommen. Was fehlt, ist eine Berücksichtigung der appellativischen Verwendung von έρινς und ein gemeinsamer Nenner der aufgezählten Funktionen. Der Katalogvermittelt den Eindruck,als könnten ,die Erinyen‘ beliebig viele und ganz unterschiedliche Qualitäten annehmen oder verkörpern. Aber sind die von Sommerstein angeführten Funktionen tatsächlich so verschieden voneinander, dass sie nicht als unterschiedliche Aspekte eines einzigen Konzepts verstanden werden können?
Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, müssen eine ganze Reihe von Beobachtungen erklärt werden. Sommerstein spricht allein von ,den Erinyen‘ im Plural. Doch warum wird neben dem Plural έρινέες in den Texten ungefähr ebenso häufig der Singular έρινές verwendet?6 Wie ist es zu verstehen, dass es Stellen gibt, an denen mit dem Singular anscheinend Erinys als wirkende Einzelmacht gemeint ist, gleichzeitig aber auch Stellen, an denen έρινύς offenbar appellativisch in Bedeutungen wie ,Fluch‘, ,Zorn‘ oder ,Rache‘ verwendet wird? Ist es sinnvoll, die appellativische Verwendung als ,metonymischen abusus‘7 abzutun oder davon zu sprechen, dass „die Person der Erinyen im Verblassen“8 sei? Wie ist es dann zu verstehen, dass bereits bei Homer nebeneinander von den erinyes einer bestimmten Person, der Erinys als Einzelmacht und kollektiven Erinyes die Rede ist und eine konkrete personale Vorstellung der Erinyes erst in der Tragödie evoziert wird? Und wie ist es zu erklären, dass es gerade bei der Verwendung des Plurals έρινύες oft nicht einfach ist zu entscheiden, ob damit ein göttliches Kollektiv, eine Bezeichnung für bestimmte Einzelmächte oder einfach appellativisch ,Flüche‘ gemeint sind?
Alle diese Fragen sind bisher nicht beantwortet, ja in der Regel nicht einmal gestellt worden,9 und mit diesen Fragen hängen weitere Fragen zusammen, die sich auf das Wirken von Erinys bzw. Erinyes beziehen: Wie können die Mächte, die fast immer zerstörerisch wirken und für die Vernichtung eines oikos oder eines ganzen genos verantwortlich gemacht werden, auch als Schützer der sozialen bzw. natürlichen Ordnung erscheinen? Warum ist zwar häufig, aber nicht ausschließlich von έρινς im Bereich der Familie und bei Mord die Rede? Und warum werden Erinys bzw. Erinyes in den Texten zuweilen in Abhängigkeit von den olympischen Göttern gesehen, zuweilen aber als Mächte, denen sogar die Olympier unterworfen sind?
Um alle diese Beobachtungen befriedigend zu erklären, ist es notwendig, jede einzelne Stelle, an der έρινύς erwähnt wird, sprachlich und inhaltlich auf Bedeutung und Funktion hin zu untersuchen.10 Diese Vorgehensweise ist für die vorliegende Arbeit auch deshalb gewählt worden,weil zahlreiche Stellen vom Epos bis zur Tragödie in der Forschung bislang noch gar nicht genauer untersucht worden sind.
Es wird sich zeigen, dass erinys als Konzept verstanden werden kann, bei dem verschiedene Verwendungs- und Erscheinungsweisen gleichberechtigt nebeneinander vorkommen und es je nach Kontext und Situation angebracht erscheint, von Appellativ oder von göttlicher Macht zu sprechen.11 Die personale Vorstellung, die sich an den verschiedenen Textstellen in unterschiedlich klarer Ausprägung zeigt, kann am besten mit dem Begriff der Personifikation beschrieben werden.Wie bei moira oder ker, themis oder dike, charis oder mousa, die durch ähnlich vielfältige Verwendungs- und Erscheinungsweisen gekennzeichnet sind und doch jeweils einen ganz bestimmten Bereich menschlichen Handelns betreffen, gibt es auch für die auf den ersten Blick heterogen wirkenden Attribute und Aufgaben der Erinys bzw. Erinyes einen gemeinsamen Nenner: Fluch – als Verfluchung und Fluchzustand. Anders als das Wort άρά, welches den Fluch in einem engeren Sinn als Sprechakt, als konkrete Verfluchung bezeichnet, steht έρινύς für einen breiteren Fluchbegriff: έρινύς umfasst den Zorn, in dem Menschen einen Fluch sprechen oder Götter einen Fluchzustand verhängen, ebenso wie die Wirkung der Schädigung und Vernichtung, die in der Verfluchung gewünscht wird und sich im Fluchzustand realisiert. Darüber hinaus schließt έρινύς auch die Vorstellung vom Fluch als wirkender Macht mit ein: In έρινύς kommt die archaische Vorstellung von der Gewalt des Fluchs zum Ausdruck.
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: In Kapitel 2 werden die Verwendungsweisen von έρινύς detailliert besprochen,und es wird der Begriff näher erläutert, auf den erinys zurückgeführt werden kann. In Kapitel 3 beginnt die Analyse der einzelnen Textstellen. Hier werden zunächst die Stellen besprochen, an denen es naheliegt, erinys als Appellativ in abstrakter Bedeutung zu verstehen und als appellativische Bezeichnung zur Charakterisierung menschlicher Personen. In Kapitel 4 werden dann die Einzelstellen analysiert, an denen Erinys bzw. Erinyes als wirkende Mächte erscheinen, die in unterschiedlichem Grad personifiziert werden. Zuerst geht es hier um die als wirkend gedachte erinys einer Person (4.1), dann um die als eigenständige Einzelmacht erscheinende Erinys im Singular (4.2) und schließlich um die ebenfalls eigenständigen Erinyes im Plural (4.3).12 In Kapitel 5 werden die Bedeutung und Funktion der Verfolgerinnen des Orestes in Aischylos' Eumeniden sowie in den Atridenstücken des Euripides diskutiert. Diese Tragödien werden deshalb in einem eigenen Kapitel behandelt, weil nur in ihnen eine ganz konkrete Vorstellung von den Erinyes als wirkenden Mächten und integralen Gestalten eines Mythos hervorgerufen wird. In Kapitel 6 wird das Wortfeld von έρινές untersucht. Hier geht ...