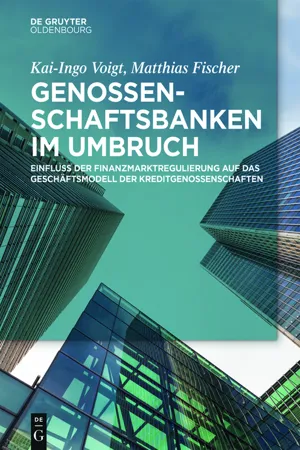![]()
1Einleitung
1.1Problemstellung
Die Genossenschaften in Deutschland haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig sie für das wirtschaftliche und soziale Leben in Deutschland sind.
DGRV, 2013
Das vorangestellte Zitat des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes (DGRV) verdeutlicht die besondere gesellschaftliche Bedeutung der Genossenschaften im Allgemeinen. So findet sich diese Unternehmensform seit über 150 Jahren in allen Bereichen des täglichen Lebens wieder, z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Energieversorgung, Finanzwesen sowie Kultur. Insbesondere im Finanzwesen konnten Genossenschaften in der jüngeren Vergangenheit ihre unumstrittene Bedeutung unter Beweis stellen, indem sie sich in den Turbulenzen an den Finanzmärkten als besonders krisenresistent herausgestellt haben. Trotz dieser Erfolgsgeschichte sehen sich Genossenschaftsbanken dennoch zahlreichen Herausforderungen in Bezug auf ihre zukünftige Entwicklung gegenübergestellt.
Besonders relevante Herausforderungen sind hierbei die Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche, insbesondere im Hinblick auf die Generation der „Digital Natives“, der Eintritt neuer Wettbewerber wie sogenannte Fintechs, die sich auf eine Nische konzentrierende IT-Start-Ups darstellen, der demografische Wandel und damit verbundene Schwierigkeiten in der Gewinnung junger Kunden und neuer Mitglieder, das historisch niedrige Zinsniveau sowie die in immer mehr Lebensbereiche vordringende Globalisierung und damit verbundene Erhöhung des Wettbewerbs durch den Einstieg ausländischer Direktbanken.1
Neben diesen Herausforderungen erweisen sich vor allen Dingen die Folgen der Finanzmarktkrise 2008 als eine hochaktuelle Problematik für den gesamten Finanzmarkt sowie insbesondere für Kreditgenossenschaften.2
Zum einen kam es zu kurzfristigen Handlungen, z.B. zur Verstaatlichung von verschiedenen Kreditinstituten.3 Zum anderen resultierte die Finanzkrise in langfristigen Folgen für das gesamte Finanzsystem. Die Regulierungsvorgaben für Finanzmärkte4 wurden von Finanzinstituten der Europäischen Union bereits teilweise umgesetzt. Die verschärfte Regulierung soll der langfristigen Stabilisierung des Finanzsektors dienen und helfen, zukünftige Krisen zu vermeiden. Die neuen Regulierungen umfassen insbesondere die Überwachung von Banken, die Anforderungen an das regulatorische Eigenkapital, die Liquiditätsvorschriften und das Leverage Ratio. Davon betroffen sind alle Kreditinstitute, unabhängig von deren Größe oder Geschäftsmodell. Die Konsequenz daraus ist, dass sich nicht nur große Institute den veränderten Bedingungen anpassen müssen, sondern auch kleinere Institute wie die traditionellen deutschen genossenschaftlichen Kreditinstitute.
Der Einfluss von Finanzmarktregulierungen auf genossenschaftliche Kreditinstitute erfährt auch in der wissenschaftlichen Literatur zunehmende Beachtung und dient entsprechend als Untersuchungsgegenstand mehrerer Publikationen. Pleister kommt zu dem Ergebnis, dass Geschäftsmodelle von Genossenschaftsbanken im Allgemeinen von europaweiten Regulierungen beeinflusst werden, jedoch das Ausmaß des Einflusses noch untersucht werden muss.5 Domikowski, Heese und Pfingsten analysieren den Einfluss der Regulierungen auf deutsche Genossenschaftsbanken,6 gehen aber nicht auf die möglichen Auswirkungen auf deren Geschäftsmodell ein. Schätzle beleuchtet in seiner quantitativen Untersuchung die Auswirkungen von Basel III,7 lässt dabei aber die Gesamtbetrachtung des genossenschaftlichen Geschäftsmodells unberücksichtigt. Eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) untersucht die Auswirkungen der Regulatorik auf deutsche Genossenschaftsbanken.8 Diese Arbeit legt den Fokus auf Kostenaspekte und weniger auf die Betrachtung des Geschäftsmodells.
Die genannten Untersuchungen zeigen, dass das Thema „Auswirkungen der Regulierung auf die genossenschaftlichen Kreditinstitute“ auch von wissenschaftlicher Seite eine hohe Relevanz besitzt. Allerdings sind bislang nur vereinzelte Aspekte der Banken bzw. einzelner regulatorischer Vorgaben betrachtet worden. Eine Analyse in Bezug auf das Geschäftsmodell von Kreditgenossenschaften in vollem Umfang ist bisher unterblieben. Genau an dieser Stelle setzt das hier vorliegende Werk an.
1.2Zielsetzung und Forschungsfrage
Die aufgezeigte hochaktuelle Relevanz sowie die bestehende Forschungslücke verdeutlichen, dass zweifelsohne ein Bedarf hinsichtlich der Überprüfung und Beurteilung der bestehenden Geschäftsmodelle von genossenschaftlichen Kreditinstituten hinsichtlich der Auswirkungen der Finanzmarktregulierung gegeben ist.
Um eine Gesamtbetrachtung überhaupt erst möglich zu machen, soll das bestehende Geschäftsmodell von Genossenschaftsbanken in all seinen Facetten untersucht werden. Dazu ist es notwendig, jene Regulierungen zu identifizieren, die gerade für Kreditgenossenschaften eine besondere Relevanz besitzen. Des Weiteren ist vor dem Hintergrund der zunehmenden Regulierungen eine systematische Bewertung der Auswirkungen notwendig, um die Zukunft von genossenschaftlichen Kreditinstituten in Deutschland bewerten zu können. Darüber hinaus hat das vorliegende Werk das Ziel, mittels einer Szenarioberechnung die Auswirkungen der Eigenkapitalunterlegungspflicht für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch zu untersuchen, um potentielle Folgen für die Kreditvergabe abzuschätzen. Zu guter Letzt werden diverse Studien betrachtet, die die Auswirkungen der Regulatorik auf die Rentabilität des Geschäftsmodells untersuchen. Alle diese Untersuchungen sollen also folgende Forschungsfrage beantworten:
Wie beeinflusst die Finanzmarktregulierung das Geschäftsmodell von etablierten genossenschaftlichen Kreditinstituten?
Abschließend sollen die Kernergebnisse der Untersuchung thesenartig zusammengefasst sowie klare Handlungsempfehlungen für die zukünftige Auseinandersetzung mit der Regulierung und der Sicherung des nachhaltigen Erfolgs der genossenschaftlichen Kreditinstitute gegeben werden.
1.3Vorgehen der Untersuchung
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Abschnitte, die sich jeweils mit einem separaten Untersuchungsgegenstand befassen. Im folgenden Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen zu deutschen Kreditgenossenschaften sowie zu dem Konzept des Geschäftsmodells vermittelt. Die anschließenden Kapitel 3 und 4 folgen einem Zwei-Stufen-Ansatz nach dem Prinzip der Triangulation. Zunächst stellt das Kapitel 3 die Ergebnisse einer qualitativen, empirischen Studie hinsichtlich des Geschäftsmodells der Kreditgenossenschaften vor. Darauf folgend werden in Kapitel 4 die Ergebnisse einer quantitativen Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der Finanzmarktregulierung auf das besagte Geschäftsmodell präsentiert sowie strategische Implikationen für die Entscheidungsträger der Banken vorgestellt. In Kapitel 5 folgt eine umfangreiche Szenariobetrachtung zum Zinsänderungsrisiko, bevor Kapitel 6 eine Analyse der existierenden Literatur zur Auswirkung der Regulierung auf die Rentabilität von Genossenschaftsbanken präsentiert. Im abschließenden Kapitel 7 wird in Thesen formuliert, welche Herausforderungen die Genossenschaftsbanken bewältigen müssen und es werden konkrete Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Sicherung der Profitabilität des Geschäftsmodells gegeben. Die nachstehende Abbildung 1.1 illustriert die Struktur des vorliegenden Werkes.
Abbildung 1.1: Aufbau der vorliegenden Arbeit9
![]()
2Theoretische Grundlagen
2.1Genossenschaftliche Kreditinstitute in Deutschland
2.1.1Die genossenschaftliche Rechtsform
Die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (eG) ist eine der ältesten der Welt – bereits 1889 wurde sie in der deutschen Gesetzgebung verankert. So beschreibt §1 des Genossenschaftsgesetzes das Wesen einer Genossenschaft wie folgt:
Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern (Genossenschaften), erwerben die Rechte einer ‚eingetragenen Genossenschaft‘ nach Maßgabe dieses Gesetzes.
Trotz der Verwurzelung in Deutschland ist das Wesen eines Genossenschaftsverbundes auch international anerkannt. Die International Co-operative Alliance legt folgende Definition fest:
Autonomous association of persons united voluntary to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.10
Diesen beiden Definitionen folgend, lässt sich eine Genossenschaft als Zusammenschluss einzelner Personen für die Erfüllung gemeinsamer Ziele in einer demokratischen Unternehmung bestimmen.
Genossenschaften folgen im Allgemeinen einigen spezifischen Merkmalen. Zu diesen Wesensmerkmalen zählen neben dem Förderauftrag der Genossenschaft für ihre Mitglieder die drei Prinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung sowie das Identitätsprinzip.11 All diese Prinzipien werden im Folgenden genauer beschrieben.
Förderzweck: Das absolute Wesensprinzip einer Genossenschaft ist der Förderauftrag. Dieser besagt, dass der gemeinsame Betrieb dazu beitragen soll, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Belange jedes einzelnen Mitglieds der Genossenschaft zu unterstützen. Hierzu zählt neben der materiellen Förderung auch die Förderung ideeller Mitgliederbelange. Dieser Zweck begründet sich in der ursprünglichen Idee einer Genossenschaft – dem Zusammenschluss einzelner Personen zur Verbesserung von in Not geratenen Bauern und Handwerkern.12
Selbsthilf...