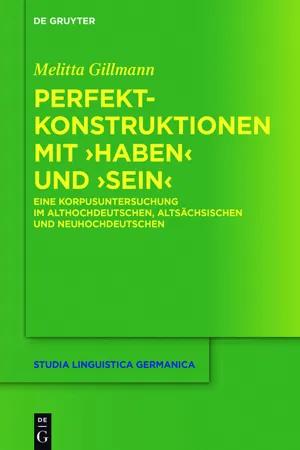![]()
1Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Das Perfekt zählt zu den meist untersuchten Gegenständen der deutschen Linguistikforschung. Es wird häufig diskutiert, welche Funktion(en) das Perfekt erfüllt (zu einer Übersicht s. Ehrich 1992, Thieroff 1992, Rathert 2004) bzw. ob sich die unterschiedlichen Lesarten unter eine einheitliche temporale Bedeutung fassen lassen (z.B. Klein 2000, Musan 2002: Kap. 2, Rathert 2004, Rothstein 2008) und – eng mit diesen Fragen verwandt –, ob es sich um eine Tempus- oder um eine Aspektkategorie handelt (z.B. Vater 2000, Musan 2002: Kap. 2, Rothstein 2008: Abschnitt 5.2). Bis heute wurde nicht abschließend geklärt, warum sich das Perfekt, vom Oberdeutschen (Obdt.) ausgehend, auf Kosten des synthetischen Präteritums ausbreitet (z.B. Reis 1894, Lindgren 1957, Trost 1980, Dentler 1997, 1998). Eine aktuelle empirische Studie untersucht, was die nach Norden hin gefächerte Zunahme des Präteritumgebrauchs aus gegenwartssprachlicher Sicht motiviert und ob es in norddt. Sprachregionen, die die Opposition zwischen Perfekt und Präteritum stärker bewahrt haben, Bedeutungsunterschiede gibt (Fischer 2015, i.Vorb.). Typologisch-vergleichende Arbeiten zeigen, dass sich das Nord-Süd-Gefälle weiter über die gesamte Germania fortsetzt: Im Deutschen (Dt.) und im Niederländischen (Ndl.) ist das Perfekt bereits zum Vergangenheitstempus grammatikalisiert und in den meisten Fällen mit dem Präteritum austauschbar. Dagegen steht es im Englischen (Engl.), Dänischen (Dän.) und Schwedischen (Schwed.) in funktionaler Opposition zum synthetischen Vergangenheitsausdruck, was von einem schwächeren Grammatikalisierungsgrad zeugt (z.B. Grønvik 1986, Ehrich/Vater 1989, Klein/Vater 1998, Rothstein 2008, Dammel et al. 2010, Schmuck 2013: Kap. 3.2). Seit jüngerer Zeit gilt das Interesse verstärkt den etwa seit dem Frühneuhochdeutschen (Fnhd.) belegten Doppelperfektformen (Rödel 2007, Welke 2009, Hundt 2011, Brandner/Salzmann/Schaden 2016). Mit Buchwald-Wargenau (2012) liegt jetzt sogar eine diachrone Untersuchung des Doppelperfekts vor.
Die vorliegende Dissertation betrachtet das dt. Perfekt unter einem anderen Aspekt: Sie widmet sich der Verteilung der Hilfsverbkonstruktionen haben + Partizip II und sein + Partizip II (im Folgenden kurz haben + V-PP und sein + V-PP). Dieses Thema wurde bisher nur selten aus funktionaler Perspektive behandelt (s. aber Hinze/Köpcke 2007, Gillmann 2011, 2015), dafür umso häufiger aus generativer. Hier gilt die Auxiliarselektion als Paradebeispiel einer sog. Unakkusativitätsdiagnostik (z.B. Alexiadou et al. 2004: 5ff.), was sogar so weit geht, dass sie mit Unakkusativität gleichgesetzt wird. Diese Arbeiten liefern interessante Beobachtungen zu sprachübergreifenden Übereinstimmungen der Auxiliarverteilung und zeigen Gemeinsamkeiten zwischen Verben mit sein-Perfekt und passiven Konstruktionen auf. Da sie sich v.a. für Universalien interessieren, thematisieren sie sprachspezifische Eigenheiten aber häufig nicht. Zudem konzentrieren sie sich auf syntaktische Erklärungen, weshalb Gebrauchsfaktoren wie Frequenz und Analogie, die sich aus der Sprachprozessierung ergeben, nicht mit einbezogen werden. Überraschenderweise gibt es bis heute kaum empirische Untersuchungen zur Hilfsverbverteilung im Deutschen (Dt.) (s. aber Hinze/Köpcke 2007, Keller/Sorace 2003).
Diese Arbeit betrachtet die Wahl der Auxiliare haben und sein aus gebrauchsbasierter Perspektive und nimmt eine empirische Untersuchung ausgewählter Bewegungsverben und Degree Achievements mit schwankendem Perfekthilfsverb vor. Der gebrauchsbasierte Zugang wirft ein neues theoretisches Licht auf das System der Perfekthilfsverben. Die empirische Untersuchung ergänzt bisherige Beobachtungen, indem sie für das Dt. spezifische Muster und Regelmäßigkeiten der Auxiliarwahl offenlegt.
Dabei wird die Hilfsverbverteilung nicht nur aus synchroner, sondern auch aus diachroner Perspektive betrachtet; d.h. es wird nach den historischen Ursachen und einer möglichen funktionalen Konditionierung des heutigen Systems gesucht. Zu diesem Zweck werden die Perfektkonstruktionen in der frühsten dt. Sprachstufe, dem Althochdeutschen (Ahd.), in den Blick genommen und quantitativ-qualitativ analysiert. Anders als im Neuhochdeutschen (Nhd.) muss dabei allerdings zunächst die Funktion der Konstruktionen bestimmt werden, um zu überprüfen, ob diese mit der Wahl des Hilfsverbs interagiert. Dieselbe Untersuchung wird im Altsächsischen (As.), der dem Ahd. am nächsten verwandten altgermanischen (altgerm.) Sprache, durchgeführt und mit den im Ahd. erzielten Ergebnissen verglichen. Der Vergleich dient dazu, eine mögliche regionale Staffelung aufzudecken. Im Vordergrund steht die Frage, ob das Perfekt in beiden altgerm. Sprachen Funktionsunterschiede erkennen lässt und ob sich diese Unterschiede in der Distribution der Hilfsverbkonstruktionen niederschlagen. Gerade der Vergleich zwischen beiden altgerm. Sprachen kann somit Aufschluss über eine mögliche funktionale Konditionierung der Hilfsverbverteilung geben.
Das zweite übergeordnete Ziel der Arbeit ist somit, Funktion und Verwendungskontexte der ahd. und as. Perfektfunktionen zu bestimmen und zu vergleichen. Beide Faktoren geben Aufschluss über den Grammatikalisierungsgrad der Konstruktionen. Somit geht es letztendlich auch darum, eine mögliche regionale Staffelung der Grammatikalisierung auszumachen. Die Ergebnisse werden durch jüngere Untersuchungen im Altenglischen (Ae.) ergänzt und somit auf die gesamte Westgermania erweitert.
Grundsätzlich können sich historische Untersuchungen nicht auf muttersprachliche Kompetenz stützen. Überdies besteht bei der Analyse feiner Funktionsunterschiede, wie sie zwischen den einzelnen Perfekttypen existieren, generell die Gefahr des subjektiven Urteils. Um bei der qualitativen Analyse dennoch eine möglichst hohe Objektivität zu gewährleisten, ist neben einer breiten Datenbasis ein Kriterienkatalog erforderlich, mit dem sich die Funktion in den Einzelbelegen messbar, operationalisierbar und vergleichbar machen lässt. Ein solcher Kriterienkatalog wird im Theorieteil ausgehend von der typologischen Literatur erarbeitet.
Das Buch gliedert sich insgesamt in drei Teile, von denen der erste die theoretische Grundlage (Teil I), die beiden weiteren die empirischen Untersuchungen in den altgerm. Sprachen (Teil II) und dem Nhd. (Teil III) enthalten. Die folgenden Abschnitte skizzieren knapp die Inhalte und Zielsetzungen der Einzelkapitel.
1.1Teil I: Theoretische Grundlegung
Der erste Teil liefert theoretische Grundlagen. Kap. 2 führt zunächst die Perfektkonstruktionen als Gegenstandsbereich der Arbeit ein und bettet sie in das konstruktionsgrammatische Modell ein (2.1-2.3). Dieser Teil dient dazu, das in dieser Arbeit zugrunde liegende Verständnis der Konstruktionen zu klären, v.a. ihre Funktion und ihre Verflechtung mit formal und funktional verwandten Konstruktionen wie dem Partizip II (im Folgenden kurz Part II) und dem Zustandspassiv. Danach wird Grammatikalisierung als Sprachwandelprozess vorgestellt, bei dem grammatische Konstruktionen entstehen, und Mechanismen diskutiert, die in diesem Prozess greifen (2.4-2.6). Es wird Hoppers Prinzip der Persistenz eingeführt, das eine diachrone Erklärung für sprachübergreifende Tendenzen der Hilfsverbverteilung bietet (2.7). Anschließend werden Ursachen für die Universalität von Grammatikalisierungspfaden nach Bybee (2010) umrissen (2.8).
Kap. 3 definiert die für diese Arbeit grundlegenden Kategorien Aktionsart, Tempus, Aspekt und semantische Transitivität. Zum einen werden die Konzepte selbst erklärt, zum anderen Grundbegriffe, die für diese Arbeit wesentlich sind (darunter Telizität), festgelegt. Dies ist v.a. mit Blick auf Aspekt und Aktionsart notwendig, da die Terminologie in der Forschungsliteratur uneinheitlich und häufig unpräzise gebraucht wird. In den Kap. zu Tempus und Aspekt wird, ausgehend von der Tempustheorie von Reichenbach (1947/1966), Klein (1994) und Kiparsky (2002), ein Grundgerüst erarbeitet, um unterschiedliche Funktionstypen des Perfekts zu definieren und voneinander abzugrenzen.
Kap. (4) widmet sich dann Funktionstypen, die in der frühen Phase der Grammatikalisierung entstehen. Hier wird das Ziel verfolgt, operationalisierbare Kriterien für die qualitative Analyse der ahd. und as. Perfektbelege zu erarbeiten. Da in dieser Arbeit die Aufgabe von Kompositionalität als konstitutives Element von Grammatikalisierungsprozessen angesehen wird, ist zunächst die genuine Funktion des freien Part II zu klären, um kompositionelle und nicht-kompositionelle Semantik voneinander abgrenzen zu können (Abschnitt 4.1). Anschließend wird der universelle Grammatikalisierungspfad nachgezeichnet, der laut der typologischen und sprachhistorischen Literatur vom Resultativ über das Präsensperfekt zum Vergangenheitstempus führt (4.2). Die folgenden Abschnitte nehmen die ersten beiden Entwicklungsstufen dieses Pfads genauer in den Blick, wobei fünf Perfekttypen unterschieden werden (4.3-4.4). Basierend auf der Definition dieser Funktionstypen werden Identifikationsmerkmale erarbeitet.
Kap. (5) bietet einen Forschungsüberblick. Als erstes werden bestehende Erklärungsmodelle der Hilfsverbdistribution beschrieben (5.1). Begonnen wird bei der Beschreibung der Junggrammatiker. Danach werden Grundzüge der Unakkusativitätshypothese vorgestellt und ihr Erklärungspotential für die Hilfsverbdistribution im Dt. diskutiert, wobei ein kurzer Vergleich zum Italienischen (It.) und Niederländischen (Ndl.) gezogen wird. Die Darstellung wendet sich dann graduellen Modellen zu wie Soraces (z.B. 2000) Auxiliarselektionshierarchie (kurz ASH) und Shannons kognitivem Prototypenmodell (Shannon z.B. 1993). Als sprachspezifische Übertragung von Shannons universellem Modell kann das für das Dt. adaptierte, sprachspezifische Modell von Hinze/Köpcke (2007) angesehen werden. Schließlich wird die im Wesentlichen durch Leiss (1992) und Teuber (2005) vertretene These, dass Funktionsunterschiede zwischen haben + V-PP und sein + V-PP bestehen, diskutiert. Ausgehend von diesem Forschungsüberblick wird ein Vorschlag gemacht, wie bisherige Erklärungen der Hilfsverbverteilung durch ein gebrauchsbasiertes Modell gewinnbringend ergänzt werden können (5.2). Es wird die Hypothese aufgestellt, dass sich im Bereich der Bewegungsverben frequentiell gestützt ein Schema herausgebildet hat, das die Hilfsverbwahl in diesem Bereich heute produktiv steuert. Diese Hypothese wird in Teil III empirisch überprüft.
Nach dem Forschungsüberblick zur Hilfsverbdistribution betrachtet Abschnitt (5.3) die Konstruktionen von HABEN + V-PP und SEIN + V-PP im diachronen und diatopischen Vergleich mit verwandten altgerm. Sprachen. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden Konstruktionen im Gotischen (Got.) und anschließend im Ae., der dem Ahd. und As. am dichtesten verwandte altergerm. Sprache, in den Blick genommen. Danach wird skizziert, wie die ahd. und as. Perfektkonstruktionen in der bisherigen Forschung bewertet wurden und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung der Konstruktionen im Mittelhochdeutschen (Mhd.) gegeben.
1.2Teil II: Empirische Untersuchung – Die Perfektkonstruktionen im Althochdeutschen und Altsächsischen
Der erste empirische Teil präsentiert die Untersuchung von HABEN + V-PP und SEIN + V-PP im Ahd. und As. Ziel ist es, die temporal-aspektuelle Funktion sowie die Verwendungskontexte der Konstruktionen zu bestimmen; beide bilden Indikatoren für den Grammatikalisierungsgrad. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich Funktion und Verwendungskontexte wechselseitig beeinflussen.
Kap. (6) stellt zunächst das methodische Vorgehen bei der eigenen empirischen Untersuchung vor: Die Untersuchungsmethode wird umrissen, die verwendeten Texte werden vorgestellt und die Probleme, die diese Texte für linguistische Untersuchungen mit sich bringen, diskutiert. Es folgt eine knappe Skizze der Analysemethode, die im Wesentlichen auf den in Kap. (4) erarbeiteten Perfekttypen und Identifikationsmerkmalen aufbaut. Die folgenden Abschnitte präsentieren dann in chronologischer Reihenfolge die Ergebnisse, die bei der Untersuchung der Einzeltexte erzielt wurden: Beginnend mit dem Ahd. wird zunächst der Isidor (Kap. 6.2), danach der Tatian (Kap. 6.3) und schließlich der Otfrid (Kap. 6.4) in den Blick genommen. Es folgt eine Beschreibung der Belege im as. Heliand (6.5) und in den Genesisfragmenten (Kap. 6.6).
Kap. (7) fasst die wichtigsten Ergebnisse vergleichend zusammen und interpretiert sie theoretisch innerhalb des gebrauchsbasierten Modells. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Tokenfrequenz und Produktivität der Konstruktionen, ihrem Funktionsspektrum sowie den Verwendungskontexten. Ausgehend von den Daten wird ein diachroner Grammatikalisierungspfad rekonstruiert.
1.3Teil III: Empirische Untersuchung – Hilfsverbwahl im Neuhochdeutschen
Die Kap. (8)-(9) behandeln eine Korpusuntersuchung von nhd. Degree Achievements und Bewegungsverben im Deutschen Referenzkorpus des IDS Mannheim. Ziel ist es, anhand der Verben mit schwankendem Perfektauxiliar, Einflussfaktoren bzw....